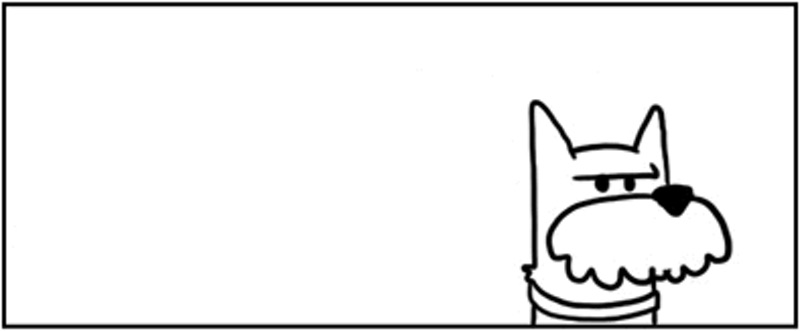Bei der Arbeit für „Tagesschaum“, 2013. Foto: WDR
Mein Hund ist eher der distanzierte Typ. Nicht wie diese Golden Retriever, die Aufmerksamkeit und Liebe wie Schwämme aufsaugen und abgeben, im Gegenteil.
Der erste Abend bei mir in der Wohnung, im Sommer 2010, war geprägt von größerer beidseitiger Ratlosigkeit. Ich hatte vorher noch nie einen Hund gehabt und fand das Gefühl sehr merkwürdig, plötzlich mit so einem fremden Lebewesen zusammenzuleben. Ich glaube, ihm ging es ganz ähnlich.
Er hatte in seiner Heimat in Ungarn bei einer Familie im Hof gelebt, durfte wohl nur gelegentlich ins Haus. Die Frau von dem Verein, der den Hund vermittelt hat, warnte mich, dass solche Hunde sich auf den krassen Statuswechsel gerne was einbilden, den es bedeutet, mit einem Mal drinnen wohnen zu dürfen. Bei Bambam hatte ich eher das Gefühl, dass er lieber im Hof geschlafen hätte. An einer praktischen Schlaf- und Liegekuhle unter einem Busch hat er über die Jahre regelmäßig gearbeitet.
Es fühlte sich am Anfang eher wie ein etwas unpersönliches Untermietverhältnis an, später wie eine lose WG. Ein anderer Hundebesitzer erzählte mir, es hätte ungefähr ein Jahr gedauert, bis sein Hund bei ihm zuhause wirklich angekommen sei, das sei bei Huskys völlig normal. Die seien auch so gezüchtet worden, nicht zu anhänglich zu sein, damit man im Zweifel bei schlechten Zeiten in der Wildnis keine Hemmungen hätte, sie zu essen. Ich fand das nicht ganz unplausibel, aber dann habe ich im Urlaub in Nordnorwegen sehr viele Huskys getroffen und die waren so unfassbar überschwänglich, liebeshungrig und verschmust, dass ich beschloss, dass es doch eher einfach mein Hund ist, der distanziert ist, und nicht seine Sorte Hund. (Außer Husky steckt noch Schnauzer in ihm.)
Es war erstaunlich schwer, ihm beizubringen, neben mir an der Leine zu gehen, ohne zu ziehen. Irgendwann, nach vielen Stunden, hat die Hundetrainerin gesagt, wir probieren das jetzt mal ohne Leine. Für mich klang das völlig absurd, aber komischerweise ging das fast auf Anhieb. Ohne Leine, auf Kommando, bei Fuß, gar kein Problem.
Keine Leine = nichts woran man ziehen könnte oder müsste.
Was auch erstaunlich leicht war: ihm beizubringen, an Straßenkreuzungen zu halten. Sobald das zuverlässig klappte, bestanden unsere Gassi-Runden daraus, dass der Hund vorauslief und sein Ding machte und am nächsten Bordstein auf mich wartete, um dann wieder vorzulaufen. „Zusammen spazieren gehen“ ist mit meinem Hund ein Euphemismus.

Draußen in der Natur ist das so ähnlich. Es ist nicht so, dass er weglaufen will oder bestimmen möchte, wo es langgeht. Meistens wartet er, sehr vernünftig, an Weggabelungen auf mich und weitere Ansagen. Aber wenn er sich sonst auf der Strecke mal umdreht, um zu sehen, wo ich bleibe, wartet er nicht ab, bis ich zu ihm aufgeschlossen habe; es reicht ihm zu sehen, dass ich irgendwo am Horizont bin, um sich wieder umzudrehen und weiterzutrotten.
Es ist ihm schon wichtig, dass ich nicht weg bin. Aber da sein muss ich auch nicht.
Er konnte erstaunlicherweise auf Anhieb relativ gut an der Leine am Fahrrad laufen, aber was auch hier viel besser ging: Während ich auf der Straße fuhr, parallel dazu auf dem Bürgersteig zu laufen. Er machte daraus manchmal ein angedeutetes kleines Wettrennen, jeweils mit dem Etappenstopp: an der nächsten Kreuzung. Beim Fahrradfahren in der Natur hatte er oft den größten Spaß, wenn er nicht direkt neben mir lief, sondern parallel ein paar Meter entfernt durch den Wald oder das Gebüsch.
Im Sommer im Café kann es passieren, dass er sich nicht unter dem Tisch einrollt, sondern mit ein paar Meter Abstand auf den Bürgersteig legt.

Foto: Gabriel Yoran
Abgesehen von ein paar Grundlagen habe ich nicht versucht, dem Hund viele Kommandos oder Kunststücke beizubringen. Ich weiß nicht, ob er dazu Lust gehabt hätte, ich hatte nicht das Gefühl.
Aber das eine Kommando, das wir wirklich viel geübt haben, lautet: „Schau!“ Es soll den Hund dazu bringen, einen anzugucken, Blickkontakt herzustellen. Bei Schäferhunden ist das nichts, was man überhaupt groß üben müsste, die sind von sich aus ganz scharf darauf, einen zu beobachten und eine Reaktion oder einen neuen Auftrag zu bekommen.
Mein Hund will das eher nicht so. Das Kommando „Schau!“ trainiert man zum Beispiel so, dass man dem Hund ein Stück Wurst hinhält, er es aber erst bekommt, wenn er nicht mehr das Futter anguckt, sondern den Menschen, der es hält. Das hat bei meinem Hund insofern geklappt, dass er es in genau dieser Situation tut, wenn er muss, aber auch keine Zehntelsekunde länger als nötig. Außer wenn er versucht, mich durch Anstarren zum Rausgehen zu bewegen, hat mein Hund kein Interesse, mit mir groß Blicke auszutauschen.
Wir haben in einem ähnlichen Sinne zusammen gelebt wie wir zusammen spazieren gegangen sind.

Falls sich das alles abschreckend liest, nach einer wirklich unbefriedigenden Mensch-Hunde-Beziehung, muss ich das korrigieren: Dieser Hund, der genau so ist, ist schon genau mein Hund. Ich weiß nicht, ob ich damit umgehen könnte, wenn mein Hund dauernd meine Aufmerksamkeit oder Nähe suchte.
Bambam ist nicht sehr anschmiegsam. Aber das bin ich auch nicht.
Ich hätte mir, zugegeben, manchmal gewünscht, dass es häufiger eine Mittelposition gibt, beim Spazierengehen zum Beispiel irgendwas zwischen den Extremen „Bei Fuß“ und „Lauf ruhig 100 Meter vor bis zur nächsten Kreuzung“, so ein: Ich schnupper hier frei rum, aber bleibe ganz in der Nähe. Und, ja, es ist auch schwer, es nicht gelegentlich persönlich zu nehmen, wenn der Hund deutlich macht, dass er gerne auf Abstand bleibt. Aber ich liebe es eigentlich, wie unabhängig, wie selbständig er ist. Meine Gene.
Die ewige Frage: Wie kommt es, dass Hundebesitzer und ihre Tiere einander oft so ähnlich sind oder werden? Mein Hund und ich sind beide grau mit Bart, manchmal haben Fremde auf der Straße deshalb gegrinst, wenn sie uns zusammen gesehen haben (oder genauer: mich eine halbe Minute nach meinem Hund). Aber viel faszinierender sind die inneren Parallelen.
Als ich mir den Hund ausgesucht habe, wusste ich nicht, dass der so ist. Es kann schon sein, dass er auch durch mich so wurde, weil mir das ganze Helikopterherrchenhafte fehlt. Ich zögere zu schreiben, dass ich ihn zu seiner Unabhängigkeit erzogen habe, denn wenn überhaupt, war es eher ein Lassen denn ein aktives Tun. Vermutlich hätte jemand anderes ihm andere Dinge beigebracht, hätte ihn vielleicht dazu gemacht, menschenfixierter zu sein oder anhänglicher, aber eigentlich denke ich, dass diese Unabhängigkeit schon Teil seines Wesens ist.
Keine Ahnung, ob ich das damals schon wahrgenommen habe, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe und sofort wusste: Wenn ich einen Hund will, dann diesen, und wenn es diesen Hund gibt, warum dann nicht einen Hund haben? Aber das wäre eine sehr unbewusste Wahrnehmung gewesen.
Es ist ja auch egal: Was für ein Glück, dass ich (über den viel zu früh verstorbenen Stefan Vogel) diesen Hund getroffen habe. Und dass er ein Teil meines Lebens geworden ist.
Diese ganzen Geschichten, von denen man hört und liest, von Hunden, die genau spüren, wenn einem was fehlt, und die dann ankommen und einen trösten, oder diese Sprüche, dass Hunde die besseren Freunde oder Partner sind, weil sie bedingungslos und vorurteilsfrei lieben – mit all dem kann ich nicht dienen. So ist er nicht.
Das bedeutet nicht, dass wir keine Bindung haben. Sarah Kuttner hat das schöne Wort von der langen „emotionalen Schleppleine“ erfunden, an der er hängt (oder ich). Ich weiß, dass ich nicht bloß jemand für ihn bin, der ihm die Futterdosen aufmacht.
Merkwürdig ist trotzdem, dass er zum Beispiel irgendwann fast nur noch mit mir Gassi gehen wollte. Mit jemand anderes aus dem Büro mal schnell um den Block – das ging nicht mehr; meistens zog er nach kürzester Zeit energisch zurück zum Ausgangspunkt. Die ausgedehnten Waldspaziergänge mit meinem Vater morgens, während ich noch im Bett lag, klappten leider auch nicht mehr, weil er vielleicht gerade noch sein Geschäft erledigte und dann zurück zu mir wollte. (Dabei hätten mein Vater und er ausgedehnteste Wanderungen miteinander machen können, was wirklich eher ein gemeinsames Hobby der beiden ist als meins.)
Es ist rätselhaft, warum er darauf besteht, mit mir zu gehen, um dann aber nicht wirklich mit mir zu gehen. Vielleicht kann irgendein Tierpsychologe das erklären. Oder, noch besser: Vielleicht ist das eine tolle komplexe Metapher für unsere ganze Beziehung, über unsere besondere Mischung aus Nähe und Distanz, Vertrautheit auf Abstand.
Emotionen zu zeigen, positive noch dazu, ist nicht sein Ding. Freudiges Schwanzwedeln ist fast ausschließlich für andere Hunde reserviert. Einmal in einem Restaurant hat ihn ein Mädchen bestimmt zehn Minuten lang gestreichelt, ohne dass er ein einziges Mal ein offensichtliches Zeichen machte, dass ihm das gefiel. (Ich glaube, es gefiel ihm.)
Abends zieht er sich gern irgendwann einfach ins Schlafzimmer zurück. Das verblüfft immer wieder Leute, wenn sie das sehen oder plötzlich merken, dass er nicht mehr da ist.
Er hat keinen größeren Drang, auch mal zu mir ins Bett zu kommen. Nur die Bequemlichkeit des Sofas, die nimmt er gerne mal in Anspruch.

Wenn er nachts aus irgendeinem Grund raus muss (das sind selten gute Gründe), dann versucht er meine Aufmerksamkeit zu erregen, in dem er ganz, ganz leise Fiepgeräusche macht. Oder, neuerdings, vorsichtige Fußtrippelgeräusche. Im Grunde versucht er, mich zu wecken, ohne mich zu wecken.
Er gibt sich auch große Mühe, wenn er sich mal übergeben muss, dass alles auf den Teppich geht und nichts auf den blanken Fußboden daneben, den man einfach abwischen könnte.
Ungefähr ein Jahr, nachdem er bei mir eingezogen war, fuhr ich für zwei, drei Wochen in den Urlaub und gab ihn in eine Hundepension auf dem Land, wo viele Hunde in zwei getrennten Bereichen tagsüber miteinander herumtobten. Das war das beste, was ihm passieren konnte. In dieser kurzen Zeit lernte er von den anderen Hunden die ganzen wichtigen Hunde-Skills. Vorher war er ein ungestümer Halbstarker gewesen, rüpelig, gelegentlich ein Mobber. Hinterher wusste er, wie man mit anderen Hunden kommuniziert, wie man Streit aus dem Weg geht, wie man Situationen deeskaliert.
Noch heute bin ich jedesmal stolz, wenn ich sehe, wie er sich einem fremden Hund vorstellt: Er bleibt mit ein bisschen Abstand stehen, wedelt sehr freundlich mit dem Schwanz und wartet, bis der andere die restliche Distanz überwindet. Vorbildlich, wie aus dem Hunde-Knigge. Oder wie er es regelmäßig schafft, doofe Situationen zu meiden: Wie er einen ängstlichen Hund oder einen Hund mit ängstlichem Besitzer komplett ignoriert. Oder um einen bedrohlichen Hund oder zwei Hunde, die irgendwie miteinander Stress haben, einfach einen Bogen macht. Zugegeben, das klappt nicht immer, es gibt Situationen, da ist auch mein Hund doof oder findet andere Hunde doof und zeigt ihnen das, aber das ist die Ausnahme.
Nur deshalb funktioniert es, dass er so oft ohne Leine unterwegs ist, und ich weiß schon, wie viele Leute trotzdem darüber empört sind, weil es nicht erlaubt ist und, wichtiger: nicht ungefährlich. Ich würde trotzdem sagen, dass mein Hund ohne Leine weniger Probleme macht als 99 Prozent aller Hunde an der Leine.

Meine Idealvorstellung von einem Leben als Hund ist die von Ice aus der Netflix-Doku-Reihe „Dogs“: Der hat einerseits den Job, einen Fischer bei der Arbeit zu begleiten, vor allem aber dreht er jeden Tag allein seine Runde durch den Ort San Giovanni am Comer See, pirscht durch die Straßen, begrüßt die anderen Einwohner, sieht nach dem Rechten. Schon klar, dass es selbst in einem abgelegenen Touristenörtchen ein kleines Wunder ist, dass das so funktioniert, und in einer Stadt wie Berlin undenkbar. Aber die Runde bei mir beim Büro um den Block, um sich jeden Tag zwei kleine Wurststicks am Quarkkeulchenstand abzuholen, die hätte er gut auch alleine drehen können, und, naja, je nachdem, wie eilig er am jeweiligen Tag gerade hatte, dort anzukommen, drehte er den letzten Teil der Runde tatsächlich alleine.
Unter den problematischen leinenlosen Situationen litt eigentlich fast immer nur ich. Wenn ich irgendwo am Waldrand stand und wartete, bis er endlich wieder da war. Oder auch in der Mitte des Waldes, bis er gemerkt hatte, dass ich gar nicht mehr die üblichen 100 Meter hinter ihm war, und er umdrehte und mit dem langsamstmöglichen Tempo zurückkam.
Der große Unterschied zwischen ihm und mir: Für ihn ist eigentlich nur die Welt draußen interessant, da wird alles beschnuppert, beobachtet, markiert, begrüßt, ausgebuddelt. Ich bin immer schon ein Drinnen-Typ gewesen. Das war auch der pädagogische Gedanke, oder jedenfalls die Rationalisierung des auf mich zutiefst irrational wirkenden Beschlusses, sich einen Hund zuzulegen: Dass es mir gut täte, mal häufiger an die sogenannte Frische Luft zu kommen.
So habe ich in den letzten 13 Jahren unendlich viele Parks, Heiden, Wälder und vor allem Seen in und um Berlin kennengelernt, die ich sonst vermutlich nie gesehen hätte. Mit dem Hund an meiner Seite (im weiteren Sinne) hatte es plötzlich einen besonderen Sinn, all diese Wege zu erkunden, Hügel zu erklimmen, Seen zu umrunden.
Einmal, da hatte ich ihn noch nicht lang, waren wir abends in der Dämmerung am Strand auf Usedom. Eine Freundin und ich saßen auf einer großen Treppe, der Hund stromerte irgendwo rum, ich hatte ihn aus den Augen verloren und war ein bisschen besorgt. Dann kam er zu meiner großen Erleichterung zu uns gelaufen und ich dachte begeistert: Na also, der Gute, er kommt schnell wieder zurück!
Dann drehte er um und begann erst richtig, allein die Gegend zu erkunden. Er hatte sich offenbar nur kurz versichert, dass wir noch da sind. Nach dem Motto: Ah, ihr bleibt hier, okay, dann hau ich nochmal ab.
Aber all das sind Geschichten aus seiner Sturm- und Drangzeit, inzwischen ist er für solche Eskapaden viel zu vernünftig (oder zu faul).

Vor ein paar Wochen ist 14 Jahre alt geworden. Er hat all das, was Hunde in dem Alter so an Leiden haben, er sieht nicht mehr ganz so gut, er hört gar nicht mehr gut (wobei ich den Verdacht habe, dass er das manchmal strategisch nutzt), er hat vermutlich Arthrose, sein Bart ist dünn geworden. Vor allem aber macht sein Herz schlapp.
Im Sommer 2021 wurde eine Herzklappenverdickung bei ihm festgestellt, was wohl eine häufige Erkrankung bei diesen Hunden ist.
Inzwischen ist daraus eine „hochgradige Mitralklappeninsuffizienz“ geworden; „es gibt Hinweise auf eine bevorstehende Dekompensation“, steht im Befund vom Januar 2023. Seitdem bekommt er vier verschiedene Medikamente; vor kurzem ist noch eins gegen eine Schilddrüsenunterfunktion dazugekommen.
Trotzdem ist er am vorletzten Wochenende noch fidel und, soweit ich es sagen kann, unbeschwert durchs geliebte Erpetal gelaufen. Dann hat sich sein Zustand plötzlich rapide verschlechtert, er ist extrem schwach, will nicht mehr laufen, muss zum Fressen überredet werden. Die Blutuntersuchung ergab: Die Zahl der roten Blutkörperchen ist viel zu niedrig, die Ursache ist unklar, viele Erklärungen kommen in Frage, fast alle sehr unschön. Selbst wenn man wüsste, woran es genau liegt, könnte man wenig tun: Eine Narkose kommt bei seinem Herzen nicht in Frage (abgesehen davon, dass grundsätzlich nicht viel dafür spricht, einen 14-jährigen Hund überhaupt operieren zu lassen).
Er bekommt jetzt ein Antibiotikum und Kortison, der Tierarzt sagte, es sei nicht auszuschließen, dass das hilft – das klingt nicht einmal so, als wäre es das wahrscheinlichste Szenario. Der Tierarzt betonte außerdem mehrmals, dass 14 Jahre wirklich sehr, sehr alt sei für so einen Hund, und er ließ keinen Zweifel, dass es Zeit sein könnte, langsam Abschied zu nehmen, mit etwas Pech sogar schnell.
Und jetzt sitze ich hier und schreibe das alles auf und ertappe mich dabei, dass ich größere Teile dieses Textes zuerst schon in der Vergangenheitsform formuliert hatte. Er scheint im Moment keine Schmerzen zu haben, aber es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass es ihn die letzten Kräfte kostet, im kleinen Park direkt um die Ecke noch schwanzwedelnd und schnuppernd andere Hunde zu begrüßen.
Es ist eine sehr schlechte Kombination: Sein Herz schafft es ohnehin kaum, frisches Blut durch den ganzen Körper zu pumpen, und nun enthält dieses Blut auch noch viel weniger Sauerstoff als normal.
Das Leben im dritten Stock ist jetzt ein Fluch. Auf dem Rückweg von jeder kleinen Runde verlangsamt er schon ein gutes Stück vor der Haustür und muss überredet werden weiterzugehen. Ich bilde mir ein, dass er das macht, weil es ihn vor dem Treppensteigen graut. (Das Leben unten im Hof, neben dem Hintereingang der Pizzeria, wo es oft so gut riecht, und neben den Mülltonnen, wo es womöglich für ihn auch oft gut riecht – es muss ihm jetzt noch attraktiver erscheinen als sonst schon.)
Neulich hat er nach exakt zweieinhalb von drei Stockwerken beschlossen, dass das wirklich nicht zu erklimmen ist. Er hat daraufhin, wie in einer billigen Komödie, einfach kehrt gemacht und ist alles wieder runter gelaufen bis ins Erdgeschoss. Ich habe ihn dann hochgetragen, das mache ich inzwischen immer, er mag das eigentlich nicht, aber oben angekommen ist der Unterschied in seiner Verfassung eindeutig. Immerhin werd ich so fitter. Er wiegt knapp 25 Kilo.
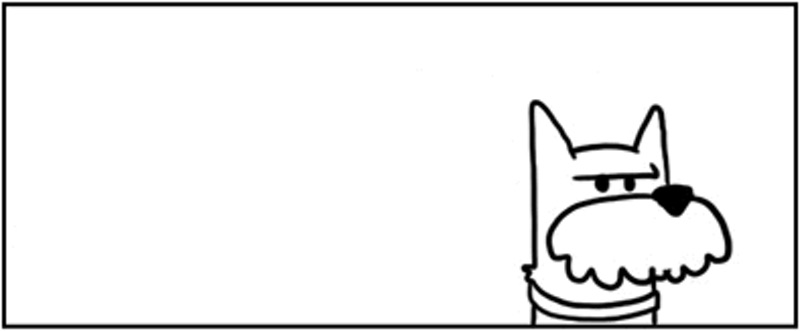
Cartoon: Johannes „Beetlebum“ Kretzschmar
Seit Jahren haben Leute mich, wenn sie ihn gesehen haben, gefragt, ob der Hund schon alt ist. Ich hab dann wahrheitsgemäß immer, leicht genervt, geantwortet: Nein, der ist einfach grau. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich diese Antwort ändern musste. Und jetzt merke ich, was das wirklich bedeutet.
Auch der Satz der Tierärztin vor gut eineinhalb Jahren, dass dieses eine Herz-Medikament die Lebenszeit durchaus um ein Jahr verlängern könne, klingt plötzlich ganz anders: Damals war das so eine abstrakte und sehr hypothetisch klingende Rechnung. Jetzt erst wird mir klar, wie sehr dabei schon mitschwang, dass womöglich die letzten Monate angebrochen waren.
Und ich frage mich, was der Hund mir bedeutet, was er mit meinem Leben angestellt hat, welche Lücke er reißt, wenn er nicht mehr da ist. In diesen Tagen wünschte ich mir, er wäre ein bisschen anschmiegsamer, weil ich das Bedürfnis habe, ihn in irgendeiner Form in den Arm zu nehmen. Aber er ist so zurückhaltend wie immer und schiebt seinen Kopf nur manchmal so unter meine Hand, dass ich seine Stirn richtig gut kraulen kann oder diese eine gute Stelle hinter dem Ohr.
Bei einem Hund, der so sparsam ist damit ist, seine Zuneigung zu zeigen, ist jedes kleine Zeichen ganz besonders toll.
Sein Hundefutter will er nicht mehr, erstaunlicherweise egal in welcher Geschmacksrichtung, aber Würstchen liebt er immer noch. Am vergangenen Samstag habe ich beschlossen, nicht mehr zu versuchen, ihm irgendwie doch noch das Dosenfutter schmackhaft zu machen. Fuck it, habe ich mir gedacht, als ich zufällig vor einer Riesenfamilienpackung Würstchen im Supermarkt stand. Es gibt wirklich keinen Grund mehr dafür, darauf zu achten, dass er sich gesund ernährt: Wenn ihn Würstchen noch glücklich machen, kriegt er halt Würstchen ohne Ende.
Er ist unglaublich behutsam, wenn er einem Futter aus der Hand nimmt.
Er hat keine Lust, Stöckchen zurückzuholen, es sei denn, man wirft sie ins Wasser.
Sein allergrößtes Hobby ist das Buddeln. Er liebt den Schnee und hasst den Sommer. Er liebt es zu schwimmen und hasst es gebadet zu werden. Er liebt es, mit Vollgas über den Sandstrand zu jagen, und hasst diese offenen Metallgitter, über die man bei Brücken oder Treppen laufen muss. Er liebt das Erpetal, den Plänterwald, die Königsheide, Käse, Leberwurst, harte, kalte Fußböden, den großen Sitzsack, den meine Mutter ihm genäht hat, Ute und Martina.
Bei seinen Abneigungen scheut er kein Klischee: Er lehnt Eichhörnchen ab, Katzen und Postboten. Oder genauer: Postbotenfahrräder. Ich wüsste wirklich gerne, was er in seiner Kindheit mal Schlimmes mit einem Postbotenfahrrad erlebt hat, das dazu führt, dass er auch nach fast 13 Jahren in Deutschland und garantiert ohne ein einziges problematisches Postbotenfahrraderlebnis an diesen Dingern nicht entspannt vorbeigehen kann, sondern sie im Vorbeilaufen wütend ankläffen will. (Ja, das ist nicht gut.)
Ach, und Schweineohren. Er hat panische Angst vor Schweineohren. Und vor Schweinen, wie wir mal in der Nähe eines Bauernhofes in meiner Heimat herausfinden mussten, aber in Berlin begegnet man denen ja nicht so oft.
Er hat jeden Tag Menschen, an denen er vorbeischlurfte, zum Lächeln gebracht. Und die Verzücktheit, die er bei manchen auslöst, ist mit zunehmendem Alter eher noch gewachsen. Und fast jeder sagt etwas originelles wie: „Oh, ein Wolf!“
Er ist unabhängig und souverän, entspannt und skeptisch, eigensinnig und cool. Er ist ein richtig guter Hund, ich bin glücklich und ein bisschen stolz, dass ich ihn meinen Hund nennen durfte, und ich vermisse ihn jetzt schon.