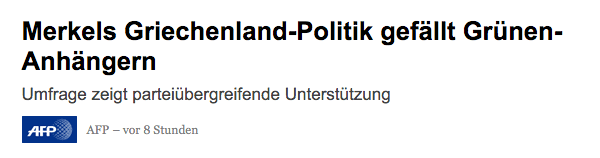Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Ombudsleute vermitteln weltweit zwischen Redaktion und Leser. In Deutschland aber selten.
Der „Spiegel“ Titel der vergangenen Woche war etwas kontrovers. „Unsere Griechen“, stand da, „Annäherung an ein seltsames Volk“. Ein Angehöriger dieser merkwürdigen Gattung war darunter gezeichnet, schnurrbärtig, dickbäuchig, Zigarette im Mund, Ouzo in der Hand, Sirtaki tanzend, im Arm einen rotgesichtigen, widerwilligen Deutschen im Fußballtrikot, der krampfhaft sein Geld festhält.
Als auf Twitter und Facebook Kritik an dem Cover laut wurde, reagierte Chefredakteur Klaus Brinkbäumer mit einem Eintrag im „Spiegel-Blog“. Er fragte die Leserinnen und Leser: „Darf man in Krisenzeiten dennoch Humor haben? Karikaturen drucken? Auf einem Titelbild?“ Rhetorische Fragen, aber sicherheitshalber schrieb er die richtige Antwort dazu: „Ja, natürlich.“
Er forderte die Kritiker dazu auf, genauer hinzusehen, und erklärte, dass es sich eben um eine Karikatur handele. Auf inhaltliche Kritik, auch an den Titelzeilen, ging er nicht ein.
Nicht alles, was wie ein Dialog aussieht, ist eine gelungene Kommunikation. Eine Debatte mit dem Publikum oder den Kritikern kam nicht zustande. Es hätte geholfen, wenn Brinkbäumer anders reagiert hätte. Es hätte aber vielleicht auch geholfen, wenn jemand anderes reagiert hätte. Wenn der „Spiegel“ eine Instanz hätte, die in solchen – und ungleich brisanteren – Fällen vermitteln könnte zwischen Lesern und Journalisten. Wenn es jemanden geben würde, der sich die Entscheidungen von der Redaktion erklären lässt, und die Kritik der Leser zusammenfasst.
Er müsste am Ende nicht einmal unbedingt, wie ein Schiedsrichter, ein Urteil fällen. Es würde reichen, wenn er ein konstruktives, kontroverses Gespräch ermöglichen könnte.
Man müsste eine solche Instanz nicht einmal neu erfinden. Sie ist vor Jahrzehnten schon erfunden worden. Es gibt sie in vielen Redaktionen auf der Welt. Es ist die eines Ombudsmanns oder einer Ombudsfrau. In Deutschland ist sie allerdings weitgehend unbekannt, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass sich das ändern wird. Dabei könnte gerade sie in Zeiten, in denen Glaubwürdigkeit für Medien eine so kritische Größe ist, ein gutes Mittel sein, um Vertrauen zu schaffen. Wenn man, wie der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, eine akute Beziehungskrise zwischen Publikum und Medien diagnostiziert, scheint es naheliegend, bei der Therapie auf Vermittler zu setzen.
„Ombudsleute können sehr viel erreichen: Verständnis wecken, Brücken bauen, Glaubwürdigkeit stärken“, sagt Stephan Ruß-Mohl von der Universität Lugano. Der Publizistik-Professor wirbt schon lange dafür und gerät fast in Rage, wenn man mit ihm darüber redet. Chefredakteure und Verlage nämlich seien „erstaunlich unsensibel“, was das Thema der Media Accountability, der Rechenschaftspflicht von Medien, angehe. Insofern „geschieht es ihnen recht“, wenn sie feststellen, dass es mit dem Vertrauen des Publikums nicht weit her sei. Und Vertrauen sei Voraussetzung für Zahlungswillen. „Deshalb wundere ich mich umso mehr, dass es nicht gelingt, die simple Wahrheit an den Mann zu bringen.“ Schon rein ökonomisch spreche viel für Ombudsleute: „Sie kosten nicht viel und können viel bewirken.“ Anton Sahlender bezeugt das gerne. Er ist „Leseranwalt“ der Würzburger „Main-Post“. Als Redakteur der Zeitung und langjähriger Stellvertreter des Chefredakteurs ist er seit kurzem im Ruhestand, aber als Ombudsmann macht er noch weiter: „Da bin ich Überzeugungstäter.“ Die Zeitung erklärt die Funktion, die er seit elf Jahren innehat, kurz so: „Als Leseranwalt vertritt er die Interessen der Leser in der Redaktion.“
Sahlender erklärt in seinen Kolumnen, warum die Redaktion Polizisten auf einem Foto unkenntlich gemacht hat (und warum das eigentlich rechtlich gar nicht nötig gewesen wäre). Er diskutiert die heikle Berichterstattung über den 16-jährigen Sohn von Michael Schumacher als Rennfahrer. Er kritisiert Fehler in der Zeitung, wägt Argumente von Beschwerdeführern ab, erläutert die Entscheidungsprozesse und Motive der Redaktion. Und zwischendurch schreibt er noch eine Ode an die Leserbriefschreiber an sich.
Unter der Überschrift „Zur Neutralität des Leseranwaltes zwischen zwei Stühlen, von denen einer dem Brötchengeber gehört“ erklärt er ausführlich, wie er seine Rolle versteht. Seine Antwort auf die Frage: „Könnte mir bitte jemand erklären, warum Leser einen Anwalt brauchen?“ beendet er damit, dass er sich mit dem Wunsch eines Lesers identifiziert, der schrieb: „Mir reicht es, wenn die Redaktion zusätzlich zum Pressekodex das Gewissen als eigene Instanz einschaltet.“ Sahlender fügt hinzu: „Dabei will ich helfen.“
Ein wesentlicher Teil seiner Arbeit findet nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern in Gesprächen mit Kollegen. „Es gibt einen Effekt nach innen“, sagt er. „Die ganze Redaktion verändert ihr Handeln; das Nachdenken über die Arbeit nimmt zu.“ Darüber hinaus gehe es um etwas, das im Journalismus erstaunlicherweise manchmal weniger selbstverständlich erscheint als in anderen Branchen: „Beschwerdemanagement“. Leser bekä- men schneller Antwort; oft entschärfe er einen Streit, auch die Anrufung des Presserates erübrige sich manchmal. „Ich pflege auch auf Idioten zu antworten“, sagt Sahlender, denn wenn man Beschimpfungen und Unterstellungen abziehe, bleibe oft genug ein sachlicher Anlass für den Ärger. Was genau er erreicht hat für die Wahrnehmung der „Main-Post“, kann er nicht sagen. „Aber wenn es sinnlos wäre, hätte ich längst hingeschmissen.“
Sahlender war der erste Ombudsmann in Deutschland. Inzwischen leitet er eine „Vereinigung der Medien-Ombudsleute“, die gerade einmal elf solche Institutionen umfasst, darunter auch den „Leserbotschafter“ des „Hamburger Abendblattes“, obwohl der sich vor allem um Beschwerden der Leser über Behörden und Unternehmen kümmert. Gruppen wie die „Initiative Qualität im Journalismus“ fordern schon lange mehr Ombudsleute in den Medien – aber es tut sich fast nichts, nicht einmal jetzt, wo viele ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Teilen des Publikums und der Medien beklagen. „Ombudsleute wären mehr denn je notwendig, obwohl das Konzept so altmodisch klingt“, sagt Sahlender. „Aber viele Chefredakteure fürchten, die Deutungshoheit zu verlieren.“
Allerdings geschieht das heute ohnehin schon, in Form von Kritik, die Leser im Internet, in Kommentaren und Blogs, auf Facebook und Twitter üben. Ombudsleute und andere Formen der Selbstreflexion wären eine Chance, den Lesern eine eigene Stimme hinzuzufügen, „nicht den Trolls und Hasspredigern das Feld zu überlassen“, wie Ruß-Mohl es formuliert.
Um der Idee von Ombudsleuten in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen, müsste ein großes Leitmedium sie aufnehmen, meint Ruß-Mohl, aber damit ist vorerst nicht zu rechnen. Der stellvertretende Chefredakteur des „Spiegels“, Alfred Weinzierl, sagt zwar, dass man mehr „in den Dialog“ mit den Lesern geht als früher – aber von der Einrichtung eines Ombudsmannes bei Medien hat er noch nie etwas gehört. Bei der „Süddeutschen Zeitung“ gibt es einen Mann, der sich im Lokalen um Anliegen von Abonnenten kümmert, und „Leserdialogteams“ – das erklärte Ziel sei es, dass inhaltliche Bedenken und Fragen angenommen würden und dass jeder Leser eine Antwort bekomme. Berthold Kohler, einer der Herausgeber dieser Zeitung, sagt, die Einsetzung eines Ombudsmanns sei bisher kein Thema in der F.A.Z. gewesen. „Daraus schließe ich, dass ich nicht der Einzige in unseren Reihen bin, der auch in Streitfällen den direkten Kontakt mit den Lesern bevorzugt.“
Die „Welt“ lässt ausrichten, man finde die Idee von Ombudsleuten „generell gut“ und beschäftige sich auch damit. Aktuell setze man den Dialog mit den Lesern vor allem über Social Media um. Der Chefredakteur der „Welt“ habe dar- über hinaus einen Referenten, zu dessen Aufgaben es gehört, mögliche Konfliktfälle im Dialog zwischen Chefredaktion, Redaktion und Leser zu klären.
Das ZDF verweist darauf, dass in Programmfragen der Fernsehrat „das maßgebliche Kontrollorgan“ sei und sich dessen Vorsitzender Ruprecht Polenz als „Anwalt des Zuschauers“ verstehe. Dafür gebe es auch die „Programmbeschwerde“ über den Fernsehrat – ein streng formales Verfahren, das das Gegenteil dessen ist, was ein guter Ombudsmann tun könnte: unbürokratisch, schnell und formlos für einen Ausgleich der Interessen sorgen, Verbündeter der Öffentlichkeit sein und sie als Verbündeten nutzen.
Natürlich sind Ombudsleute nicht die einzige Möglichkeit, sich der Kritik zu stellen, Rechenschaft abzulegen, Diskussionen über Maßstäbe für Qualität zu organisieren. Aber sie können eine besonders elegante, wirkungsvolle Möglichkeit sein. In den Vereinigten Staaten beweist das Margaret Sullivan, „Public Editor“ der „New York Times“. Sie beschäftigt sich kritisch-abwägend mit Beschwerden über die Berichterstattung der Zeitung und führt einen eigenen Kampf gegen den inflationären Gebrauch von anonymen Quellen.
Hierzulande scheitert es oft auch daran, eine geeignete Person zu finden; jemand, dessen Wort sowohl in der Redaktion Gewicht hat, als auch von außen anerkannt ist, jemand, der „nicht auf der Wassersuppe daherkommt“, wie Sahlender sagt. „Es müsste jemand sein, der im Haus sitzt, aber nicht zum Haus gehört“, meint Lorenz Maroldt, einer der beiden Chefredakteure des Berliner „Tagesspiegels“. „Es ist nicht leicht, jemanden zu finden, wenn es nicht nur ein Grüßaugust sein soll.“ Anders als vor Jahren, als schon die Einrichtung regelmäßiger Korrekturen von Lesern nicht als Ausweis von Qualität, sondern ihrem Gegenteil bewertet wurde, glaubt er, dass heute diese Form der Selbstkritik funktionieren könnte.
Nötig wäre es, insbesondere wenn hochwertige Medien ihre Leser angesichts der vielen kostenlosen Alternati- ven davon überzeugen wollen und müssen, dass es sich lohnt, Geld für sie auszugeben. „Wer hochwertige Produkte verkaufen will, muss spezielle Strategien entwickeln, um die Qualität der Angebote zu kommunizieren“, sagt Ruß-Mohl. Dazu gehöre es auch, mit dem Publikum über die Maßstäbe der eigenen Arbeit ins Gespräch zu kommen.

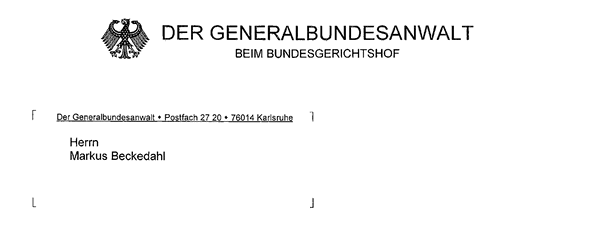

 Mit freundlicher Genehmigung von „Communicatio Socialis“. Die
Mit freundlicher Genehmigung von „Communicatio Socialis“. Die