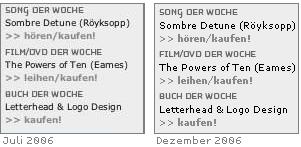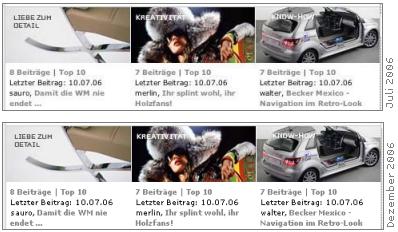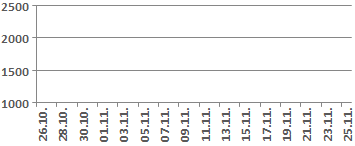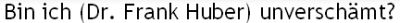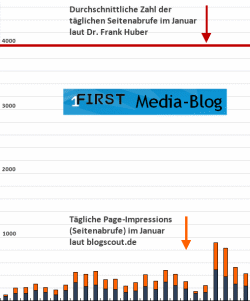Was macht eigentlich der frühere „Bild“-Mann Nicolaus Fest?
Auch der ist wütend auf die Rechtsradikalen in Heidenau. Weil die durch ihr Vorgehen die „richtige Sache“ beschädigten:
Wie immer die gleichen unerfreulichen, dämlichen Protagonisten, und immer wieder der Rückgriff auf Hitlergruß, SS-Zeichen und Nazi-Gesänge. Nichts beschädigt die richtige Sache nachhaltiger als das Engagement des braunen Gesindels.
Fest führt nicht konkret aus, was genau die „richtige Sache“ in diesem Zusammenhang ist: Die erfolgreiche Abschreckung und Vertreibung aller Flüchtlinge? Die klare Ansage an die Politik, dass das deutsche Volk nicht gewillt ist, weitere Menschen aus dem Ausland aufzunehmen? Das Stoppen der Zuwanderung?
Aber seine Satzfolge muss man wohl so verstehen, dass Fest die Ziele der rechtsradikalen Gröler und Randalierer teilt. Nur ihre Methoden lehnt er ab. Nicht zuletzt, weil sie kontraproduktiv seien.
Die Nazis, so verstehe ich ihn, sollten andere für die richtige Sache kämpfen lassen. Menschen, die weniger hässlich sind, weniger ordinär und weniger dumm. Menschen wie Nicolaus Fest.
Fest ist der Sohn des Historikers und früheren FAZ-Herausgebers Joachim Fest. Er war mehrere Jahre in leitenden Positionen bei „Bild“ und „Bild am Sonntag“ und einer der engsten persönlichen Berater des Chefredakteurs Kai Diekmann. Vor gut einem Jahr sprach er in der „Bild am Sonntag“ in einem Kommentar Moslems grundsätzlich ab, sich in die deutsche Gesellschaft integrieren zu können. Davon distanzierte sich Diekmann und, mit etwas Verzögerung, „Bild am Sonntag“-Chefredakteurin Marion Horn. Wenige Monate später verließ Fest den Springer-Verlag, „freiwillig“.
Vermutlich muss man es sich so vorstellen, dass Fest sich in der „Bild“-Zeitung immer zurückhalten musste. Dass sie einfach, so unwahrscheinlich das klingt, zu seriös, zu verdruckst, zu „politisch korrekt“ für ihn war. Nun schreibt er seine Texte mutmaßlich ungebremst in sein Blog. Man kann sie aber immer wieder auch im islamfeindlichen Hass- und Hetzblog „Politically Incorrect“ lesen.
Fest ist enttäuscht von den Protesten und Ausschreitungen in Heidenau. Er beklagt konkret ihre „Einfallslosigkeit“: „Ein paar Kleinstdemonstrationen vor Flüchtlingsheimen, mal mehr gewalttätig, mal weniger“, das sei kontraproduktiv und „medial unsinnig“ – das könnte man doch wirklich besser machen. Er hat konkrete Vorschläge:
Schon zehn Lastwagenfahrer, die sich per Schritttempo an verschiedenen Zugangsstraßen zu einer Spontandemo zusammenschließen, könnten jede Landeshauptstadt, das Kamener Kreuz oder den Berliner Ring stilllegen. Auch der Zugang zu den Regierungsmaschinen in Tegel oder Schönefeld wäre leicht zu blockieren, wie auch der Frankfurter Flughafen. Zudem böten Lastwagen oder die Anhänger von Traktoren genügend Fläche, um den Protest zu plakatieren. Schließlich läge in solchen Aktionen auch ein passendes Gleichnis: Die Zuwanderung als wirtschaftliche und zivilisatorische Rückführung Deutschlands in die Schrittgeschwindigkeit, welche die GRÜNEN seit Jahren propagieren… Die mediale Aufmerksamkeit wäre in jedem Fall um ein Vielfaches höher als bei den trostlosen Kundgebungen vor einem der afrikanischen Brückenköpfe irgendwo in der Provinz.
Flüchtlingsunterkünfte wie in Heidenau – Fest nennt sie „afrikanische Brückenköpfe“.
Die Frage, wie er „das Problem des Flüchtlingsstroms lösen“ würde, beantwortete Nicolaus Fest schon vor ein paar Monaten so:
Arabisch, eben wie Saudi-Arabien, Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate es tun, oder auch fast alle Länder außerhalb Europas: Abschotten, Grenzen dichtmachen, allenfalls einzelne Personen aufnehmen.
Mit der „Einwanderung von Menschen aus afrikanischen oder muslimischen Kulturkreisen“ finde nämlich auch ein „irreparabler Kulturbruch“ statt:
Welches Kind von Einwanderern kennt die alten deutschen Lieder, die Heiligen in der Kirche, die Märchen von Grimm, Andersen, Hauff? In 50 Jahren wird Eichendorf so vergessen sein wie Jean Paul, wie Dürer oder Heckel, Schubert oder Brahms.
In 50 Jahren? Ein „f“ von Eichendorff ist sogar jetzt schon vergessen!
(Und nehmen wir zugunsten von Fest einmal an, dass er mit den „alten deutschen Liedern“ nur sowas wie „Im Frühtau zu Berge“ oder „Der Mond ist aufgegangen“ meint.)
Womöglich jedenfalls ist Fest an dieser Stelle aufgefallen, dass die Antwort auf seine rhetorische Frage kaum anders ausfiele, wenn er sie nicht auf Kinder von Einwanderern, sondern von Einheimischen bezogen hätte. Das ließ ihn aber nicht innehalten, sondern erst recht ausholen, und so fuhr er fort:
Doch warum sie auch erinnern, wenn schon den Deutschen ihr Eigenes so gleichgültig ist?
Im Grunde erleben wir auch hier seit Jahren täglich die Kultursprengungen von Palmyra. Nur heißen sie hier Rechtschreibreform, Einheitsschule, Bologna oder frühkindliche Sexualerziehung. Und die Täter sitzen in der Schulbürokratie und bei der GEW.
Er hat die Umstellung auf fünfstellige Postleitzahlen vergessen.
Aber, immerhin, das muss ihm erstmal einer nachmachen: Islamisierung, Rechtschreibreform und frühkindliche Sexualerziehung in einer gemeinsamen Mini-Kultur-Apokalypsen-Prophezeihung unterzubringen. Und sie, damit die Sache richtig Schwung kriegt, mit der mutwilligen Zerstörung antiker Kulturgüter wie in Palmyra durch den „Islamischen Staat“ gleichzusetzen.
Das eigentlich Apokalyptische an der Gegenwart ist für Fest, dass keine rechte Weltuntergangsstimmung aufkommen mag. „Insgesamt erstaunlich“, sei es,
„wie gelassen die Mehrheit der Deutschen in der so genannten ‚Flüchtlingsfrage‘ den zehntausendfachen Rechtsbruch, die Okkupation von Schulhallen und Städten wie auch die offene Ausplünderung hinnimmt.“ Seine Sprache lässt erahnen, wie sehr ihn die angebliche Gelassenheit stört: Die Wörter, die er wählt, lesen sich gezielte Öltropfen, die er versuchsweise in Glutnester träufelt. Okkupation, Ausplünderung, zehntausendfacher Rechtsbruch. „Klartext“ hätte er das früher bei „Bild“ genannt.
Der langjährige „Bild“-Mann Nicolaus Fest hat eigene Vorschläge entwickelt, wie die deutsche Politik mit der „‚Flüchtlings‘-Frage“, wie er sie mit spitzen Fingern nennt, umgehen müsste. Genüsslich formuliert er aus, dass bei seiner Strategie, Asylsuchende abzulehnen, „wenn zu vermuten ist, dass sie keine Affinität zu demokratisch-westlichen Werten haben“, automatisch „alle Muslime außen vor“ wären (außer die Aleviten).
Es ärgert ihn, dass Muslime wie Franck Ribéry einfach in aller Öffentlichkeit vor einem Fußballspiel beten und damit „offen einen Glauben zelebrieren, der bekanntermaßen Glaubensfreiheit wie die Gleichberechtigung der Geschlechter verneint, Demokratie ablehnt und Homosexuelle wie Apostaten mit dem Tod verfolgt“.
Das bringt Fest auf den Gedanken, was denn los wäre, wenn ein Fußballer „vor jedem Spiel den Hitlergruß“ machte, „wenn auch in veränderter, vom Strafgesetzbuch nicht erfasster Weise“ und auf Nachfrage antworten würde, er verachte die Grausamkeiten des Nationalsozialismus, glaube aber an seine Reformierbarkeit.
Daran muss er denken, wenn er Franck Ribéry auf dem Fußballplatz beten sieht, und er fragt sich, warum offenbar „niemand“ (außer ihm) darin ein Problem sieht und der DFB und die Vereine nichts dagegen tun.
Es geht ihm erkennbar darum, aus der schwierigen Auseinandersetzung mit dem Islam eine einfache, ganz persönliche mit jedem einzelnen Moslem zu machen. Es geht ihm darum, diese Menschen, wenn man sie schon nicht mehr aus dem Land kriegt, auszugrenzen.
Er gefällt sich in der Rolle desjenigen, der den vermeintlichen Konsens sprengt; der Dinge sagt, die andere erschrocken einatmen lassen. Lustvoll lässt er seiner Menschenfeindlichkeit freien Lauf und schreibt:
„Wenn die Flüchtlinge schon hier sind, muss man sie auch gut behandeln.“ Einer der unhinterfragbaren Glaubenssätze der herrschenden Trivialcaritas. Wer es dennoch tut, kann jede Party sprengen. Tatsache ist: Fast 100 Prozent der hiesigen Asylbewerber und Wirtschaftsflüchtlinge melden sich unter klarem Verstoß gegen Dublin III. Richtig müsste es daher heißen: „Wenn die Einbrecher schon im Haus sind, sollte man ihnen auch Geld, Schmuck und ein Bett anbieten.“
Er formuliert diese Sätze, nur zur Erinnerung, in einem Klima, in dem es fast jeden Tag Übergriffe auf vorhandene oder geplante Flüchtlingsunterkünfte gibt. Er schreibt, als wolle er mal ein bisschen Zunder in die Bude bringen, dabei brennt die lichterloh.
Es ist ja richtig, dass wir die Statements der schlimmsten und dümmsten Hetzer auf Facebook sammeln und uns an ihren Rechtschreibfehlern ergötzen, aber was machen wir mit jemandem wie Nicolaus Fest? Wie setzen wir uns mit diesen Leuten auseinander? Reicht es, angestrengt angeekelt wegzuschauen?
Gut, immerhin hat er die Bühne der „Bild“-Zeitung nicht mehr, seit er im Oktober vergangenen Jahres den Springer-Verlag „auf eigenen Wunsch“ verließ. „BamS“-Chefin Marion Horn dankte ihm damals „für seine hervorragende journalistische Arbeit“. Der Verlag betonte, Fest bleibe „dem Haus verbunden“.
· · ·
In Dürrenmatts Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ gibt es die Figur eines Akademikers, eines Dr. Phil, der mit den Brandstiftern gemeinsame Sache macht, und am Ende, als der Himmel schon brennt, eine Erklärung abgibt:
DR. PHIL: Ich kann nicht länger schweigen.
Er nimmt ein Schriftstück aus der Brusttasche und verliest.
„Der Unterzeichnete, selber zutiefst erschüttert von den Ereignissen, die zur Zeit im Gang sind und die auch von unsrem Standpunkt aus, wie mir scheint, nur als verbrecherisch bezeichnet werden könne, gibt die folgende Erklärung zuhanden der Öffentlichkeit:—“
Viele Sirenen heulen, er verliest einen ausführlichen Text, wovon man aber kein Wort versteht, man hört Hundegebell, Sturmglocken, Schreie, Sirenen in der Ferne, das Prasseln von Feuer in der Nähe; dann tritt er zu Biedermann und überreicht ihm das Schriftstück.
Ich distanziere mich—
BIEDERMANN: Und?
DR. PHIL: Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe.
Er nimmt seine Brille ab und klappt sie zusammen.
Sehen Sie, Herr Biedermann, ich war ein Weltverbesserer, ein ernster und ehrlicher, ich habe alles gewußt, was sie auf dem Dachboden machten, alles, nur das eine nicht: Die machen es aus purer Lust!
Aber „Biedermann und die Brandstifter“, das kennt ja heute wegen der ganzen täglichen Kultursprengungen auch keiner mehr.