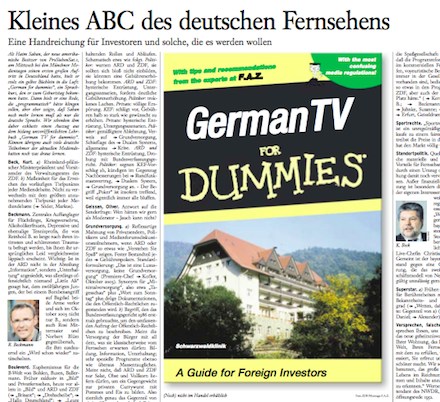Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Seit Anrufsendern, die gutgläubige Zuschauer in die Irre führen, Bußgelder drohen, ist das Geschäft fairer geworden – und schlechter. Dabei hat noch keiner bezahlt.
Heute würde es Schlag auf Schlag gehen. Kein Gerede, keine Verzögerungen, garantiert zwanzig Gewinner in fünfzehn Minuten. Dirk Löbling, der Animateur, der an diesem späten Donnerstagabend Dienst hat bei 9Live, scheint angemessen aufgeregt. So ein „Gewinner-Countdown“, erklärt er, sei „sehr speziell“. Und weil er von der Regie vorgegeben werde, könne man sich darauf verlassen, dass das damit verbundene Versprechen eingehalten werde.
Vierzehneinhalb Minuten später ist ein Gewinner gefunden. Es stehen noch 25 Sekunden auf der Uhr, es fehlen noch 19 Gewinner, und Löbling macht Geräusche und Gesten, die seine Fassungslosigkeit ausdrücken sollen. Wie soll das zu schaffen sein?
Es ging dann doch recht entspannt. Es stellte sich nämlich heraus, dass der Anrufsender bei seinem „Gewinner-Countdown“ nur die Zeit zählt, die er zählt. Bis die nächsten zwanzig Sekunden Spielzeit abgelaufen waren, verging eine Dreiviertelstunde, in der der Moderator sich zeitweise mit einem Menschen in seinem Ohr über die Blumen in der Studiodekoration unterhielt. Nach endlosen Minuten erbarmte er sich, zählte einen Countdown runter, dann lief der „Gewinner-Countdown“ wieder weiter, jemand wurde durchgestellt, nannte einen Beruf, der auf „-er“ endet, und gewann einen zweistelligen Eurobetrag. Es schien, als müsse man sofort anrufen, weil das Spiel sofort vorbei sei. Aber 9Live könnte im Notfall einen solchen „Gewinner-Countdown“ von wenigen Sekunden über Jahre strecken.
Sie machen sich immer noch einen Spaß – und vor allem natürlich: ein Geschäft – daraus, die Zuschauer in die Irre zu führen. Aber die Hoch-Zeiten des Call-TV sind vorbei, im Guten wie im Schlechten. Die Tricks, die 9Live heute einsetzt, sind vergleichsweise harmlos. Aber auch die Erlöse sind nicht mehr, was sie mal waren. Der Marktanteil des Senders liegt bei nur noch 0,1 Prozent – bei jüngeren Zuschauern ist er nicht mehr messbar. Für die Schwestersender Sat.1, Pro Sieben und Kabel 1 produziert 9Live noch Anrufsendungen tief in der Nacht; eine Sendung wie „Quiz Night“ auf Sat.1 läuft regelmäßig vor immerhin ein- bis zweihunderttausend Zuschauern – aber wer weiß, wie viele von denen wach sind.
Auch der Spartenkanal Sport 1 bessert sein Einkommen mit den Telefongebühren dummer Zuschauer auf und lässt werktags nachmittags zum Beispiel weibliche Vornamen mit „A“ am Ende raten (gesucht waren am Freitag: „Notburga, Immacolata, Inmaculada, Fatoumata, Fearchara, Femmechina, Fionnghuala, Flordeliza, Rizalia, Boglarka“). Aber Sender wie Super-RTL, MTV, Viva, Nickelodeon, Tele 5 und Das Vierte haben sich inzwischen von dem zwielichtigen Geschäft verabschiedet; in der Schweiz sorgte ein Gerichtsurteil für das abrupte Ende der Branche.
Warum das Geschäft nicht mehr so läuft? Die einfachste Erklärung ist, dass die Teilnehmer im Laufe der Zeit entweder zu klug oder zu arm geworden sind, um noch mitzumachen. Pro-Sieben-Sat.1 nennt in seinem Geschäftsbericht als Grund für die sinkenden Anruferzahlen und Erlöse „die Einführung einer neuen Gewinnspielsatzung der Landesmedienanstalten“. Neu daran waren weniger die Regeln, die Mindeststandards an Fairness und Transparenz sicherstellen sollen und in ähnlicher Form schon vorher galten; neu war die Möglichkeit, Bußgeld gegen Sender zu verhängen, die sich nicht an sie hielten.
Seit die Satzung vor eineinhalb Jahren in Kraft getreten ist, hat die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Medienanstalten 54 Beanstandungen ausgesprochen und Bußgeld in Höhe von 575 500 Euro verhängt, den größten Teil gegen 9Live. Die Mängel sind fast immer dieselben: Es sei unzulässig Zeitdruck aufgebaut, über die Auswahlverfahren und Einwahlchancen in die Irre geführt oder über den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe getäuscht worden.
Dem 9Live-Animateur Jürgen Milski, der als „Big Brother“-Kandidat und Kumpel des selig vergessenen Ztlatko aufgefallen war, wurde jetzt eine besondere Ehre zuteil: Erstmals sprach die ZAK ein Bußgeld nicht nur gegen den Sender, sondern auch den Moderator persönlich aus. Gesucht waren: „Tiere mit Doppelbedeutung“. Keine einzige der achtzehn 9Live-Lösungen (darunter Holzbohrer, Feuerwalze, Perlhuhn, Rammbock) wurde erraten. Inwiefern es sich zum Beispiel beim Rammbock überhaupt um ein Tier handele, ließ der Sender offen. Milski erweckte dafür wiederholt den Eindruck, es handle sich um ein leichtes Spiel. „Normalerweise halten wir uns an die Geschäftsführung und den Sender, weil es um strukturelle Probleme oder seine Aufsichtspflicht geht“, sagt Axel Dürr, Sprecher der in der ZAK geschäftsführenden baden-württembergischen Landesmedienanstalt LfK. In diesem Fall aber habe es den Eindruck gegeben, dass Milski besonders eigenmächtig die Regeln brach.
Jeder dieser Bußgeldbescheide ist ein kleines Wunder, denn er ist das Ergebnis eines bürokratischen Kraftaktes: Die zuständige Landesmedienanstalt stellt einen Verstoß fest, gibt dem Sender Gelegenheit zur Stellungnahme, wertet sie und gibt den Fall an die Prüfgruppe der ZAK, die ihn an die eigentliche Kommission aus den 14 Direktoren der Medienanstalten weiterleitet, die über den Bußgeldbescheid entscheidet, dessen Ausstellung dann wieder der zuständigen Medienanstalt obliegt. Gegen den Bescheid kann der Sender Beschwerde einlegen, womit sich wiederum die Medienanstalt beschäftigt und dann erneut die ZAK.
Am Ende, wenn die Sender das Bußgeld nicht akzeptieren, geht es vor Gericht. Und weil das dauert und die Sender bislang gegen jede Beanstandung Beschwerde eingelegt haben, ist nach Auskunft von Dürr bislang kein Cent tatsächlich bezahlt worden. Gegen verschiedene Pflichten, die Spiele transparent und fair zu veranstalten, wehrt sich 9Live zudem mit einer Klage und bestreitet die Rechtmäßigkeit der Satzung insgesamt. In einzelnen Punkten gab ihm das Verwaltungsgericht München im vergangenen Jahr Recht, beide Seiten sind in Revision gegangen.
Trotz des langen, schwierigen Prozesses meint Dürr, dass die Satzung und die Bußgelder Wirkung gezeigt hätten. Neben den drohenden Kosten schmerze die Sender vor allem, dass die ZAK ihre Beanstandungen konsequent öffentlich macht. „Es ist immer noch nicht alles Gold, und wir lehnen uns nicht zurück, aber es hat sich einiges getan. Ein Großteil der Beanstandungen ist abgestellt worden.“ Tatsächlich warnt 9Live zum Beispiel regelmäßig, dass die Zuschauer auf ihr „Telefonverhalten“ achten sollen. Es läuft sogar immer wieder der Hinweis durchs Bild, dass die Chance, durchgestellt zu werden, nicht von der Zahl der angeblich offenen „Telefonleitungen“ abhänge – diesen Eindruck haben die Produzenten sonst immer gerne erweckt.
Auch Marc Doehler meint, es gebe „definitiv Fortschritte“. Er verfolgt mit anderen Verrückten seit Jahren die Call-TV-Programme und protokolliert den Ablauf in einem Forum (citv.nl). Es sind ausführliche und erschütternde Dokumente der Täuschungen und Lügen, die wohl einen wesentlichen Beitrag geleistet haben, die schlimmsten Auswüchse abzustellen. Viel weniger Regelverstöße entdeckt Doehler heute im Programm, auch weil nur noch eine Handvoll einfacher Spiele immer wieder wiederholt werde. Teilweise würden die Zuschauer zwar mit ausgeklügelten Tricks noch in die Irre geführt. Aber wer auf die idiotischen Aussagen der Moderatorinnen hereinfalle, die die Aufgabe, eine deutsche Stadt mit A an zweiter Stelle zu finden, als „ziemlich schwer“ bezeichnen, sei schon selbst schuld. Warum er trotzdem noch guckt? „Der Unterhaltungsfaktor ist immer noch groß“, gibt Doehler zu. „Und ehe ich mir ‚Frauentausch‘ ansehe…“
9Live möchte sich zu alldem nicht äußern, weil man „derzeit konstruktive Gespräche mit der ZAK“ führe. Deren Sprecher Dürr bestätigt, dass geredet wird: „Da ist Bewegung drin.“ Im September werde die ZAK eine Bilanz der Gewinnspielsatzung vorlegen, womöglich gäbe es bis dahin auch eine Absprache mit 9Live, die die endlosen Verfahren unnötig mache. Das Ziel beider Seiten sei dasselbe: dass weniger Bußgelder verhängt werden müssen.
Eine andere Auseinandersetzung mit Call-TV-Veranstaltern eskaliert dagegen gerade: Es geht um die Firmen Mass Response und Primavera, die mit besonders dubiosen Methoden unter anderem im Schweizer Fernsehen auffielen. Zu den Unregelmäßigkeiten, die von Beobachtern wie Doehler und der Seite fernsehkritik.tv dokumentiert wurden, gehört, dass Umschläge mit den Lösungen in der Live-Sendung plötzlich verschwanden und an anderer Stelle wieder auftauchten, was den Verdacht von Manipulationen nährte. Die Firmen bestreiten dies und gehen juristisch gegen die Kritiker vor. Einiges deutet darauf hin, dass es in den anstehenden Prozessen endlich nicht mehr um Formalien geht oder sich die Firmen mit einem Verwirrspiel um die Verantwortlichkeiten herausreden können, sondern sich die Gerichte in der Sache mit den Betrugsvorwürfen auseinandersetzen werden. [Nachtrag, 26. September: Bislang sind gerichtliche Verfahren, die von Primavera gegen diese Vorwürfe eingeleitet hat, zu Gunsten der Call-TV-Firma ausgegangen oder noch nicht rechtskräftig beendet.] Als Zeugen sind auch viele Producer und Moderatoren benannt, die die unwahrscheinlich klingenden Erklärungen der Produktionsfirmen plausibel machen sollen.
Der Countdown läuft.
 Ich habe mich an den falschen Altersangaben der „Bild“-Zeitung abgearbeitet, 9live-Sendungen transkribiert, eine dreistellige Zahl von Hitlisten-Sendungen der Dritten Programme zusammengetragen und mehrteilige Dieter-Wedel-Filme ohne vorzuspulen angesehen. Aber die Lügen, der Irrwitz, die Dummheit und die Dreistigkeit, die ganze niederträchtige Propaganda des „Handelsblattes“ und anderer Medienpartner in der Kampagne gegen die Piratenpartei und die sogenannte Netzgemeinde: Ich fürchte, die Auseinandersetzung mit all dem übersteigt selbst meinen Masochismus.
Ich habe mich an den falschen Altersangaben der „Bild“-Zeitung abgearbeitet, 9live-Sendungen transkribiert, eine dreistellige Zahl von Hitlisten-Sendungen der Dritten Programme zusammengetragen und mehrteilige Dieter-Wedel-Filme ohne vorzuspulen angesehen. Aber die Lügen, der Irrwitz, die Dummheit und die Dreistigkeit, die ganze niederträchtige Propaganda des „Handelsblattes“ und anderer Medienpartner in der Kampagne gegen die Piratenpartei und die sogenannte Netzgemeinde: Ich fürchte, die Auseinandersetzung mit all dem übersteigt selbst meinen Masochismus.