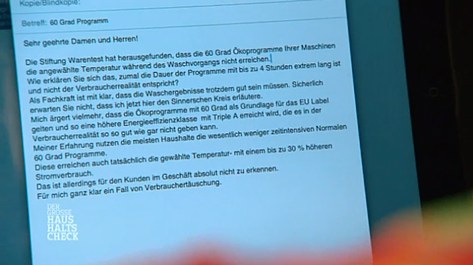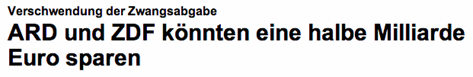Der Dortmunder Journalistik-Professor Horst Pöttker möchte von der Presse grundsätzlich darüber informiert werden, wenn Straftäter oder Verdächtige ausländischer Herkunft sind. Er fordert in der aktuellen Ausgabe der „Zeit“, die Richtlinie 12.1 im Pressekodex ersatzlos zu streichen. In der heißt es, dass die „Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt“ werden soll, „wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht.“
Über diese Richtlinie und ihre Wirkung kann man streiten. Man sollte dafür aber bessere Argumente haben als Horst Pöttker.
· · ·
Pöttker macht seine Kritik an einem konkreten Beispiel fest: Dem tödlichen Angriff einer Gruppe von jugendlichen Fußballspielern auf einen Linienrichter, im Dezember 2012 in Alemere bei Amsterdam. Pöttker schreibt:
Niederländische Medien berichten sofort, dass es sich bei den drei Jugendlichen um Marokkaner handelt. In Deutschland erfährt man dies erst einige Tage später aus rechten Blogs.
Das stimmt nicht. Die ersten Meldungen über den Tod des Linienrichters erschienen in Deutschland am Dienstag nach der Tat. Am Mittwoch berichtete der „Tagesspiegel“ ausführlich und schrieb:
Dass es sich bei den festgenommenen Schlägern laut „Algemeen Dagblad“ um drei Marokkaner handelt, macht den Fall nicht unbedingt leichter. Nach einem Bericht des Innenministeriums vom November 2011 wurden 40 Prozent aller marokkanischen Einwanderer im Alter zwischen 12 und 24 Jahren innerhalb der letzten fünf Jahre wegen Verbrechen in den Niederlanden verhaftet, verurteilt oder angeklagt. In Stadtvierteln mit mehrheitlich marokkanischstämmigen Einwohnern erreiche die Jugendkriminalität bereits 50 Prozent.
Einen Tag darauf berichtete die „taz“:
Auf niederländischen Websites wurde schon am Dienstag intensiv über die Täter diskutiert. Im Mittelpunkt standen dabei deren vermeintlicher Hintergrund und die Frage, ob es sich um „allochthone“, also Migranten handele. Die Boulevard-Zeitung Telegraaf zitierte den BuitenBoys-Vorsitzenden Oost, nach dem die Aggressoren drei marokkanische Spieler von Nieuw Sloten gewesen.
Die „taz“ lieferte auch ein Beispiel, wie die laut Pöttker so vorbildlich selbstzensurfreien niederländischen Medien teilweise berichteten. Am Dienstagabend habe die neokonservative Website GeenStijl.nl getitelt:
Nieuw-Sloten: Es waren AUSLÄNDER.
Richtig ist, dass in den deutschen Nachrichtenagenturen und vielen anderen Artikeln die Herkunft der Täter nicht genannt wurde. Pöttker fragt: „Warum haben seriöse deutsche Medien die Herkunft der Totschläger verschwiegen?“ Und urteilt:
Mit meinem Verständnis von Journalismus ist eine derartige Selbstzensur nicht zu vereinbaren. Journalisten sollten nicht die Erzieher der Nation sein.
Er schließt mit einem Zitat von Ingeborg Bachmann: „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“
Offenbar besteht die „Wahrheit“ für Pöttker darin, die ethnische Zugehörigkeit von Tatverdächtigen zu nennen. Ob diese Zugehörigkeit irgendetwas mit der Tat zu tun hat, spielt für ihn entweder keine Rolle oder er geht davon aus, dass das eh immer der Fall ist: Eine Tat erklärt sich durch die Herkunft des Täters.
Warum ist diese — und anscheinend nur diese — Information so entscheidend, dass ein Verzicht auf sie in der Berichterstattung einem Verzicht auf die Wahrheit gleichkommt? Was sagt es uns, dass die Täter in diesem Fall marokkanischer Abstammung waren? Dass Marokkaner generell zu Gewalt neigen? Dass sie in den Niederlanden schlecht integriert sind? Dass es eigentlich kein Problem mit Jugendgewalt gibt oder mit Fußballgewalt, sondern mit Ausländergewalt? Oder ist die Nationalität eigentlich gar nicht relevant, sondern nur eine Chiffre für die Religion, und es zeigt sich in der Brutalität des Angriffs nur, wie viele der rechten Blogs sofort unterstellen würde, die Neigung von Moslems zu Gewalt?
Warum gibt sich Pöttker mit der Forderung zufrieden, die ethnische Herkunft von Tatverdächtigen zu nennen? Wäre es nicht die „Wahrheit“, zu schreiben: „Islamische Jugendliche überfallen christlichen Linienrichter“? Das ist womöglich auch wahr.
André F. Lichtschlag wies in seinem Online-Magazin „eigentümlich frei“ bedeutungsschwanger darauf hin, dass der Mann, der drei Monate vor dem Gewaltausbruch in den Niederlanden eine Frau in einem Jobcenter in Neuss erstach, auch marokkanischer Herkunft war. Und dass der Mann, der Monate zuvor in Belgien um sich schoss und viele Menschen tötete und verletzte, Sohn marokkanischer Einwanderer sei.
Drei ganz unterschiedliche Gewaltakte in drei ganz unterschiedlichen Situationen an drei ganz unterschiedlichen Orten — aber alles Marokkaner. Das kann doch kein Zufall sein, meint Lichtschlag, ohne zu erklären, was es stattdessen ist und was wir daraus für den Umgang mit Menschen marokkanischer Herkunft schlussfolgern sollten. (Die Gewalttaten, die auf das Konto mitteleuropäischer Menschen ohne Migrationshintergrund gehen, scheint er nicht addieren zu wollen.)
Aber in Deutschland werden Menschen mit Migrationshintergrund ja nicht mehr diskriminiert. Stellt jedenfalls Horst Pöttker beiläufig fest, während er erklärt, dass in der Richtlinie des Pressekodex ursprünglich nicht von „Minderheiten“ die Rede war, die vor Diskriminierung zu schützen seien, sondern von „schutzbedürftigen Gruppen“:
Aber sind die 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die heute in Deutschland leben, tatsächlich schutzbedürftig? Als der Presserat das Wort 2007 strich, hatte er offenbar bemerkt, dass das nicht (mehr) der Fall ist.
Die Sätze muss man auch erstmal so hinschreiben — insbesondere, während in München ein Prozess wegen einer Mordserie gegen Menschen mit Migrationshintergrund läuft, bei der sich Polizei und Medien über viele Jahre nur vorstellen konnten, dass die türkischen und griechischen Opfer selbst irgendwie kriminell sein mussten. Und wer meint, dass das Ermordetwerden ja ein Schicksal ist, das in Deutschland nur wenige Ausländer erleiden, der lese diesen aktuellen „Tagesspiegel“-Artikel über den Alltagsrassismus, den ein 15-Jähriger in Berlin erlebt.
Menschen mit Migrationshintergrund sind keine schutzbedürftigen Gruppen mehr. Das steht da wirklich. Und die „Zeit“, die sich seit einer Weile als Kämpfer gegen vermeintliche Denk- und Sprechverbote profiliert, gegen das, was sie als „Political Correctness“ bezeichnet und für einen „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen“-Populismus, hatte offenbar kein Problem damit.
· · ·
Man kann den Unterschied zwischen einer wahren Tatsache und der Wahrheit auch ganz gut an Pöttkers Artikel selbst deutlich machen. Er erklärt, dass die von ihm kritisierte Richtlinie auf eine Anregung des Verbands der Deutsch-Amerikanischen Clubs von 1971 zurückgehe, um bei der Berichterstattung über Zwischenfälle mit amerikanischen Soldaten „darauf zu verzichten, die Rassenzugehörigkeit der Beteiligten ohne zwingend sachbezogenen Anlass zu erwähnen“, wie es damals hieß. 1993 sei sie auf Anregung des Zentralrates von Sinti und Roma verschärft worden.
Das mag wahr sein, aber der Eindruck, die Richtlinie sei eine deutsche und historische Besonderheit, ist falsch. Zur „Wahrheit“ hätte auch die Information gehört, dass sich ähnliche Richtlinien in vielen Medienkodizes finden, zum Beispiel im Handbuch von Reuters („Mention race or ethnicity only when relevant to the understanding of a story“), den Richtlinien der britischen und irischen National Union of Journalists („Only mention someone’s race if it is strictly relevant“) und dem britischen Pressekodex („Details of an individual’s race, colour, religion, sexual orientation, physical or mental illness or disability must be avoided unless genuinely relevant to the story“).
Gründen all diese Richtlinien ebenfalls auf „historischen Umständen, die sich geändert haben“, wie Pöttker schreibt? Nein, sie gründen auf der Erfahrung und Erkenntnis, dass Menschen verallgemeinern und Stereotype bilden. Dass sie aus der Erwähnung, dass ein Gewalttäter marokkanischer Herkunft war, schließen, dass diese Tatsache bedeutungsvoll ist und dass sie nicht nur etwas über den Täter aussagt, sondern auch über Marokkaner.
Pöttker meint, es würde reichen, wenn im deutschen Pressekodex zu diesem Thema nur noch der Satz stehen bliebe: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.“ Ein Blick zum Beispiel in den Kodex der Internationalen Journalisten-Vereinigung IFJ hätte ihn schlauer gemacht. Dort heißt es:
„The journalist shall be aware of the danger of discrimination being furthered by the media, and shall do the utmost to avoid facilitating such discrimination based on, among other things, race, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinions, and national or social origins.“
Es geht nicht nur darum, nicht selbst zu diskriminieren. Es geht um die Gefahr, dass Berichterstattung, selbst vermeintlich wahrheitsgemäße, solche Diskriminierung erleichtern oder verstärken kann.
Das ist der gute Grund, den ethnischen Hintergrund eines Täters oder Tatverdächtigen nicht zu nennen, es sei denn, er ist relevant — oder, wie es in der Richtlinie im deutschen Pressekodex heißt: „Wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht.“ Das ist ein nachvollziehbares Kriterium und kein „starres Formulierungsverbot“, wie Pöttker behauptet. Und natürlich erlaubt es Journalisten, der Frage nachzugehen, welche Rolle der ethnische Hintergrund der Täter bei dem Angriff auf den Linienrichter spielte, ob kulturelle oder religiöse Prägungen eine Rolle spielen, ob und in welcher Form die Tat mit Verarmung, Verwahrlosung, Arbeitslosigkeit, misslungener „Integration“ zusammenhängt.
Pöttker aber tut so, als wäre schon die ethnische Herkunft der Täter eine Erklärung für die Tat.
· · ·
Ein Argument, das Pöttker gegen die Richtlinie im Pressekodex vorbringt, ist bedenkenswert: die Frage, ob sie heute nicht kontraproduktiv wirkt. Pöttker schreibt:
Untersuchungen zeigen, dass Leser es merken, wenn die Nationalität eines Täters gezielt weggelassen wird. Die führt zu einem Vertrauensverlust, der sich von jenen ausschlachten lässt, die tatsächlich diskriminieren. Die rechten Blogs konnten im Falle des zu Tode geprügelten niederländischen Linienrichters hämisch bemerken, dass „die deutsche Qualitätspresse die Herkunft der mohammedanischen Edelmigranten verschweigt“.
Ich kann mir vorstellen, dass eine tendenziell fremdenfeindliche Gesellschaft gerade dadurch, dass die ethnische Herkunft eines Tatverdächtigen normalerweise nicht genannt wird, ihre Vorurteile über den Hang von Ausländern zu Kriminalität und Gewalt bestätigt sieht. Dass das gut gemeinte Diskriminierungsverbot zu einer Paranoia führt, die hinter jeder Meldung über eine Gewalttat Ausländer vermutet — gerade weil das nicht explizit da steht.
Das wäre ein Problem und womöglich ein Grund, den Pressekodex zu überarbeiten. Allerdings führt Pöttkers Verweis auf die rechten Blogs in die Irre. Die Fremdenfeinde dort finden in Berichterstattung genauso Bestätigung für ihren Hass wie in Nichtberichterstattung. Wenn die seriösen Medien die Herkunft von Tätern nennen, nehmen sie das als Beweis für die Ernsthaftigkeit des Problems mit Ausländern. Wenn sie sie nicht nennen, umso mehr.
Am vergangenen Wochenende stellte das führende Hetzblog „Politically Incorrect“ die Meldung auf seine Seite, dass ein Mann in Düsseldorf an einer Straßenbahnhaltestelle fast erschlagen worden wäre. Die Kommentatoren nahmen das so, wie es vermutlich gemeint war: Als Beweis für eine weitere Gewalttat von Ausländern, die nicht als solche benannt werden dürfe, typisch für brutale Übergriffe von Moslems. Als es dann Indizien gab, dass die Täter Deutsche ohne Migrationshintergrund sein könnten, drehten sich die Interpretationen in den Kommentaren dahin, dass das nicht überraschend sei: Ausländer wären viel brutaler vorgegangen.
Der Hass dieser Leute hängt nicht davon ab, ob seriöse Medien den ethnischen Hintergrund der Täter nennen — er hängt, wie man sieht, nicht einmal vom ethnischen Hintergrund der Täter ab. Es wäre falsch und gefährlich, diesen Leuten auch noch soweit entgegenzukommen, dass man wie Pöttker suggeriert, eine Tat lasse sich durch die Herkunft des Täters erklären.