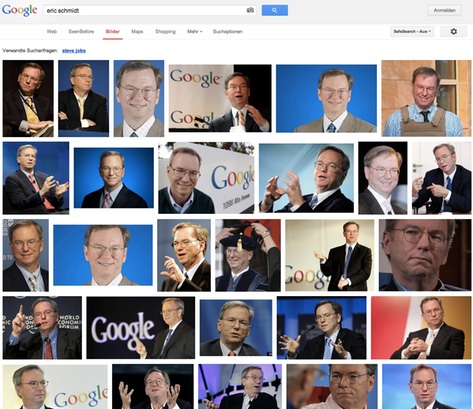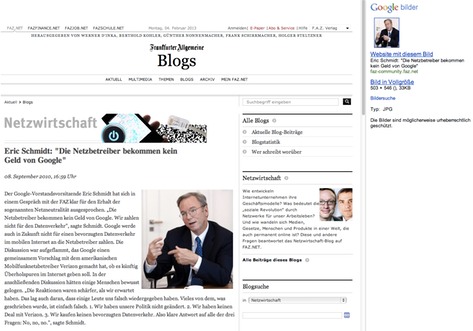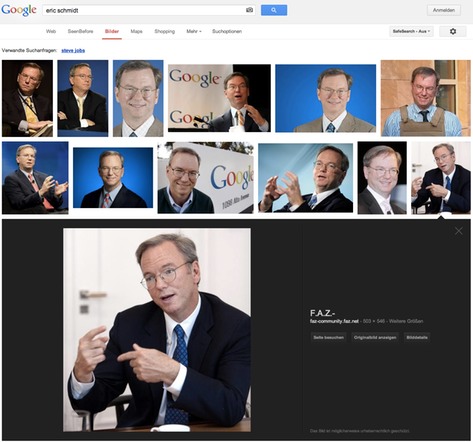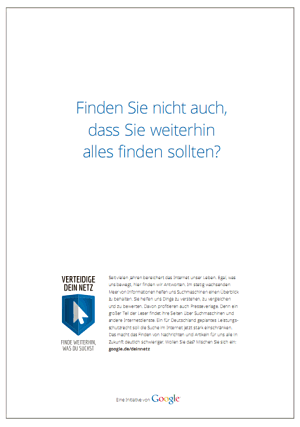Wenn man sich „Leiter Regierungsbeziehungen“ nennt, dann ist so ein getwittertes Foto schon ein schöner Arbeitsbeleg:
Guten Morgen aus San Francisco! @philipproesler war heute morgen schon Laufen an der Golden Gate Bridge. pic.twitter.com/DyVLBStpvg
— Dietrich von Klaeden (@vonKlaeden) May 22, 2013
Absender und rechts im Bild ist Dietrich von Klaeden, der Mann, der bei der Axel Springer AG in der Abteilung Public Affairs dafür zuständig ist, die Kontakte zur Politik zu pflegen. Und das links, seine Trophäe, ist der Bundeswirtschaftsminister und Vize-Kanzler Philipp Rösler (FDP).
Das Foto ist von derselben Dienstreise Röslers, auf der auch die Bilder entstanden, wie der Minister dem „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann um den Hals fiel. Diekmann war zu Studienzwecken ein Dreivierteljahr vor Ort, aber was machte Klaeden in Kalifornien?
Die Antwort ist einfach: Er gehörte zur offiziellen Delegation Röslers.
Das ist erstaunlich. Rösler hatte als Begleitung für die mehrtägige Reise nach San Francisco und Washington „ca. 40 Unternehmensvertreter sogenannter Startup-Unternehmen aus dem Bereich IT und Internet“ gesucht. Die Ausschreibung hatte im Detail formuliert, was unter einem „Startup“ zu verstehen sei — die Axel Springer AG fällt trotz allen Geredes von der angeblich gerade dort herrschenden Gründerzeitstimmung eher nicht darunter. Gefragt waren ausdrücklich Mitreisende von Vorstands-, Geschäftsführer- und Inhaberebene, also niemand aus der dritten Reihe wie Klaeden.
Wie kam der Springer-Mann dann in die Delegation und damit auch in den Genuss eines Sitzes in der Regierungsmaschine? Die Plätze waren eigentlich heiß begehrt. Die Seite deutsche-startups.de berichtete im Vorfeld, die Reise sei „quasi überbucht“ und zitierte Florian Nöll vom Bundesverband Deutsche Startups (BVDS): „Wir gehen aktuell davon aus, dass auf jeden Platz mehr als fünf Bewerber kommen. Das wird eine sehr schwere Entscheidung für das Ministerium.“ Der BVDS organisierte sogar eigens eine eigene Parallelreise, um den Bedarf teilweise zu decken.
Aber für Dietrich von Klaeden, den Regierungsbeauftragten der Axel Springer AG, der als Lobbyist unter anderem viele Male bei der Bundesregierung vorstellig geworden war, um für ein Leistungsschutzrecht für die Verlage zu werben, fand sich ein Platz in der offiziellen Delegation. Warum?
Das Bundeswirtschaftsministerium [BMWi] schreibt mir auf Anfrage:
Der Minister wurde auf seiner Reise von einer Delegation aus deutschen Unternehmen, Pressevertretern, Vertretern des BMWi sowie Abgeordneten, unter anderem auch von Herrn Dietrich von Klaeden, begleitet.
Das ist sicher nur unglücklich formuliert, denn Dietrich von Klaeden ist — anders als sein Bruder Eckart, der Staatsminister im Bundeskanzleramt — kein Abgeordneter. (Außer von Springer, natürlich.) Die Unschärfe ist an dieser Stelle besonders betrüblich, weil meine Frage an das Ministerium ausdrücklich gelautet hatte: „In welcher Funktion war Dietrich von Klaeden von der Axel Springer AG [in der Delegation] mit dabei?“
Immerhin hat mir das Ministerium eine Liste der Unternehmen geschickt, die „zusammen mit dem Minister als Teil der Delegation in die USA gereist sind“. Da stand die Axel Springer AG nicht drauf. Bleibt also noch die Möglichkeit, dass Klaeden als „Pressevertreter“ mitgereist ist, womit aber üblicherweise Berichterstatter gemeint sind und nicht Lobbyisten der Presse. Dass Klaeden sich selbst auf Twitter als „Lawyer and Journalist“ bezeichnet, kann im Ernst nicht mehr sein als eine romantisierte Anspielung auf seine Zeit bei der ARD Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre.
Vielleicht muss man die Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums so verstehen: Rösler nahm in seiner Delegation Unternehmer mit, Pressevertreter, Ministeriumsleute, Abgeordnete — sowie Dietrich von Klaeden in seiner Funktion als Freund des Hauses und Lobbyist der Axel Springer AG, mit der sich der Minister auf Innigste verbunden fühlt.
Mehr von mir über Springers Digital-Inszenierungsstrategie und wie ihr — nicht nur — Jakob Augstein auf den Leim geht, steht in der FAS — und jetzt auch frei auf faz.net.