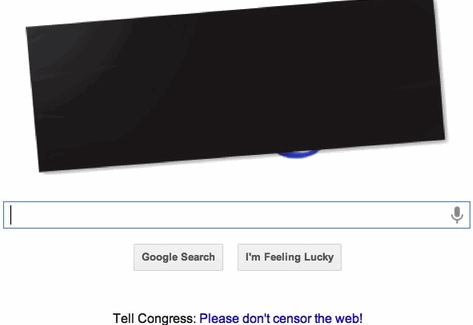Es gibt sie noch, die großen politischen Würfe. Zwei SPD-Politiker haben die Lösung gefunden, wie es die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Deutschland schaffen können, endlich auch jüngere Menschen zu erreichen. In einem Gastbeitrag für die Samstagausgabe der „Süddeutschen Zeitung“ verraten sie ihre Gewinner-Formel:
Das ZDF könnte (…) mit seinem digitalen Kanal ZDF Neo die Zielgruppe der 30- bis 49-Jährigen konsequenter ansprechen. Konsequenter bedeutet, einen Marktanteil von etwa fünf Prozent anzupeilen.
Warum ist darauf nicht eher jemand gekommen? Wieso gibt sich das ZDF bei ZDFneo mit Marktanteilen im Promillebereich zufrieden, wenn es doch fünf Prozent anpeilen könnte! Auch jüngere Zielgruppen wären plötzlich ganz leicht zu erreichen, wenn man nur Marktanteile anpeilt, die hoch genug sind. Und wundern Sie sich nicht, wenn die SPD in Zukunft bei Wahlen richtig abräumt: Die Partei wird einfach konsequent Ergebnisse von etwa 40 Prozent anpeilen.
Man könnte lachen über diesen Text, man kann ihn leicht vergessen oder ignorieren, aber er lässt sich auch als trauriges Symbol dafür lesen, was in Deutschland als Medienpolitik durchgeht. Die Autoren sind Martin Stadelmaier, der Chef der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, und Marc Jan Eumann, der Vorsitzende der SPD-Medienkommission. Beide sind Mitglied im ZDF-Fernsehrat.
Die „Süddeutsche“ hat über den Text geschrieben:
Warum weniger manchmal wirklich mehr ist: Wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk verändern muss
Kein Wunder, dass es sich um zwei Fragen handelt. Antworten enthält das Stück nicht.
Aber schon die Fragen, die sich Stadelmaier und Eumann stellen, sind toll.
1. Wie kann der öffentlich-rechtliche Auftrag im Netz so ausgestaltet werden, dass er Qualität und Überblick im Meer der Informationen bietet und regen Zuspruch findet?
2. Wie kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der auf der Basis solider Informationen über die wesentlichen Zusammenhänge in unserer Gesellschaft informiert und damit zur Demokratiebildung durch freie Meinungsbildung beiträgt, den Generationenabriss stoppen, der sich vor allem bei jungen Menschen vollzieht, die sich von ARD und ZDF abwenden?
3. Wie kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk zeitgemäße, den inhaltlichen und finanziellen Herausforderungen entsprechende Strukturen legen?
Die diversen Sprachunglücke in diesen Sätzen sind kein Zufall, sondern Ausdruck davon, dass hier jemand nicht klar denken kann oder wenigstens nicht klar reden will. Ein ausgestalteter Auftrag soll regen Zuspruch finden? Ein Rundfunk soll auf der Basis von Informationen informieren? Durch Meinungsbildung zur Demokratiebildung beitragen? Herausforderungen entsprechende Strukturen legen?
Auf keine der tatsächlichen Fragen, die man hinter diesen Worthaufen erahnen kann, findet der Text auch nur die Idee einer Antwort.
Stadelmaier und Eumann erwähnen kurz die Klage der Verleger gegen die „Tagesschau“-App und fügen hinzu:
Ein scheinbar geeintes Verlegerlager will im Netz Bezahlinhalte durchsetzen. Das ist, um nicht missverstanden zu werden, legitim. Das Vorgehen knüpft damit an die europaweite, kontroverse Diskussion um den Schutz der Urheberrechte beziehungsweise Leistungsschutzrechte an und hat sich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Angriffsziel ausgesucht. Es ist aber auch eine gravierende Verkennung der Interessenslage, insbesondere der Tages- und Wochenpresse, die auf ihre Art wie ARD und ZDF zu verlässlichen, orientierenden Informationen für unsere Gesellschaft beiträgt.
Ich weiß nicht, was die Urheber- und Leistungsschutzrechte mit dem Thema zu tun haben, aber was weiß man schon von Vorgehen, die sich Ziele aussuchen.
Irgendwie, sagen die SPD-Medienpolitiker dann, sollten die Verlage und die öffentlich-rechtlichen Anstalten gemeinsam „für attraktive Informationsangebote im Internet sorgen“.
Um gerade bei den unter 20-Jährigen die öffentlich-rechtliche Zugkraft im Netz zu steigern, wird es mehr Geld für Kreativität, neuer Angebote und Geschäftsmodelle bedürfen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ausgerechnet Geld ist, das ARD und ZDF fehlt, aber vielleicht meinen Stadelmaier und Eumann ja eine Umverteilung der Ressourcen. Man weiß es nicht, denn sie schreiben nichts darüber. Auch nicht, was für „neue Angebote“ denn gebraucht werden und vor allem, wie man mit neuen „Geschäftsmodellen“ Jugendliche erreicht. Bis gerade dachte ich, dass das Geschäftsmodell der Öffentlich-Rechtlichen ist, Gebühren zu bekommen und dafür ein gutes Programm zu machen.
Für ARD und ZDF wird entscheidend sein, dass sie sich neue Prioritäten setzen und zugleich von Liebgewordenem trennen.
Was sehnte man sich nach einem Beispiel – oder besser zweien: eins für die neu zu setzenden Prioritäten und eins für das abzuschaffende Liebgewordene. Aber es kommt keines, und damit ist die Abhandlung der Frage 1 auch schon beendet, in der es eigentlich um den öffentlich-rechtlichen Auftrag im Netz ging.
Als Antwort auf Frage 2 referieren die SPD-Männer, dass Jugendliche und junge Erwachsene kaum Angebote von ARD und ZDF im Internet und im Fernsehen wahrnähmen, insbesondere keine Nachrichten. Sie fügen hinzu:
Der gebührenfinanzierte Rundfunk hat (…) die (…) gesetzliche Aufgabe, alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen anzusprechen, insbesondere mit seinen Hauptprogrammen. Dieses Ziel ist heute nicht mehr allein mit den Vollprogrammen zu erreichen, allerdings mit Spartenprogrammen im Marktanteilsbereich von weniger als einem Prozent auch nicht.
Aha: Das Ziel, Menschen mit dem Hauptprogramm anzusprechen, lässt sich heute nicht mehr allein mit dem Hauptprogramm erreichen.
Und: Das Ziel, alle Menschen anzusprechen, lässt sich nicht mit Programmen erreichen, die nur wenige Menschen gucken.
Nun folgt der eingangs zitierte Gedanke, dass ZDFneo doch einfach mehr jüngere Leute erreichen sollte, als es tut, und erstaunlicherweise sogar ein konkreter Vorschlag:
Die Länder sollten dazu einen Konstruktionsfehler der Beauftragung beseitigen, nämlich das Verbot, in den Spartenkanälen (zielgruppenadäquate) Nachrichten zu bringen.
Spätestens beim Wort „Beauftragung“ war ich mir dann sicher, dass sich der Text nicht an mich, geschweige denn einen interessierten fachfremden Zuschauer richtet.
Ich bin durchaus dafür, dass das ZDF auf ZDFneo Nachrichten für junge Leute senden darf — es wäre ein interessanter Versuch, einen öffentlich-rechtlichen Gegenentwurf zu den „RTL 2 News“ zu entwickeln. Aber dass das die Quoten des Senders in die Höhe katapultieren würde, halte ich selbst im besten Fall für unwahrscheinlich.
Zunächst sollten ARD und ZDF ihre Infokanäle aufgeben und Phoenix stärken, indem sie diesen Gemeinschaftskanal in seinen Aufgaben als Ereignis- und Informationskanal stärken.
Eine konkrete Idee, und keine schlechte! Leider lautet der nächste Satz:
Es bliebe dann auch mehr Raum für die beiden privaten Spartenangebote n-tv und N 24.
Die Mini-Kanäle ARD extra und ZDF info sind schuld am Rumpel- und Resteprogramm von n-tv und N24? Das ist schwer zu glauben. Vor allem aber könnte Phoenix genau dadurch, dass es vom Ereignis- zum umfassenden Informationskanal aufgewertet würde, erst recht eine relevante Größe erreichen.
Dann gibt es keinen vernünftigen Grund, sich neben den herausragenden Kultursendern Arte und 3sat kannibalisierende öffentlich-rechtliche Kulturkanäle zu leisten.
Das ist nicht ganz falsch und trifft den Kern überhaupt nicht. Auch arte und 3sat sind längst in einem Maße auf relative Massentauglichkeit optimiert, dass sie für die Experimente, die sich ZDF.kultur leistet, gar keinen Raum hätten. Anders gesagt: Das Problem ist nicht ZDF.kultur. Das Problem sind 3sat und arte.
Aber was red ich, Stadelmaier und Eumann sind im nächsten Satz längst ganz woanders:
Sehr wohl sollten ARD und ZDF allerdings an Silvester je ein Konzert von Mozart und Beethoven übertragen können, ohne dass ihnen daraus ein Nachteil entstünde.
Ich weiß nicht, ob das wegen des „je“ auf zwei oder auf vier Konzerte hinausläuft, aber vor allem: Hä?
Im vergangenen Jahr übertrug die ARD live das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker, das ZDF ebenso live aus der Dresdner Staatsoper ein Konzert der Staatskapelle Dresden. Ihnen wurde daraufhin Gebührenverschwendung vorgeworfen — allerdings, weil beide Sendungen zeitgleich liefern. Wenn den Öffentlich-Rechtlichen daraus „ein Nachteil“ entstand, dann wegen ihrer eigenen Beklopptheit bei der Programmierung (vgl. Parallel-Übertragung der englischen Prinzenhochzeit).
Der Bewusstseinsstrom von Stadlmaier und Eumann endet:
Ein so restrukturierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk kann sich mit den Interessen der Tages- und Wochenpresse idealerweise treffen. Beide Seiten könnten sich in der Frage eines anspruchsvollen Journalismus und eines insgesamt anspruchsvollen Medienangebots ergänzen und stärken.
Das „so“ im ersten Satz ist wirklich niedlich. Der Text hat exakt keine Ahnung davon, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk umstrukturiert werden müsste. ARD und ZDF sollen ihre Info- und Kultur-Kanäle schließen und stattdessen junge und noch jüngere Zuschauer erreichen; sie sollen Verwaltungskosten abbauen und vielleicht noch ein paar Orchester schließen. Plattitüden, Phrasen, Lächerlichkeiten.
Die Autoren sind, um es noch einmal zu sagen, die führenden Medienpolitiker der SPD. Martin Stadelmaier ist der vielleicht einflussreichste Strippenzieher auf diesem Gebiet. Und so ein Artikel kommt dabei heraus, wenn er sich mit seinem Kollegen Eumann sagt: Hey, lass uns mal in die „Süddeutsche“ schreiben, wie wir uns die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorstellen?
Man hat danach keine Fragen mehr.