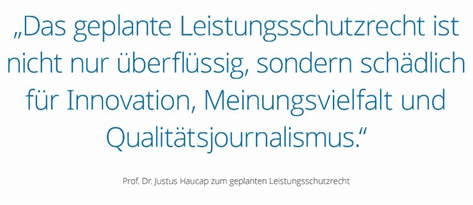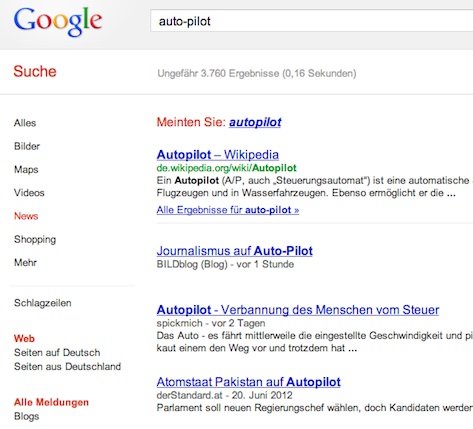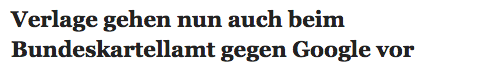Die Verwertungsgesellschaft VG Media hat heute Mittag Bundestagsabgeordnete eingeladen, um sie über das neue Leistungsschutzrecht und die Auseinandersetzung mit Google zu informieren. Wobei es das Wort „informieren“ vielleicht nicht ganz trifft. Die Desinformation beginnt schon auf der Einladung. Dort heißt es:
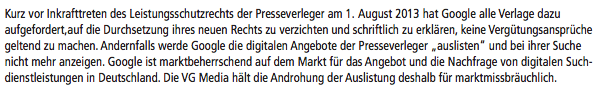
Kurz vor Inkrafttreten des Leistungsschutzrechts der Presseverleger am 1. August 2013 hat Google alle Verlage dazu aufgefordert, auf die Durchsetzung ihres neuen Rechts zu verzichten und schriftlich zu erklären, keine Vergütungsansprüche geltend zu machen. Andernfalls werde Google die digitalen Angebote der Presseverleger „auslisten“ und bei ihrer Suche nicht mehr anzeigen. Google ist marktbeherrschend auf dem Markt für das Angebot und die Nachfrage von digitalen Suchdienstleistungen in Deutschland. Die VG Media hält die Androhung der Auslistung deshalb für marktmissbräuchlich.
Das stimmt nicht. Google hat den Verlegern nicht damit gedroht, ihre Angebote nicht mehr in seinen Suchergebnissen anzuzeigen. Google hat damals nur angekündigt, ohne eine entsprechende Einwilligung der Verleger deren Inhalte nicht mehr bei „Google News“ anzuzeigen.
Das ist ein gravierender Unterschied. „Google News“ ist für das Auffinden von Inhalten von ungleich kleinerer Bedeutung. Und es ist mehr als fraglich, ob Google auf dem Markt der Nachrichtenaggregatoren mit „Google News“ überhaupt marktbeherrschend ist.
Schon in den wenigen Sätzen der Einladung stellt die VG Media den aktuellen Konflikt falsch dar. Es spricht nichts dafür, dass sie die Bundestagsabgeordneten beim Lunch dann korrekt informieren wird.
Ich nehme nicht an, dass die Verwechslung von Google-Suche und „Google News“ ein Versehen ist. Die Darstellung, dass der Suchmaschinenkonzern im vergangenen Jahr die Verlage quasi dazu erpresst habe, ihr Einverständnis zur Anzeige von Ausschnitten ihrer Angebote zu geben, indem er drohte, dass sie sonst nicht mehr in der Google-Suche, ist zwar falsch, aber als Propaganda sehr überzeugend.
Die Falschdarstellung zieht sich durch die gesamte Kommunikation der deutschen Presseverlage, die gerade dafür kämpfen, dass Google und andere Suchmaschinenanbieter und Aggregatoren ihnen für die Anzeige von kurzen Textausschnitten Geld zahlt. Sie findet sich zum Beispiel auch in den Worten von Madsack-Geschäftsführer Thomas Düffert, mit denen der erklärte, warum sein Verlag und elf weitere kartellrechtlich gegen Google vorgehen:
„Madsack hat im vergangenen Jahr von Google eine schriftliche Aufforderung erhalten, auf die Durchsetzung unseres soeben durch den deutschen Gesetzgeber gewährten Presseleistungsschutzrechtes ganz zu verzichten und zu erklären, keine Vergütungsansprüche gegen Google geltend zu machen. Andernfalls würde Google, als deutschland- und weltweit größter Betreiber von Suchmaschinen, unsere digitalen verlegerischen Angebote auslisten. Für uns ist diese Drohung eindeutig ein Marktmissbrauch, denn bei einem Fast-Monopolisten wie Google ausgelistet zu werden und damit nicht mehr sichtbar zu sein, hat weitreichende Folgen.“
Nein. Die schriftliche Aufforderung, die Madsack (und alle anderen) im vergangenen Sommer von Google bekommen hat, bezog sich ausschließlich auf „Google News“. Man konnte das auch schlecht missverstehen. Der Absender war das „Google News Team“. Im Text war zehnmal von „Google News“ die Rede. Die entscheidende Stelle lautete:
Wir sind nach eingehender Prüfung davon überzeugt, dass unser Dienst GoogleNews mit dem Leistungsschutzrecht im Einklang steht. Dennoch möchten wir vor dem Hintergrund der Diskussion sichergehen, dass Sie weiterhin mit der Aufnahme der Inhalte Ihrer Website in Google News einverstanden sind. Wir führen deshalb am 21. Juni für unsere Verlagspartner eine neue Bestätigungserklärung ein. Diese gibt Verlagen und Webpublishern in Deutschland eine zusätzliche Möglichkeit, zu entscheiden, ob ihre Inhalte in Google News angezeigt werden sollen oder nicht. (…)
Wenn Sie bis zum 1. August keine Bestätigungserklärung bei uns hinterlegen, werden Ihre Inhalte ab diesem Datum nicht mehr in Google News angezeigt.
(Hervorhebung von mir.)
Auch zwei spätere Erinnerungsmails ließen keinen Zweifel daran, dass es bei dieser Einwilligungserklärung ausschließlich um „Google News“ ging.
Natürlich stellt auch Christoph Keese, Außenminister bei Axel Springer und der oberste Lobbyist für das Presse-Leistungsschutzrecht in Deutschland, das in einem aktuellen Beitrag zum Thema falsch dar.
Google ist — anders als die in der VG Media organisierten Verlage — der Meinung, dass seine normale Suche nicht vom Leistungsschutzrecht betroffen ist. Deshalb bezog es seine Bestätigungserklärung im vergangenen Sommer ausschließlich auf „Google News“, das längere Ausschnitte aus den Verlagsinhalten anzeigt und es, anders als die normale Google-Suche, ermöglicht, durch die Aggregation von Überschriften und Artikelanläufen einen eigenen kleinen Überblick über das Nachrichtengeschehen zu bekommen. „Die politische Debatte zum Leistungsschutzrecht drehte sich immer um Dienste mit klarem Bezug zu Nachrichten wie eben Google News“, sagt ein Unternehmenssprecher.
Ob diese Interpretation stimmt, darüber kann man streiten und darüber werden Gerichte entscheiden. Tatsache aber ist, dass sich die von Google geforderte Erklärung im Sommer 2013 und die damit verbundene „Androhung einer Auslistung“ ausschließlich auf „Google News“ bezog. Die Darstellung der Verlage ist falsch.
Die VG Media hat auf Fragen von mir dazu bisher nicht geantwortet.
Mit dem aktuellen Vorgehen gegen Google und andere Anbieter sowie der zweifelhaften Lobbyarbeit beim deutschen Bundestag versuchen mehrere Verlage, Geld von Suchmaschinenanbietern und Aggregatoren zu bekommen. Die Strategie im Fall von Google ist betörend paradox: Google soll gleichzeitig verboten und dazu gezwungen werden, Verlagsinhalte in seinen Suchergebnissen anzuzeigen. Das Leistungsschutzrecht, wie Keese und seine Gefolgsleute es interpretieren, untersagt die ungenehmigte Anzeige von kurzen Textausschnitten und Suchergebnissen. Weil Google aber so marktbeherrschend ist, dass jemand, der hier nicht gelistet ist, im Netz fast unsichtbar wird, dürfe es andererseits die Inhalte, die es mangels einer Genehmigung nicht anzeigen darf, nicht einfach nicht anzeigen, weil das einen Missbrauch seiner Macht darstelle. Der Ausweg aus diesem logischen Dilemma (und, so hoffen die Verleger anscheinend, aus ihren existenziellen Nöten): Google darf die Ausschnitte anzeigen, muss aber dafür zahlen.
Noch einmal zum Mitdenken und Staunen: Auf Druck der Verlage hat der Bundestag im vergangenen Jahr ein Leistungsschutzrecht beschlossen, das (unter anderem) Google eine bestimmte Verwendung der Verlagsinhalte ohne Genehmigung untersagt. Wenn Google dann entsprechend sagt: Gebt uns eine Genehmigung oder wird verwenden eure Verlagsinhalte nicht mehr so, ist das für die Verlage nicht die normale Konsequenz aus dem Gesetz, sondern ein erpresserischer Akt. Applaus!
(In der VG Media sind nicht alle großen deutschen Presseverlage organisiert. An der Leistungsschutzrechts-Allianz beteiligen sich zum Beispiel nicht „Spiegel Online“, FAZ.net, stern.de, sueddeutsche.de und Focus Online.)
- Mehr zum Thema:
Till Kreutzer: Eine Farce nähert sich ihrem Höhepunkt