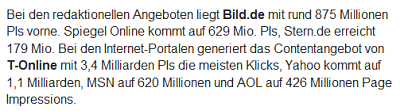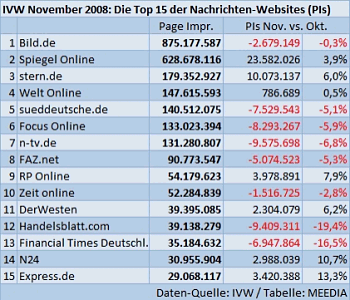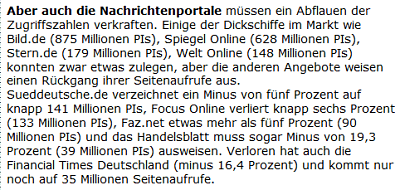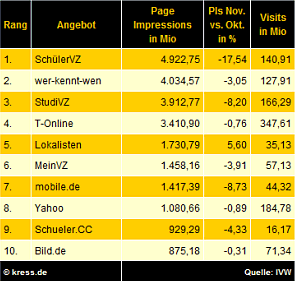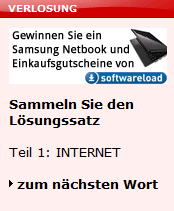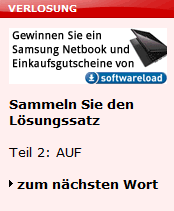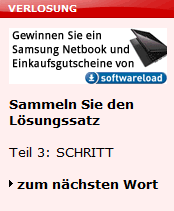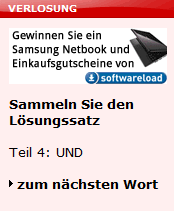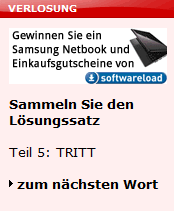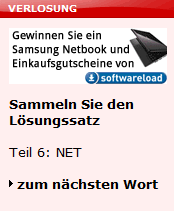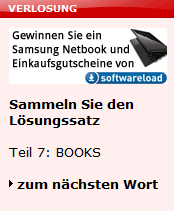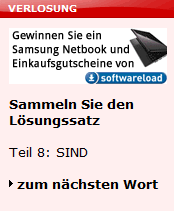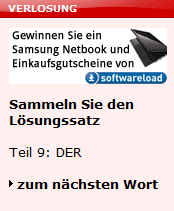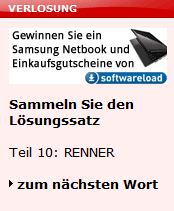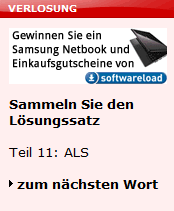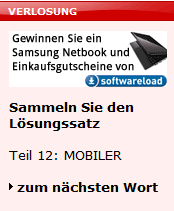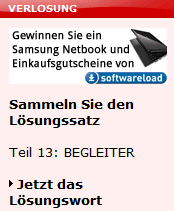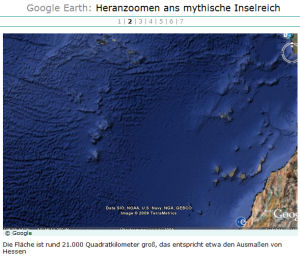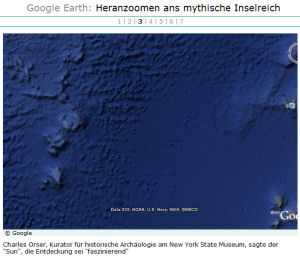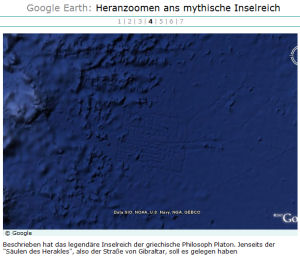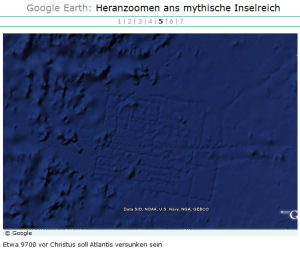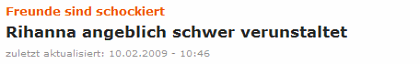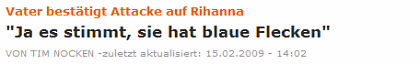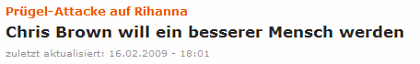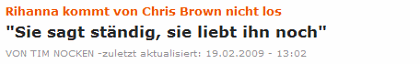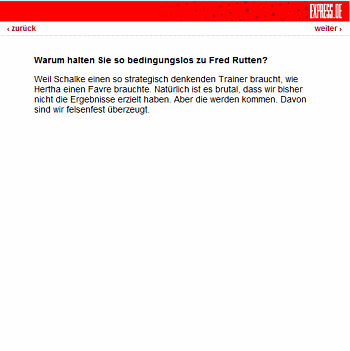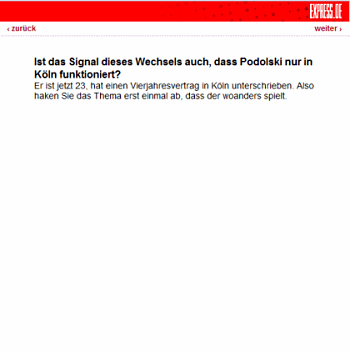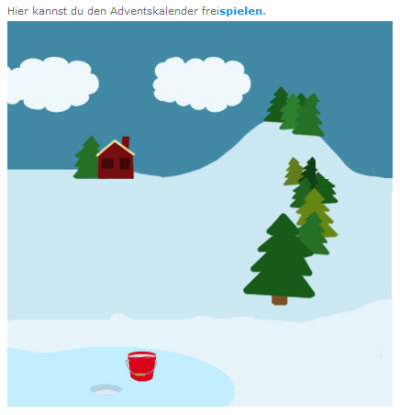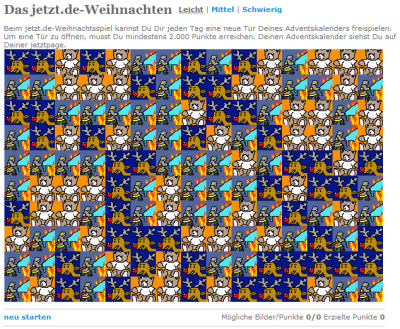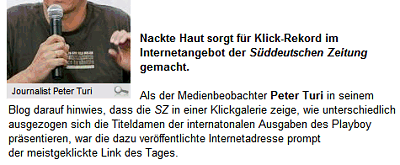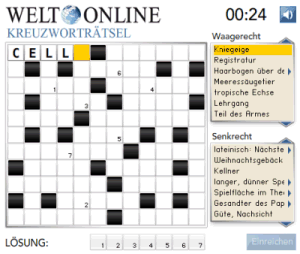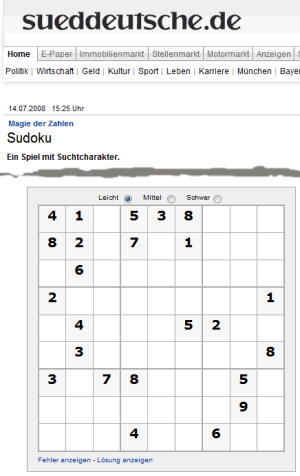Sollen wir die schönsten Zahlen zwischen 1 und 10 000 bringen? Oder hundert Bauchnabel? Wie der Online-Journalismus seine Autorität verspielt.
· · ·
Das erste Opfer des modernen deutschen Online-Journalismus ist die Tabelle. Sicher, das schien mal eine praktische Erfindung der Menschheit zu sein: die Möglichkeit, Informationen in Zeilen und Spalten anzuordnen, so dass man sie auf einen Blick erfassen und gut vergleichen konnte. Aber für die Online-Optimierer von heute ist schon die Formulierung „auf einen Blick“ ein klarer Hinweis, dass da etwas verschenkt wird. Klicks.
Und so sitzen in den Redaktionsräumen der großen Online-Medien jeden Tag Menschen und machen aus Tabellen Bildergalerien, notfalls auch ganz ohne Bilder. Bei „Welt Online“ sind sie besonders fleißig. In einem Artikel über angebliche „Koks-Hochburgen“ haben sie eine Übersicht gebaut, wie sich die Rückstände der Droge in den Flüssen verschiedener Städte in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Obwohl, „Übersicht“ trifft es nicht: Auf jeder Seite steht nur eine Stadt. Die nächste Stadt erscheint nicht darunter, sondern auf der nächsten Seite. Wer versucht, hier die verschiedenen Werte miteinander zu vergleichen, wird nicht glücklich werden — aber die Vermarkter von „Welt Online“ glücklich machen: Mindestens 27 Klicks produziert er, wenn er dumm, gelangweilt oder interessiert genug ist, sich durch die ganzen Zahlen zu klicken.
Und es braucht nicht einmal eine richtige Tabelle für diese Art der Inflation. Eine bloße Liste tut es auch. Aktuell etwa die „Liste der 100 gefährlichsten Internetseiten“. „Welt Online“ hat jede Adresse, ohne jegliche weitere Information, auf eine eigene Seite geschrieben. Hundert Seiten, hundert Klicks. Man kann die „Liste“ deshalb auch nicht ausdrucken, um sie sich, was nützlich wäre, neben den Computer zu legen — es wäre ein hundertseitiges Buch mit viel Raum für Notizen.
Die Informationen sind, wie in Hunderten, wenn nicht Tausenden ähnlichen Fällen auf ähnlichen Seiten, nicht als Service aufgemacht, sondern im Gegenteil: so, dass es möglichst beschwerlich ist, an sie heranzukommen. Entsprechend laut ist das Murren in den Kommentaren unter dem Artikel. Reihenweise beschweren sich Leser, dass die (ohnehin zweifelhaften und von einer „Fachzeitschrift“ namens „Computer-Bild“ abgeschriebenen) Angaben nicht als Tabelle präsentiert wurden. Einer gratuliert zur „schwachsinnigsten Galerie des Jahres“ und regt an, als Nächstes in dieser Form „die 500 schönsten Zahlen bis 10.000“ zu präsentieren.
Die Kritik verhallt ohne Antwort. Entweder weil die Online-Leute längst verinnerlicht haben, dass sie nicht für die Leser arbeiten. Oder weil sie schon diskutieren, ob die „2192“ oder „2193“ schöner ist und man nicht besser gleich die 10 000 schönsten Zahlen bis 10 000 präsentieren sollte.
„Welt Online“ ist damit nicht allein. Aber „Welt Online“ hat Monate rasanten Wachstums hinter sich und gilt im Augenblick mit seinen Besucher- und Klickzahlen als einer der erfolgreichsten Ableger klassischer Medien. Offiziell wird das mit der „Online First“-Strategie erklärt, wonach auch Zeitungsinhalte sofort, noch vor der Belichtung, im Internet veröffentlicht werden. Doch abgesehen davon, dass die „Welt“ diese Strategie keineswegs so konsequent betreibt, wie sie behauptet, ist die Erklärung abwegig. „Welt Online“ besticht nicht durch Qualität, sondern pure Masse.
Zu den Spezialitäten gehört eine 333-teilige Bildergalerie mit wahllos aus Frauenzeitschriften und anderen dubiosen Quellen zusammengetragenen „Fakten über Sex“ sowie die vielfältige, nein: vielfache Möglichkeit, Prominente anhand ihrer Körperteile zu erkennen: „Welt Online“ zeigt erst nur das Ohr, dann den ganzen Promi, und wer sich durch Dutzende Fotos geklickt hat, kann das ganze Spiel in weiteren Bilderquizgalerien mit dem Po, den Augen, dem Busen, den Lippen, den Tätowierungen wiederholen.
Ein zentrales Argument, das immer wieder gegen eine starke Online-Präsenz von ARD und ZDF angeführt wird, besagt, dass es im Internet einen hervorragend funktionierenden publizistischen Wettbewerb gebe, der ganz ohne Öffentlich-Rechtliche genügend Qualität hervorbringe. Richtig ist, dass sich auf den Seiten deutscher Online-Medien viele kluge Kommentare, sorgfältige Recherchen, aufwendige Reportagen finden. Aber der größte Teil von ihnen stammt aus deren gedruckten Ausgaben. Natürlich ist nichts dagegen zu sagen, diese Inhalte auch online zu publizieren, im Gegenteil. Nur werden diese teuren Elemente des Journalismus nicht von den immer noch mageren Online-Erlösen bezahlt, sondern den Anzeigen und Vertriebseinnahmen der traditionellen Medien.
Weite Teile dessen, was uns wie Vielfalt und Qualität im deutschen Online-Journalismus vorkommt, sind eigentlich nur eine Zweitverwertung — und de facto durch die Zeitungen quersubventioniert. Was für online produziert und tatsächlich von den Online-Erlösen bezahlt wird, ist dagegen oft von ernüchternder bis erschütternder Qualität: unredigierte Texte von Nachrichtenagenturen; eine willenlose Aus- und Verwertung all dessen, was die internationalen Boulevardmedien täglich so an Halb-, Falsch- und Nichtmeldungen produzieren; eilig zusammengestrickte Artikel von Menschen, die sich nicht unbedingt auskennen. Zu den beliebten billigen Genres gehört auch die Fernsehkritik — bei „Welt Online“ zum Beispiel werden tagtäglich irgendwelche Sendungen vom Vortag nacherzählt, gelegentlich auf einem sprachlichen Niveau, das viele Schülerzeitungen beschämen würde.
Jenseits von „Spiegel Online“, das immerhin bewiesen hat, dass es möglich ist, ein ordentliches Boulevardmagazin mit großem Erfolg im Internet zu etablieren, gibt es in Deutschland praktisch noch kein funktionierendes Geschäftsmodell für Qualitätsjournalismus im Internet. Und der vermeintliche publizistische Wettbewerb, der hier stattfindet, ist in weiten Teilen nur ein verzweifeltes Wettrennen darum, mit irgendwelchen Mitteln die meisten Menschen auf die Seite zu bekommen und dort wiederum mit irgendwelchen Mitteln die meisten Klicks produzieren zu lassen, die dann als „Page Impressions“ der Werbewirtschaft verkauft werden — und den Fachmedien, die auf dieser Grundlage vermeintlich erfolgreiche und vermeintlich weniger erfolgreiche Online-Angebote unterscheiden.
Guter Journalismus ist leider nicht unbedingt die beste Möglichkeit, dieses Wettrennen kurzfristig für sich zu entscheiden. Das Verhältnis von Aufwand zu Klicks ist wesentlich besser, wenn man auf Bildergalerien, Spiele oder Rätsel setzt. Die bis mindestens nächstes Jahr noch geltenden Regeln der Auflagenkontrolle IVW, die online eine entscheidende Währung darstellt, lässt es zum Beispiel zu, ein Kreuzworträtsel online so zu programmieren, dass jeder eingegebene Buchstabe als ein Seitenabruf gewertet wird. Und die so generierten Klicks müssen nicht einmal unbedingt separat in der Rubrik „Spiele“ ausgewertet werden, sondern können unter bestimmten Bedingungen als redaktionelle Inhalte im Bereich „Entertainment“ gewertet werden.
Noch gravierender als das Ausweichen der Online-Medien auf nicht journalistische Inhalte ist aber, wie der Quotendruck in Verbindung mit mageren Einnahmen die journalistischen Inhalte selbst verändert. Er führt zu Formen, die man als das Gegenteil von Journalismus sehen kann. Eine klassische Aufgabe des Journalisten scheint dabei fast völlig zu verschwinden: die der Auswahl der Nachrichten. Die wäre angesichts der Informationsflut im Internet eigentlich von ganz besonderer Bedeutung. Aber jede zweifelhafte, unwichtige, abseitige Meldung, die ein Online-Medium nicht bringt, bedeutet zunächst einmal: weniger Klicks. Deshalb steht ungefähr bei allen alles. Das Filtern irrelevanter Informationen als journalistische Dienstleistung verschwindet weitgehend.
Besonders dramatisch ist das im Umgang mit Fotos zu beobachten. Während die Redaktionen früher ein besonders geeignetes Bild auswählten, um eine Nachricht zu bebildern, ist die Regel im Internet, zu jeder Meldung einfach all das auszukippen, was die Agenturen irgendwann im weiteren Sinne zu dem Thema geliefert haben. Im kopflosen Versuch, den Lesern alles zu bieten, bietet man ihnen nichts — jedenfalls nicht mehr, als eine Bildersuche bei Google auch ergeben würde. Der Wert eines Fotos ist in den Online-Medien dramatisch gesunken. Weil sich gezeigt hat, dass Artikel mit Fotos häufiger angeklickt werden als Artikel ohne Fotos, gilt oft die Regel, dass jeder Artikel ein Foto haben muss. Und wenn es kein geeignetes gibt, nimmt die Redaktion ein ungeeignetes, irgendein Symbolfoto oder ein Bild, das das Redaktionssystem automatisch auswirft. Was das dem Leser dann tatsächlich bringt, ist nicht einmal zweitrangig.
Ein besonders anschauliches Beispiel, wie die Art des Wettbewerbs im Internet den Journalismus verändert, war die Online-Berichterstattung der „Rheinischen Post“ nach dem Tod des Düsseldorfer Bürgermeisters Joachim Erwin im Mai. Es ist nicht so, dass es den Verantwortlichen an Ehrgeiz gefehlt hätte. Aber es war kein Ehrgeiz, den klügsten Nachruf oder die bewegendste Reportage von seiner Beerdigung zu bringen. Es war der Ehrgeiz, so viel billigen Content aus seinem Tod zu pressen wie möglich. Das hatte nicht nur zur Folge, dass Zitate aus der Trauerfeier in einzelne Sätze zerlegt und teils mehrfach auf Klickgalerien verteilt wurden und dass gefühlt jeder Einwohner der Stadt bei „RP Online“ kondolierte. Es führte auch dazu, dass beinahe jedes Blatt Laub, das über den Friedhof wehte, mit einem eigenen Kurzfilm gewürdigt wurde — gedreht in der Qualität von Tante Erikas Urlaubsfilmen, damals, als sie gerade die neue Videokamera geschenkt bekommen hatte, eine schlechte noch dazu. Die Berichterstattung von „RP Online“ setzte Maßstäbe, was den Verzicht auf Professionalität und journalistische Qualität angeht — aber auch die Masse. Die Zahl der Page Impressions stieg im Mai um über 26 Prozent, und Geschäftsführer Oliver Eckert phantasierte: „Das überdurchschnittliche Wachstum ist Folge unserer Investitionen in die redaktionelle Qualität.“
Zu den Praktiken von „RP Online“ gehört übrigens auch, Agenturmeldungen als Eigenberichte umzudeklarieren — oder aus einer einzigen Agenturmeldung eine „Bilderstrecke“ zu machen, in dem jeder Satz eine neue Seite bekommt und auf der ersten ein Foto steht. Wie lange solche Techniken tatsächlich erfolgversprechend sind, ist schwer zu sagen. Bislang, berichten Online-Verantwortliche, sei von einer Bildergalerienmüdigkeit nichts zu spüren. Und die Frage ist, ob junge Leute, die mit dieser Art von Nicht-Journalismus aufwachsen, je etwas anderes von einem Medium erwarten werden.
Aber der Nutzer selbst steht bei den Strategien der Online-Medien teilweise gar nicht mehr im Mittelpunkt. „Welt Online“ gilt auch deshalb als so erfolgreich, weil die Artikel darauf optimiert wurden, von Google bevorzugt ausgegeben zu werden. Als Hans-Jürgen Jakobs, der Chefredakteur von sueddeutsche.de, darauf vor kurzem hinwies und „eine Konvention über statthafte und unstatthafte Maßnahmen“ dieser Art forderte, legten viele das nur als Gejammer von jemandem aus, der diesen Teil des Geschäftes einfach selbst nicht gut genug beherrscht. Richtig ist aber, dass eine Debatte notwendig ist, wie es den Journalismus verändert, wenn zum Beispiel Überschriften nicht mehr für den Leser, sondern die Suchmaschine optimiert werden.
Es ist eine Zeit des Umbruchs, und wie gefährlich diese Phase ist, kann man an den Horrormeldungen aus den Vereinigten Staaten ablesen: Allein vorletzte Woche wurden dort in der Zeitungsbranche tausend Stellen abgebaut, viele Zeitungen kämpfen ums Überleben. Das zentrale Problem ist, dass die Zuwächse der Verlage im Internet nicht ausreichen, die Verluste im Stammgeschäft auszugleichen. Eine ähnliche Entwicklung droht auch in Deutschland. Und ohne die hochwertigen Inhalte, die durch die gedruckten Zeitungen finanziert werden, könnte die deutsche Online-Medien-Welt schnell sehr trostlos und karg aussehen. Vermutlich sind die Klickmaschinen und Journalismusattrappen, die dort entstehen, auch Verzweiflungstaten, um möglichst schnell eine Größe zu erreichen, die das Überleben in einer ungewissen Zukunft sichert. Vielleicht hat dann die Online-Seite, die am schnellsten und wahllosesten die Agenturmeldungen veröffentlicht und sie mit den großbusigsten Bildergalerien anreichert, gute Überlebenschancen. Und vielleicht erkennen einige Verlage sogar dauerhaft, dass man mit anderen Dingen als Journalismus besser Geld verdient.
Eine Demokratie braucht aber Journalismus. Und bei allen Wirren und Dramen des gegenwärtigen Umbruchs werden langfristig auch diejenigen Medien beste Voraussetzungen für die Zukunft haben, die spürbar davon getrieben sind, ihre Leser über das, was wichtig ist, gut zu informieren. Und die deshalb für ihre Leser nicht beliebig sind, sondern unentbehrlich — egal ob auf Papier oder online.
(c) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung