Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Endloser Regen, twitternde Schäfer und die „passiv-subversivsten Tiere diesseits des Esels“: Wie die Herdwicks den Lake District im Nordwesten von England prägen.
Der Schäfer drückt mir das Lamm in die Hand, damit ich den Unterschied fühlen kann. Es ist mit einem dunklen, dicken, dichten Lockenmantel auf die Welt gekommen. Robust fühlt es sich an. Kein Vergleich zu dem hellen, dünnen, weichen Flaum auf der Haut des Standard-Lämmchens, das er daneben hält.
Das wenige Tage alte Schaf, das ich auf dem Arm habe, ist ein Herdwick, ausgestattet mit dem vielleicht besten Wetterschutz, den die Natur für kleine Lämmer zu bieten hat, gemacht für eine Umgebung, in der es im Zweifel immer gerade regnet.
Herdwick at one hour old… Pic by daughter No 3… She's better than me. pic.twitter.com/KEHKKNuI24
— Herdwick Shepherd (@herdyshepherd1) 14. April 2014
Lake District heißt diese Gegend ganz im Nordwesten von England. Sie könnte auch Rain District heißen. In einem ihrer Täler liegt der regenreichste Ort Englands. Vor einem Pub dort hängt eine Gedenktafel: „In liebender Erinnerung an einen sonnigen Tag in Borrowdale.“ Im Süßigkeitenladen in Keswick bieten sie neben Schokoladenhasen und Schokoladenküken Schokoladenregenschirme an. Und die Verkäuferin im Fish-and-Chips-Geschäft in Windermere erzählt, dass es eigentlich immer regnet, nur manchmal woanders auch, dann verteilt sich das schlechte Wetter etwas mehr, so dass es hier nicht ganz so schlimm ist.
Es hat etwas merkwürdig angemessenes, hier im Nieselregen an den weißgetünchten alten Höfen vorbeizulaufen, Weiden, die zu Sumpflandschaften geworden sind, zu durchqueren, tosende Wasserströme zu kreuzen und über moosbewachsene Steinmauern zu klettern. Es ist kein Ort für Schönwetterwanderer, überall sind auch im Regen Menschen unter zugezurrten Kapuzen unterwegs. Doch dann pustet der Wind plötzlich die Wolken weg und mit einem Mal ist im Sonnenschein alles tiefgesättigte Farbe: das Blau der Seen, das Grün der Wiesen, erstaunliches Rot, Braun, Gelb, Ocker auf den baumlosen Berghängen.

Ein Traum, der das Schroffe schottischer Gebirge mit der Lieblichkeit südenglischer Hügellandschaften aufs Romantischste kombiniert.
Es ist eine Landschaft, die von den Schafen geprägt wurde, und es sind Schafe, die von der Landschaft geprägt wurden. Seit Jahrhunderten grasen Herdwicks hier auf den Bergkuppen, harren in Wind und Regen aus. Sie sind unabhängig und hart im Nehmen, und auch wenn die Theorie, dass die Wikinger sie vor tausend Jahren in diese Gegend gebracht haben, unbewiesen ist, will man das sofort glauben: Dass es legendär furchtlose Krieger waren, die solch toughen Haustiere mitbrachten. Es gibt Geschichten von Herdwicks, die wochenlang unter Schnee überlebten. Als man sie fand, sollen sie blind gewesen sein und ihre eigene Wolle gefressen haben – aber sie erholten sich.
Sie sind, andererseits, sehr niedlich, und es ist kein Wunder, dass sich die Kinderbuchautorin Beatrix Potter in sie verliebte. Sie wirken wie Schafe in Reinform, reduziert auf das Wesentliche und als wären sie von oder für Kinderbuchillustratoren entwickelt worden: Zwei Knopfaugen im glatten, hellen Gesicht; Mund und Nase wie genäht; eine großer, rechteckiger Flauschkörper in vielfältig grauen Marmorfarben auf stämmigen Beinstummeln. Kopf und Beine sollen im Idealfall die Farbe von Raureif haben.
Sie sehen so sympathisch und perfekt schafhaft aus, wenn sie ihre weißen Köpfe aus dem Gras nehmen und für einen Moment aufhören zu kauen: Stoisch schauen sie einen an, nicht unfreundlich, aber nur mit gerade so viel Interesse, wie unbedingt nötig ist, um abzuschätzen, ob es ratsam sein könnte, ein paar Meter weiterzuschlurfen, um ungestört weiter an der dünnen Grasnarbe knabbern zu können. Ihre Gesichter leuchten hell in der Landschaft, was es zu einem besonderen Erlebnis macht, wenn der Wanderweg durch eine Wiese führt und man plötzlich Dutzende Herdwick-Köpfe auf einen gerichtet sieht.

Sie waren eigentlich aus der Mode gekommen, keine Rasse für einen modernen Schäfer, und auch der Mann, der heute als „Herdwick Shepherd“ über sie twittert, hätte sich vor gut zehn Jahren noch nicht vorstellen können, ausgerechnet Herdwicks zu züchten. Aber dann kam die Maul- und Klauenseuche, die im Lake District besonders verheerend war. Und Schäfer-Familien wie seine stellten sich nach dieser Apokalypse die Frage, unter welchen Bedingungen es sich überhaupt lohnen könnte, noch Schafe zu halten.
Die Herdwicks boten eine Antwort, weil sie so verhältnismäßig wenig menschliche Aufmerksamkeit und Unterstützung brauchen. Aber wenn der Herdy Shepherd – der nicht möchte, dass man seinen richtigen Namen nennt – heute von seinen Herdwicks erzählt, tut er das mit einer Leidenschaft für genau diese Tiere, die nichts mit wirtschaftlicher Notwendigkeit zu tun hat.
Er bekommt ein Leuchten in den Augen, wenn man ihn anspricht auf das eine Schaf unten im Feld vor seinem Hof, das schon zwei Lämmer bei sich hat. Es ist eins von denen, die er seine „Schönheitsköniginnen“ nennt. Sie hat schon Routine im jährlichen Lauf der Dinge hier und weiß, dass um die Ecke eine Wiese ist, die in den vergangenen Wochen schaffrei gehalten wurde, damit sie und die anderen Mütter dort reichlich Gras finden würden.
In ein paar Wochen wird sie dann über uralte Wege mit den anderen dorthin gehen, wo sie eigentlich zuhause sind. Der Schäfer zeigt in die Ferne auf eine der Bergkuppen, die hier „fell“ heißen und auf denen man Mitte April noch größere Schneeflecken sieht. Die ersten Tiere, die ohne Nachwuchs, sind jetzt schon da, es folgen dann Mütter mit nur einem Lamm und schließlich die Familien mit Zwillingen.

Dort oben auf den Bergen ist traditionell offenes Gemeinschaftsland, Commons, Allmende – die größte Fläche in Europa. Die Herdwicks können sich weit ausbreiten, was sie weniger anfällig für Krankheiten macht. Und sie wissen, wo sie hingehören. Sie haben einen Flecken Erde, an den sie sich gebunden fühlen; die Muttertiere geben das Wissen an ihren Nachwuchs weiter.
Traditionell gehören die Schafe hier deshalb zu den Höfen: Wenn dessen Mieter wechselt, übernimmt er die Tiere. Herdwicks sind die Brieftauben unter den Schafen: Sie haben einen besonders ausgeprägten Heimfindeinstinkt – und einen Drang, zu „ihrem“ Berg zurückzukehren. Zu den Geschichten des Lake Districts gehören die von kleinen Schaftrupps, die beim Durchqueren von Ortschaften angetroffen werden, nachdem sie sich eigenmächtig auf dem Weg dahin zurück gemacht haben, wo sie ihrer Meinung nach hingehören. Manche sollen ein halbes Jahr, nachdem sie verkauft wurden, auf ihrem Ursprungs-Hang wieder aufgetaucht sein, Dutzende Kilometer entfernt.

Philip Walling, der in dem Buch „Counting Sheep“ die Hirten-Kultur Großbritanniens würdigt, nennt die Herdwicks „die passiv-subversivsten halb-domestizierten Tiere diesseits des Esels“: „Wenn sie in einem Feld glücklich sind, bleiben sie da, aber immer nur aus freien Stücken. Ihr Ur-Drang nach Freiheit ist nie weit unter der Oberfläche. Wie Kriegsgefangene lauern sie auf die kleinste Gelegenheit zum Ausbruch und behalten beim Grasen das Gatter im Auge, für den Fall, dass es jemand offen lässt.“
In diesen Tagen sind sie aber überwiegend damit beschäftigt, Lämmer zur Welt zu bringen. 500 Tiere hat der Herdy Shepherd; für Problemfälle hat er eine kleine Entbindungsstation in seinem Stall eingerichtet. Die besten Lämmer sind pechschwarz, mit etwas weißem Flaum an den Ohrenspitzen sowie im Nacken, als erste Andeutung dessen, was später einmal eine eindrucksvolle Mähne sein soll.

Stolz zeigt der Herdy Shepherd Fotos von seinen preisgekrönten Böcken und erzählt, wie wichtig es ihm ist, den Respekt der alten Schäfer zu erwerben, deren Tradition er fortzuführen versucht. Solche Vorzeige-Zuchttiere lassen sich auch deutlich teurer verkaufen, was hilft, das mühsame Geschäft ein bisschen wirtschaftlicher zu machen.
Seit kurzem wird viel daran gearbeitet, die Wertschätzung für die Herdwicks und die mit ihnen verbundene landwirtschaftliche Kultur zu steigern. Es gibt Herdy-Tassen, Schlüsselanhänger und Eierbecher. Prinz Charles hat vor zwei Wochen die erste Versteigerung von Herdwick-Schafen mit einem eigenen Qualitäts-Markenzeichen besucht.
Twitter hilft vielleicht auch. Über 25.000 Menschen folgen @herdyshepherd1 auf Twitter. Er teilt mit ihnen Fotos von Lämmern, erzählt Geschichten von schweren Geburten und Schäferhund-Lehrlingen und beantwortet Fragen wie: „Habt ihr ein Problem mit Wölfen?“ („Nicht seit 1750, seit jemand den letzten in Großbritannien erschossen hat.“)
Medien auf der ganzen Welt haben über ihn berichtet. In einem Gastbeitrag für den „Atlantic“ schrieb er: „Twittern ist so etwas wie ein Akt des Widerstandes und des Trotzes, eine Möglichkeit, der manchmal desinteressierten Welt entgegenzurufen, dass man dickköpfig ist und stolz und nicht nachgibt, während überall sonst in eine Kopie von überall sonst verwandelt wird.“ Die Leute aus der Landwirtschaft seien traditionell schlecht darin, der Öffentlichkeit ihre Sicht der Dinge zu vermitteln, erzählt er, was sich oft räche.
Back to their heaf pic.twitter.com/yLR0R7lJM7
— Herdwick Shepherd (@herdyshepherd1) 15. April 2014
Vergangene Woche postete er Bilder von der ersten Runde Herdwicks, die in diesem Jahr zurück auf ihre angestammten Berge geführt wurden. Und dann ein Foto von Floss, der Schäferhündin, nach der Arbeit auf dem Quad-Bike, mit weitem Blick über die Hügel. „Floss mag die Landschaft“, twitterte er. „Oder vielleicht sieht sie in der Ferne irgendwelche entkommenden Schafe, die ich nicht sehe.“
Floss likes the scenery… Or maybe sees sheep escaping in distance that I can't. pic.twitter.com/E0tdx3V6V0
— Herdwick Shepherd (@herdyshepherd1) 15. April 2014
Nicht jedem wird bei diesem Anblick warm ums Herz. Der Umweltschützer und „Guardian“-Kolumnist George Monbiot findet die Landschaft „eine der deprimierendsten in Europa“ und nennt sie „sheepwrecked“ – zerstört von der „weißen Plage“ der Schafe, die die Berge nackt halten, „jede essbare Pflanze, die ihren Kopf hebt, abmähen, und Tiere ihres Lebensraumes berauben“.
Monbiot kämpft dafür, die Landschaft zu „renaturieren“ und sie in einen Zustand zu versetzen, in dem sie seit Jahrhunderten nicht war. Vermutlich muss man es vor dem Hintergrund solcher Kritiker lesen, wenn der Herdy Shepherd zwischendurch vier Tweets lang aufzählt, welcher Artenvielfalt von Tieren er bei der Arbeit begegnet ist.
Die britische Regierung hat beschlossen, den Lake District 2016 für die Unesco-Welterbe-Liste vorzuschlagen – als herausragende Kulturlandschaft. Das soll natürlich dem Tourismus dienen. Aber es wäre auch eine besondere Anerkennung für die besonderen kulturellen und landwirtschaftlichen Traditionen, die diese Landschaft geformt haben. Also auch und vor allem: für die Herdwicks.
Man sagt über sie, sie lebten „von frischer Luft, sauberem Wasser und guter Aussicht“. Aber ein bisschen Liebe kann vermutlich nicht schaden.









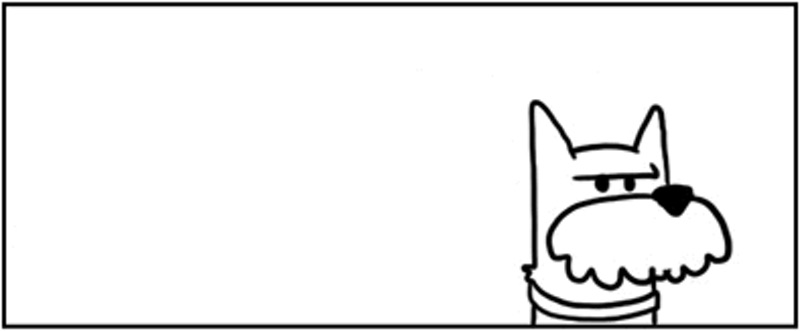







 Diese Antwort könnte nun Leute überraschen, die die Titelseite des „Stern“ gesehen haben und das dortige Versprechen: „SYLVIE VAN DER VAART – So offen hat sie noch nie gesprochen“. Tatsächlich sollte man als Leser immer stutzig werden, wenn Journalisten nicht mit etwas werben, was jemand gesagt hat, sondern bloß damit, dass jemand etwas gesagt hat. (Andererseits ist es natürlich passend, weil die ganze Berichterstattung über die Van-der-Vaart-Sache im Wesentlichen aus „Bild“-Schlagzeilen wie „Jetzt spricht die Mutter!“ zu bestehen schien.)
Diese Antwort könnte nun Leute überraschen, die die Titelseite des „Stern“ gesehen haben und das dortige Versprechen: „SYLVIE VAN DER VAART – So offen hat sie noch nie gesprochen“. Tatsächlich sollte man als Leser immer stutzig werden, wenn Journalisten nicht mit etwas werben, was jemand gesagt hat, sondern bloß damit, dass jemand etwas gesagt hat. (Andererseits ist es natürlich passend, weil die ganze Berichterstattung über die Van-der-Vaart-Sache im Wesentlichen aus „Bild“-Schlagzeilen wie „Jetzt spricht die Mutter!“ zu bestehen schien.) Diese beiden letzten Sätze, ihres Kontextes entkleidet, fand der „Stern“ dann spektakulär genug, um damit die ganze Geschichte zu überschreiben.
Diese beiden letzten Sätze, ihres Kontextes entkleidet, fand der „Stern“ dann spektakulär genug, um damit die ganze Geschichte zu überschreiben.