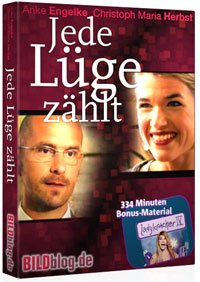Alle Fotos: NDR
Die ARD hat komische Ideen. Sie veranstaltet heute Abend einen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest und hat viele Zutaten, die einen unterhaltungswilligen und nicht zwingend auf guter Musik bestehenden Zuschauer gefallen können: eine strenge blonde Frau in Glitzersteinbluse, die sich in eine lebende Diskokugel verwandelt; drei Priester, die gemeinsam mit einer klassischen Sängerin einen Vorgeschmack auf die Knödelvorhölle geben; barfüßige Bayernbuam in Lederhose, die den Saal wegblasen.
Aber bis dieses Spektakel anfängt, lässt sie erst einmal Loreen auftreten mit ihrem letztjährigen Siegertitel „Euphoria“ – okay, kann man machen, ist auch ganz hilfreich, um dann den späteren plumpen Versuch von Cascada, unter dem Namen „Glorious“ den erfolgreichen Song einfach nochmal in plattgestampfter Form in den Wettbewerb zu schmuggeln, besser würdigen zu können.
Dann folgt ein Auftritt von Lena Meyer-Landrut, die den Wettbewerb, um den es hier geht, offenbar mal gewonnen hat. Sie singt einfach noch einmal ihren inzwischen drei Jahre alten Hit „Satellite“, was man ja nicht oft genug machen… naja, obwohl.
Und dann kommt, um auch die letzten Zuschauer dazu zu bringen, mal zur Fernbedienung zu greifen und nachzuschauen, was auf den anderen Kanälen läuft, noch eine längere Erklärung, was das eigentlich ist, dieser „Eurovision Song Contest“, was Udo Jürgens damit zu tun hat, wie dieser Song „Satellite“ nochmal klingt, wo Malmö liegt und wie die Halle aussieht, in der der Wettbewerb in drei Monaten stattfinden wird.
Aber dann, schätzungsweise um kurz nach halb neun, gefühlt eher gegen 22:40 Uhr, geht es los, und was folgt, ist eine abwechslungsreiche Show, bunt und bekloppt, aber auch erstaunlich erwachsen, musikalisch zeitgemäß und mit vielen Kandidaten, für die man sich als deutsche Vertreter beim Eurovision Song Contest nicht schämen müsste.
Einen Hype oder eine heftige Aufmerksamkeitswelle des Boulevards gibt es in diesem Jahr nicht, aber das spricht paradoxerweise gar nicht gegen die Veranstaltung. Es ist eher Folge davon, dass die ARD darauf verzichtet hat, sich von der Musikindustrie einen Rudolf Moshammer oder Zlatko Trpkovski in die Show schicken zu lassen, sondern eher tatsächlich interessante Nachwuchstalente. Die Frage ist natürlich, wieviele Leute eine Show einschalten, die sich so vergleichsweise unauffällig ankündigt.
Für die meisten Künstler ist es eine sehr ernst gemeinte Chance, sich einmal zur Prime-Time einem größeren Publikum mit ihrer Musik bekannt machen zu können. Aus den Vorstellungsfilmen vor ihren Auftritten kann man manchmal die Verspanntheit erahnen, die aus dem Bemühen entsteht, diese Chance bloß zu nutzen.
Die österreichische Soul-Sängerin Saint Lu schafft es, sich in den eineinhalb Minuten um sämtliche noch nicht gehabten Sympathien zu reden, was aber nicht sehr schadet, weil ihr affektierter Auftritt mit überaus durchdringendem Gesang kurz darauf zumindest bei mir einen ähnlichen Effekt hatte.
Die Söhne Mannheims haben einen Film gedreht, der so breitwandig und breitbeinig daher kommt, dass mein Ironiedetektor im Gehirn die ganze Zeit aufgeregt flackerte, bis zuletzt aber zu keinem eindeutigen Ergebnis kam, was zu einem leicht hysterischen Kichern führte.

Der Elektropopper Ben Ivory immerhin lässt in seinem Selbstportrait keine Frage, dass er Formulierungen wie „Selbst ein einziges Lied kann Mauern einreißen“ bierernst meint. Offenbar ist auch die Botschaft seines Songs „We are the righteous ones“ exakt so gemeint: Wir sind die Rechtschaffenen. Puh. Aber tolle Lasershow dann.
Die leicht folkpoppige Nummer „Little Sister“ von Mobilée war im Vorfeld einer meiner Favoriten, aber es spricht wenig dafür, dass die Sängerin ausgerechnet in der Finalsendung dann mal die passende Tonart findet und in ihr bleibt.

Mein persönlicher Favorit ist, auch zu meiner eigenen Überraschung, „Heart on the Line“ von Blitzkids mvt. geworden, eine Großraumdiskonummer, die in der Halle mit entsprechendem Wumms fantastisch kommt, sich aber vermutlich über den Fernseher nur überträgt, wenn man die Lautstärke voll aufdreht. Die Künstlerattitüde der Gruppe ist vielleicht ein bisschen angestrengt, aber ihr Auftritt ist großes Kino.

Betty Dittrich singt einen Sechziger-Jahre-Schlager, der so eingängig ist, dass man ihn schon nach drei Sekunden mitsingen kann und dafür drei Tage nicht mehr aus den Ohren bekommt. Ihr „Lalala“ ist von größter Banalität, aber diese Schlichtheit kommt mit soviel Charme und guter Laune daher, dass ich mir vorstellen kann, dass das ganz vorne landet.

Cascada und die Söhne Mannheims müssen wohl schon aufgrund ihrer großen Zahl von Fans — leider — als Mitfavoriten gelten. Und dann sind da noch LaBrassBanda, nach deren Auftritt in der Generalprobe Grand-Prix-Superexperte Lukas Heinser sowie Imre Grimm, der Lena-Sonderbeauftragte der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“, spontan einen Sieg vorhersagten. (Ich hab dagegen gehalten, was beide lachend als Bestätigung nahmen, richtig zu liegen.)

Jedenfalls, LaBrassBanda. Das wäre wunderbar, diese Musik-Verrückten ins internationale Finale zu schicken, ich wäre prinzipiell dafür, und die Arena in Hannover wird ganz sicher brennen nach ihrem Auftritt. Ich werde nur leider mit ihrem nervigen Song überhaupt nicht warm.
Mia Diekow singt ein Lieblingslied, das von Frank Ramon geschrieben worden sein könnte (und ich meine das nicht im Positiven). Sie trägt es in einer Choreographie vor, die von Ralph Siegel stammen könnte. Das will man auch nicht.
Und „Change“ von Finn Martin könnte ein ganz okayer Popsong sein, würde er nicht von diesem Grinsepeter vorgetragen, dessen Haare allein mir eine faire Bewertung schon unmöglich machen.
Über Nica & Joe möchte ich bitte nicht reden, weil ich mich dazu wieder an den Auftritt erinnern müsste, und bei den Priestern & Mojca Erdmann ist meine größte Sorge, dass es irgendwelche Rammstein- oder gar Unheilig-Fans in größerer Zahl geben könnte, die dafür stimmen.
Ich habe keine Ahnung, wer gewinnt, lege mich aber jetzt einfach mal fest:
1. Betty Dittrich
2. Cascada
3. Söhne Mannheims
4. LaBrassBanda
5. Finn Martin
6. Blitzkids mvt.
7. Mobilée
8. Saint Lu
9. Die Priester & Mojca Erdmann
10. Mia Diekow
11. Nica & Joe
12. Ben Ivory
Der eigentliche Gewinner des Abends wird aber mal wieder Anke Engelke sein. Der größte Teil der medialen Aufmerksamkeit im Vorfeld galt ihr, der Moderatorin, und die Show wird zeigen: völlig zurecht. Sie hat sich mit einer solchen Lust, Leidenschaft und Leichtigkeit durch die Generalprobe moderiert, dass sie sich hinterher hoffentlich vor Show-Angeboten nicht retten kann, die sie nicht ablehnen kann.
Also, wenn ich nicht in der Halle säße: Ich würd’s einschalten. Und das wirklich nicht nur aus Gründen der Konträrfaszination.
- Unser Song für Malmö, gleich, 20.15 Uhr, ARD.
(Ich werde versuchen, aus der Halle zu twittern: @niggi)