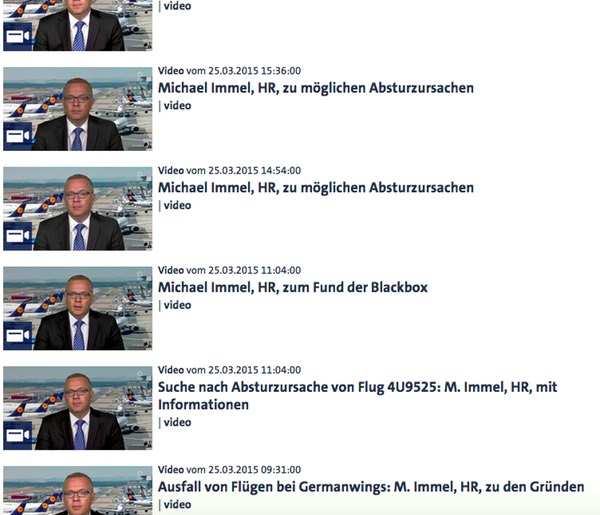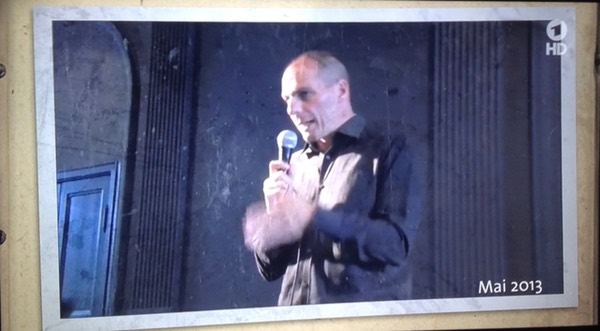Alle paar Jahre sorgt der Programmbeirat der ARD für Aufsehen, wenn kritische Anmerkungen von ihm an Sendungen des Ersten bekannt werden. Eigentlich tagt er im Verborgenen und will das auch so. Einblicke in die Arbeit eines Gremiums, das im Dienst der Allgemeinheit stehen soll, die Öffentlichkeit aber nicht als Verbündeten sieht.
Als der Programmbeirat der ARD am 17. Juni in Berlin zu seiner 582. Sitzung zusammentrat, stand nicht nur die Berichterstattung über die Ukraine auf der Tagesordnung. Das Gremium sorgte sich unter anderem auch um „Sherlock“, die BBC-Serie, deren dritte Staffel das Erste gerade gezeigt hatte.
Die hatte nämlich in der ARD zwar den bislang höchsten Marktanteil aller Staffeln bei den jüngeren Zuschauern erreicht, aber den niedrigsten bei den älteren, wie der stellvertretende Programmdirektor Thomas Baumann berichtete.
Das Sitzungs-Protokoll notiert dazu:
„‚Sherlock‘, wird aus dem Programmbeirat erklärt, werde zunehmend komplex in der Darstellung, die Handlung in der dritten Staffel gleite manchmal ins Abstruse, und man könne gut nachvollziehen, dass dies nicht jedermanns Geschmack sei. Dennoch sei es sehr gut, dass solche modernen, innovativen Formate ins Programm genommen würden. Würde aus der Tatsache, dass ‚Sherlock‘ beim älteren Publikum weniger gut ankomme, auch Konsequenzen gezogen?
Herr Baumann erläutert, dass Das Erste bei dieser BBC-Serie allenfalls ein kleines Wörtchen mitreden könne, aber im Wesentlichen keinen Einfluss auf die Gestaltung der Serie habe.“
Und so werden vermutlich auch zukünftige Folgen von „Sherlock“ ohne Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten des älteren deutschen Publikums produziert werden.
Der Programmbeirat war bis vor wenigen Wochen vermutlich das unbekannteste aller ARD-Gremien. Dann wurde öffentlich, dass die eigentlich im Verborgenen arbeitende Runde die Berichterstattung im Ersten über die Ukraine-Krise teilweise sehr kritisch beurteilt hatte – und die Aufregung war groß.
Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Im Frühjahr 2008 sorgte das vernichtende Urteil des Gremiums über die damals neue Talkshow von Anne Will für Unruhe. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte ausführlich aus dem internen Papier zitiert.
Zwei Jahre später machte die „taz“ öffentlich, wie deutlich der Programmbeirat sich intern dafür ausgesprochen hatte, die Zahl der Polit-Talkshows zu reduzieren. Der öffentlichen Debatte darüber gab das erheblichen Zunder.
Was ist das für ein merkwürdiges Gremium, das sich eigentlich im Auftrag der Zuschauer kontinuierlich mit dem Programm des Ersten beschäftigt – und dabei fast ganz im Verborgenen agiert, wenn nicht seine interne Kritik gerade wieder von interessierter Seite lanciert wird und entsprechendes Aufsehen erregt?
 

Der ARD-Programmbeirat, oben, von links: Paul Siebertz, Geesken Wörmann, Judith von Witzleben-Sadowsky, Walter Spieß, Markus Weber; unten: Marliese Klees, Susan Ella-Mittrenga, Monsignore Stephan Wahl, Stefan Gebhardt. Foto: BR / Theresa Högner
Sie treffen sich zehnmal jährlich für ein bis zwei Tage, reihum immer bei einer anderen ARD-Anstalt. Der Rundfunkrat jedes Senders schickt einen Vertreter in den Programmbeirat, neun sind es insgesamt. Sie verteilen vorher Beobachtungslisten, welche Sendungen geguckt werden müssen und wer über was referiert, und schauen überhaupt aufmerksam Das Erste. Während die Rundfunkräte der einzelnen Anstalten nur für das jeweilige Programm ihrer Sender zuständig sind, nehmen sie das Gemeinschaftsprogramm in den Blick – haben aber nur beratende Funktion und keinerlei Sanktionsmöglichkeiten.
ARD-Programmdirektor Volker Herres oder sein Vertreter ist bei den Sitzungen immer dabei. Alle drei Monate trifft sich der Programmbeirat mit der Fernsehprogrammkonferenz, in der die Chefs der einzelnen Rundfunkanstalten das Gemeinschaftsprogramm zusammenstellen. Der Vorsitzende des Programmbeirates nimmt auch an den Sitzungen der Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD und den Hauptversammlungen der ARD teil.
„Der Programmbeirat hat eine hohe Anerkennung und Akzeptanz bei allen Programmverantwortlichen und in den Gremien“, sagt Paul Siebertz, ein österreichischer Jurist, der dem Gremium seit vergangenem Jahr vorsteht. Man würde das nicht unbedingt annehmen, wenn man den gereizten Widerspruch hört, den es gibt, sobald wieder einmal Kritik des Programmbeirates öffentlich geworden ist. Oder wenn man die genervten Gesichter der anderen Teilnehmer einer Diskussion über die Ukraine-Berichterstattung bei der Verleihung des Hanns- Joachim-Friedrichs-Preises las, in der Siebertz als Außenseiter und Fremdkörper saß. ZDF-Chefredakteur Peter Frey schien sehr froh, dass sein Sender kein solch lästiges Gremium hat.
Aber diese Diskussionen im grellen Licht der Öffentlichkeit mag der Programmbeirat ohnehin nicht. „Wir sind wenig erfreut, dass Protokolle von uns in die Öffentlichkeit kommen“, sagt Siebertz. „Vertraulichkeit ist die Grundlage für konstruktive Diskussionen mit Verantwortlichen. Eine öffentliche Diskussion ist für den ARD-Programmbeirat nicht nützlich. Die Öffentlichkeit kann zu einer Polarisierung beitragen, die nicht erwünscht ist.“
Das hat Tradition in diesem Gremium. Danny Brees, der von 1998 bis 2003 Vorsitzender des Programmbeirats war, sagte 2000 dem Bonner „General-Anzeiger“: „Wir gehen ganz bewusst mit unserer Kritik und unseren Anregungen nicht an die Öffentlichkeit. Denn wenn wir wirklich etwas bewirken wollen, ist das interne Gespräch am fruchtbarsten.“
Das ist nicht von der Hand zu weisen: In dem Moment, da Kritik aus dem Programmbeirat öffentlich wird, nehmen die Verantwortlichen reflexartig eine Abwehrposition ein – das zeigen die regelmäßigen heftigen Reaktionen. Andererseits ist das natürlich auch Folge davon, dass die Anmerkungen des Programmbeirates zum Programm nicht kontinuierlich und entsprechend vielfältig an die Öffentlichkeit gelangen, sondern fast immer nur in Form von gezielt lancierten Bruchstücken, die entsprechend Aufsehen erregen sollen.
Ist es nicht merkwürdig, dass ein Gremium, das letztlich im Auftrag der Gesellschaft einen öffentlich-rechtlichen Sender beraten und kritisch begleiten soll, fast völlig im Verborgenen tagt? Von der theoretisch in der Geschäftsordnung vorgesehenen Möglichkeit, öffentliche Stellungnahmen abzugeben, macht das Gremium fast nie Gebrauch.
Fragt man Siebertz, ob er nicht das Gefühl hat, der Öffentlichkeit, dem Publikum, verpflichtet zu sein, widerspricht er: Er sei nicht als Vertreter des Publikums im ARD-Programmbeirat, sondern des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks. Er und seine Kollegen berichten an die Rundfunkräte, die sie entsandt haben.
Aber funktioniert das noch, das Prinzip der Vertraulichkeit?
“Und wie das funktioniert!“
Angesichts von zehn Sitzungen im Jahr, in denen 400 bis 500 Seiten Protokolle erstellt werden, die hinterher breit in der ARD gestreut werden, sei es eigentlich auch „erfreulich selten“, dass Teile daraus gezielt an die Presse lanciert werden. Auch die Aufregung um die Kritik an der Ukraine-Berichterstattung fand Siebertz eigentlich gar nicht so groß: Print-Medien zum Beispiel hätten nur marginal berichtet.
 

„Der ARD-Programmbeirat ist eines der besten Gremien, die ich kenne“, sagt Siebertz. „Aufmerksamkeit und Engagement sind Basis für extrem konstruktive Diskussionen“. In 90 Prozent aller Fälle sei das Votum der Mitglieder einhellig, und das, obwohl das Gremium außerordentlich heterogen sei: vom Vertreter der Linken aus Sachsen-Anhalt bis zum katholischen Priester aus Rheinland-Pfalz. Deren Positionen in den Diskussionen seien nicht vorhersehbar oder parteipolitisch geprägt, was Siebertz als Ausweis nimmt, dass alle „auf professioneller Basis“ arbeiten. Was sie zu sagen haben über das Programm, werde in der ARD „sehr ernst genommen“, sagt Siebertz.
Der dann, nachdem das Telefongespräch eine Weile gedauert hat, plötzlich zurückfragt: „Glauben Sie, dass das irgendjemanden interessiert?“ Eigentlich sei es ihm gar nicht recht, so lange mit mir geredet zu haben.
· · ·
55 Seiten umfasst das Protokoll von der Juni-Sitzung; das von Telepolis veröffentlichte kritische Resümee zur Ukraine-Berichterstattung macht nur knapp vier Seiten davon aus. Das Protokoll liefert einen faszinierenden Einblick in die Diskussionen in diesem Gremium, gerade im Detail.
Der Programmbeirat kritisierte unter anderem die alarmistischen Titel vieler ARD-Talksendungen zum Thema. Die „Günther Jauch“- Sendungen habe man zwar leider nicht ansehen können, weil sie schon nicht mehr in der Mediathek verfügbar waren, aber zumindest die Titel habe man durchgesehen:
„Putins Machtspiele – Gibt es jetzt Krieg?“ (2. März), „Putin, der Große – Wie gefährlich ist sein Russland?“ (23. März) und „Kriegsgefahr in Europa – Ist Putin noch zu stoppen?“ (4. Mai). Diese Titel seien reißerisch und provozierend und wohl dazu gedacht, Zuschauer zu gewinnen. Sie spielten mit den Begriffen Krieg, Macht und Gefahr – aber um welchen Preis?
In einem Fall gab Thomas Baumann, der auch ARD-Chefredakteur ist, dem Programmbeirat recht: Den Titel „Kriegsgefahr in Europa – Ist Putin noch zu stoppen“ habe auch er für nicht adäquat gehalten, „aber die Wahl der Titel liege in der Verantwortung der jeweils zuständigen Redaktion, die auch nach seiner Intervention dabei habe bleiben wollen“, notiert das Protokoll. „Wenn in Titeln der Konflikt ohne zwingende Notwendigkeit zu sehr auf eine Person – Putin – fokussiert und diese Person de facto an den Pranger gestellt werde, dann sei nach seiner, Baumanns, Messlatte die Grenze überschritten.“
Baumann versprach damals auch, mit der „Weltspiegel“-Redaktion des Bayerischen Rundfunks über die Moderationen von Bernhard Wabnitz zu reden, die auch er für ein Stück weit zu stark zugespitzt halte. Dem Programmbeirat waren dessen Anmoderationen und die „sehr aggressive, harte und in hohem Maße wertende Sprache“ aufgestoßen – „man habe sich an die Sprache des Kalten Kriegs erinnert gefühlt“.
Unzufrieden waren die Mitglieder des Programmbeirates auch mit der Zuspitzung, wie sie im „Bericht aus Berlin“ gepflegt wird. Im März habe Moderator Rainald Becker „provozierend und wertend begonnen“ und gefragt: „Putin kann vor Stolz kaum noch laufen, die Krim ist weg! Reicht ihm das?“ Seinen Interviewpartner Matthias Platzeck habe er etwa gefragt: „Verstehen Sie Putin?“ und: „Halten Sie Putin für vertrauenswürdig?“ Das Protokoll notierte: „Erfreulich sei, dass es Menschen gebe, die auf solche Fragen sachlich antworteten.“ Und weiter:
„Müssten solch provozierende Fragen, wie man sie im ‚Bericht aus Berlin‘ erlebt habe, sein? Warum gehe man nicht einmal etwas mehr in Tiefe? Die Interview-Partner dagegen hätten durchwegs sehr nachdenklich und differenziert reagiert, so sehr Becker sie auch zu scharfen Antworten zu reizen versucht habe.“
Auch die Berichterstattung zur Europawahl hat sich der Programmbeirat im Juni angesehen, mit sehr unterschiedlichen Befunden. Eine „Hart aber fair“-Sendung (12. Mai 2014) mit dem Titel „Die Euro-Klatsche: EU-Gegner vor dem Triumph?“ sei, so das Protokoll:
„untragbar gewesen, noch unter Stammtisch-Niveau. Es sei der unsagbare Henryk Broder eingeladen gewesen, der mit seinen polemischen Querschlägern jegliche Diskussion zunichte mache, sowie Hans-Olaf Henkel, der populistischen [sic!] Thesen habe behaupten dürfen, ohne dass ihm kompetent widersprochen worden wäre. (…) Allein die Gästeauswahl habe schon von vornherein nichts anderes als EU-Bashing erwarten lassen.“
Ein etwas merkwürdiges journalistisches Verständnis zeigt sich bei der Kritik des Programmbeirates an der Berichterstattung am Wahlabend:
„Als sehr problematisch habe man empfunden, dass gleich die erste Live-Schalte in die Parteizentrale der AfD gegangen sei und ausgerechnet Bernd Lucke bei einer überschwänglichen Rede und anschließendem langem Beifall erfasst habe; überhaupt sei die AfD in dieser Sendung überrepräsentiert gewesen.“
Dass die AfD (Alternative für Deutschland) aufgrund ihres Wahlergebnisses das Thema des Abends war, scheinen die Programmbeiratsmitglieder nicht nachvollziehen zu können.
Sie kümmern sich auch um vermeintliche Details, wie die Leistung der Moderatoren:

“Schönenborn habe gewohnt souverän agiert. Ehni habe ein wenig exaltiert gewirkt, und Strempel habe seine Sache nach etwas hölzernem Anfang gut gemacht.“
Bei der „Wahlarena“ mit Martin Schulz und Jean-Claude Juncker hingegen seien die Moderatoren Sonia Mikich und Andreas Cichowicz durch ihre Rolle, bloß Fragen aus dem Publikum weiterzuleiten, „unterfordert“ gewesen: „Für diese Funktion hätte es auch anderes, weniger journalistisch hochkarätiges Personal getan.“ (Namen nennt der Programmbeirat hier leider nicht.)
· · ·
Aus der Geschichte des ARD-Programmbeirates:
2011
Der Programmbeirat kritisiert Lena Meyer-Landrut, die nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest erneut Deutschland bei dem Wettbewerb vertreten soll. Bei ihrem Auftritt beim Deutschen Fernsehpreis sei „deutlich geworden, dass die Sängerin mittlerweile ihre Unbefangenheit verloren“ habe, heißt es laut Sitzungsprotokoll. Die 19-Jährige spiele „nun nur noch eine Rolle“.
2009
Der Programmbeirat spricht sich dafür aus, dass Oliver Pocher bei der ARD bleibt. Das Gremium unterstützt „nachdrücklich“ Bemühungen, Pocher ans Erste zu binden. Er stehe für eine jüngere Generation, die man „nicht allein mit Artigkeiten“ erreichen könne. Mit ihm sei der Sender auch für diese Zielgruppe attraktiv.
2007

Der Programmbeirat kritisiert das „Nazometer“, mit dem die ARD- Show „Schmidt & Pocher“ nach dem Eklat um „Tagesschau“- Moderatorin Eva Herman vermeintlich nazifreundliches Vokabular testete, darunter auch Begriffe wie „Gasherd“ und „Duschen“. „Der Programmbeirat bedauert, dass Harald Schmidt, Oliver Pocher und die zuständige WDR-Redaktion es hier an der notwendigen Sensibilität haben fehlen lassen.“
2003
Der Programmbeirat kritisiert die „zunehmende Tendenz“ in der ARD, bei Gewinnspielen auf teure 0190er-Nummern zurückzugreifen. Das sei „besonders ärgerlich“ und „nicht hinnehmbar“. Programmdirektor Günter Struve wurde dringend aufgefordert, „von dieser Praxis wieder abzurücken“.
1988
Der Programmbeirat fordert die ARD auf, Mut zu zeigen und „endlich“ die „Bonner Runde“ an den Wahlabenden einzustellen.Der Bonner Studioleiter und Moderator Ernst Dieter Lueg hatte sich nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg durch „insistierende Fragen“ („Der Spiegel“) den Zorn von Helmut Kohl zugezogen. Lueg habe „zwar forsch und überlegt gefragt, jedoch auf die gezeigte Arroganz der Politiker nur unzureichend reagiert. Die journalistische Kompetenz, so wird im Beirat festgestellt, habe hier gefehlt, die Sendung sei geradezu unerträglich gewesen. Er habe sich unverständlicherweise auf eine völlig überflüssige Diskussion mit dem Bundeskanzler eingelassen.“ Die Sendung bringe für den Zuschauer „überhaupt nichts“.
1988
Der Programmbeirat kritisiert die Kommentare in den „Tagesthemen“: Oftmals seien die Kommentatoren lieblos, „üben sich in der Unverbindlichkeit der Nacherzählung oder versuchen sich gar in Weissagen“. Außerdem sei es ärgerlich, dass unter den 38 Kommentatoren nur eine Frau sei.
1974
Der Programmbeirat beklagt sich über Wolfgang Menges Serie „Ein Herz und eine Seele“ und zählt die Schimpfwörter: In vier Sendungen sei 21 Mal „Scheiße“, 17 Mal „blöde Sau“ und 15 Mal „Arschloch“ gesagt worden.
1958
Der Programmbeirat fordert, die Namen von Ansagerinnen wie Irene Koss und Ursula von Manescul nicht einzublenden – „um den Star-Kult nicht zu unterstützen“.