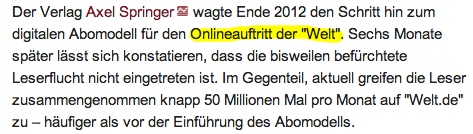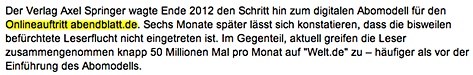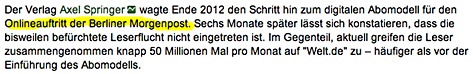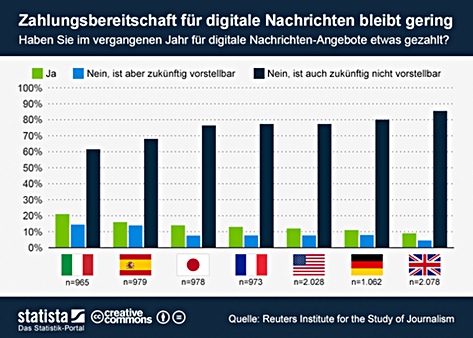Bei „Bild“ verstehen sie nicht, wie sie vom Landgericht Köln dazu verurteilt werden konnten, Jörg Kachelmann mehrere Hunderttausend Euro Geldentschädigung zu zahlen. „Gibt nun mal Urteile, die man nicht versteht“, twitterte die stellvertretende Chefredakteurin Tanit Koch. Und: „Ganz im Ernst: Wenn ich das erklären könnte, müßten wir ja nicht in Berufung.“ Lustig.
Vielleicht hat sie nur die Pressemitteilung ihres Verlages gelesen, nach deren Lektüre man tatsächlich nicht verstehen kann, warum das Gericht Kachelmann eine Rekordsumme zugesprochen hat. Vielleicht hätten ihr ein paar Stellen aus der Urteilsbegründung beim Verstehen geholfen. Diese zum Beispiel:
[…] Der Kläger [Kachelmann] wurde durch die Berichterstattung der Beklagten [„Bild“] als gewaltaffiner und frauenverachtender Serientäter charakterisiert, der aus eigensüchtigen Motiven nicht nur mehrere Partnerinnen gleichzeitig gehabt, sondern diese auch systematisch zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse belogen haben soll. Dass eine den Kläger derart abqualifizierende Berichterstattung nicht nur eine erhebliche Prangerwirkung entfaltet und zu einer sozialen Isolation führt, sondern den Kläger zudem mit einem Makel belegt, den er trotz des Freispruchs sein Leben lang mit sich führen wird, bedarf sicherlich keiner weiteren Erörterung.
Tatsächlich stellte das Gericht fest, dass es keine konkreten Anhaltspunkte fand, dass „Bild“ „hinsichtlich der rechtswidrigen Persönlichkeitsrechtsverletzungen vorsätzlich und mit Schädigungsabsicht gehandelt hätte“. Ihr könne „nur der Vorwurf gemacht werden, auf einem außerordentlich schwierigen Gebiet der Abwägung der widerstreitenden Grundrechtspositionen die rechtliche Grenzziehung fahrlässig verfehlt zu haben“. Diese Zitate finden sich in der Pressemitteilung von Springer.
Allerdings belegt das Gericht äußerst detailliert, wie „Bild“ diese Grenze wieder und wieder und wieder und wieder verfehlte. Es spricht von einer „wiederholten und hartnäckigen Verletzung der Privatsphäre des Klägers“. Insgesamt 18 Mal sei Kachelmann von der „Bild“-Berichterstattung „schwerwiegend in seiner Privat- bzw. Intimsphäre verletzt“ worden. Dadurch, dass „Bild“ Kachelmanns private Kommunikation veröffentlichte, ohne dass es einen Zusammenhang zu dem Verfahren gegen ihn gab. Dadurch, dass „Bild“ „detailreich über seine vermeintlichen sexuellen Beziehungen mit diversen Frauen“ berichtete. Dadurch, dass „Bild“ „mehrfach und entgegen der Unschuldsvermutung über vermeintliche weitere sexuelle Übergriffe“ berichtete, „obschon lediglich die Aussage des vermeintlichen Opfers als vermeintliche Beweistatsache vorlag“. Und dadurch, dass „Bild“ „unter hartnäckiger Verletzung der Privatsphäre des Klägers mehrfach Fotos [veröffentlichte], die ihn als Häftling in der JVA und im Hof der Kanzlei seiner Verteidigerin zeigten, ohne dass er die Möglichkeit gehabt hätte, dieser – mitunter heimlichen – Nachstellung zu entkommen“.
Es geht, wie man an dieser Aufzählung erahnt, in diesem Prozess nur am Rande um knifflige Grenzfälle bei der Berichterstattung über ein Strafverfahren, bei dem ein Prominenter einer Vergewaltigung angeklagt wird. Um Fragen wie die, ob das, was vor Gericht verhandelt wird, in jedem Fall auch öffentlich berichtet werden darf.
Ausschlaggebend für die hohe Geldentschädigung waren viele Fälle klarer, schwerer Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Die „Bild“-Leute nahmen – wie andere Medien und insbesondere die des Burda-Verlages auch – den strafrechtlichen Vorwurf als Vorwand, alle möglichen, dafür irrelevanten Details und Behauptungen über das Privat- und Intimleben von Kachelmann öffentlich zu machen. Dass schon die Berichterstattung über Kachelmanns Festnahme, die Anschuldigungen und den Prozess sein Image nachhaltig schädigten, ist sicher richtig. Aber hier geht es um Berichte, die sich in keiner Weise mit einem irgendwie gearteten Informationsinteresse der Öffentlichkeit rechtfertigen lassen – und schon gar nicht mit der Unschuldsvermutung vertragen.

Bleiben wir noch einmal kurz bei den Fotos, die „Bild“ heimlich von Kachelmann beim Hofgang im Gefängnis aufnahm und veröffentlichte. Und staunen, wie die Rechtsabteilung von „Bild“ sie laut Gericht rechtfertigt:
Hinsichtlich der Fotos des Klägers in der JVA sei sich der Kläger der Beobachtung durch Fotografen bewusst gewesen und habe es billigend in Kauf genommen, dass er während des Hofgangs fotografiert worden sei. Ferner zeigten die Fotos den Kläger im Innenhof der JVA, der vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbar sei. Zudem habe die Beklagte in Ausübung ihrer „Wachhundfunktion“ aus Anlass einer jeweils neuen Entwicklung im Ermittlungs- und Strafverfahren gegen den Kläger aufgrund eines aktuellen Berichterstattungsinteresses berichtet, so dass die Darstellung der Fotos im Zusammenhang mit dem Strafprozess gegen den Kläger, insbesondere der Untersuchungshaft in der JVA, seinem Umgang mit der wiedergewonnenen Freiheit nach Aufhebung des Haftbefehls und der Gewährung eines Prozessurlaubs in Kanada, stünde.
Das Gericht sieht darin hingegen einen Eingriff „in den Kernbereich der Privatsphäre“:
Denn der Kläger befand sich in einer Situation, in der er nicht erwarten musste, von der Presse behelligt zu werden, wobei dies vorliegend umso mehr gilt, als sich der Kläger in der betroffenen Situation nicht in einem öffentlich zugänglichen Verkehrsraum bewegte. Ein besonderes Gewicht kommt auch der Tatsache zu, dass die Beklagte die Bilder heimlich, d.h. ohne Kenntnis des Klägers und unter Ausnutzung von technischen Mitteln aufnahm.“
Die „Bild“-Zeitung habe die Fotos allein zur Befriedigung der Neugier der Öffentlichkeit veröffentlicht, obwohl sie hätte erkennen können, dass sie dadurch
den Kläger gegenüber der Öffentlichkeit als Häftling in einer Situation vorführte, in der er der Verfolgung durch die Fotografen – selbst wenn er sie wahrgenommen hätte – nur unter Aufgabe des täglichen Hofgangs hätte entkommen können, ihr mithin ausgeliefert war.
„Bild“ veröffentlichte auch rechtswidrig Textnachrichten, die Kachelmann der zeitweise bekannten Popsängerin Indira Weis schrieb (Überschrift: „Er schickte ihr 50 heiße Flirt-SMS“). Das Gericht nennt die Weitergabe und wörtliche Veröffentlichung mit allen Einzelheiten des Ausdrucks mehr als eine „bloße Indiskretion“, nämlich „eine komplexe Preisgabe der Person des Klägers an die Öffentlichkeit.“ Der „Bild“-Zeitung sei insofern
eine rücksichtslose Verfügung über die Person des Klägers vorzuwerfen. Denn der Beklagten war schon aufgrund der Umstände – der Kläger befand sich in Untersuchungshaft, das Ermittlungsverfahren dauerte an – bewusst, dass dieser keine Einwilligung zur wörtlichen Veröffentlichung der betreffenden SMS-Nachrichten erteilen würde.
„Bild“ verbreitete mehrmals Vorwürfe von anderen angeblichen Affären Kachelmanns, wonach er zum Beispiel ihnen gegenüber gewalttätig geworden sei – auch dann, wenn jeder Beweis für die Richtigkeit dieser ihn stigmatisierenden Behauptungen fehlte:
Basiert […] der Vorwurf einzig auf einer Anzeige/Aussage einer Person, gehört es zu der journalistischen Pflicht eines Presseorgans auch, die Glaubhaftigkeit derselben zu hinterfragen. Dies ist hier offenkundig nicht geschehen, obschon der Beklagten diese Pflicht hätte bekannt sein müssen. […]
Im Ergebnis bleibt der den Kläger stigmatisierende Verdacht, eine weitere Frau misshandelt zu haben, stehen, ohne dass seitens der Beklagten ausgewogen berichtet worden wäre.
„Bild“ veröffentlichte Auszüge aus privaten Emails, die „keinen über die allgemeine charakterliche Abqualifizierung des Klägers hinausgehenden Bezug zu der ihm vorgeworfenen konkreten Tat, seinen vermeintlichen Motiven, anderen angeblichen Tatvoraussetzungen oder der Bewertung seiner Schuld“ herstellten. Das Gericht schreibt:
Vor diesem Hintergrund läuft der Kläger aber Gefahr, ungeachtet der rehabilitierenden Wirkung eines Freispruches von dem Vorwurf der schweren Vergewaltigung und gefährlichen Körperverletzung in den Augen einer breiten Öffentlichkeit weiterhin mit dem Makel eines charakterlich defizitären, lügnerischen und perfiden Verhaltens gegenüber Frauen gebrandmarkt zu sein, ohne dass ein über die Befriedigung der bloßen Neugier hinausreichendes Informationsinteresse erkennbar wäre.
Das Gericht räumt ein, dass das Berichterstattungsinteresse über das Strafverfahren aufgrund der Prominenz Kachelmanns und der Schwere des Vorwurfs immens gewesen sei.
Gleichwohl rechtfertigt dieses außergewöhnlich große Informationsinteresse der Öffentlichkeit […] nicht jedwede Berichterstattung, da gerade bei der Berichterstattung über das Bestehen eines Verdachts der Begehung einer Straftat durch die Medien besondere Gefahren für den jeweils Betroffenen bestehen. Denn Verdächtigungen, Gerüchte und insbesondere Berichterstattungen durch die Medien werden oft für wahr genommen, ihre später erwiesene Haltlosigkeit beseitigt den einmal entstandenen Mangel kaum und Korrekturen finden selten die gleiche Aufmerksamkeit wie die Bezichtigung, insbesondere wenn es später zu einem Freispruch unter dem Gesichtspunkt in dubio pro reo kommt. Deswegen gebietet die bis zur rechtskräftigen Verurteilung zu Gunsten des Angeklagten sprechende Unschuldsvermutung eine entsprechende Pflicht der Medien, die Stichhaltigkeit der ihr zugeleiteten Informationen unter Berücksichtigung der den Verdächtigen bei identifizierender Berichterstattung drohenden Nachteile gewissenhaft nachzugehen, und eine entsprechende Zurückhaltung, gegebenenfalls einhergehend mit einer Beschränkung auf eine ausgewogene Berichterstattung.
Die Entschädigung, die Kachelmann zugesprochen wurde, soll zum einen den ihm entstandenen (immateriellen) Schaden wieder gutmachen, andererseits aber auch abschrecken – das Gericht spricht von „Kompensationszweck“ und „Präventionsgedanken“: Durch die Höhe der Geldentschädigung solle „Bild“ „verdeutlicht werden, in Zukunft bei der Berichterstattung über vergleichbare Geschehnisse eine größere Sorgfalt und Zurückhaltung an den Tag zu legen“.
Der entstandene Schaden für Kachelmann sei aber auch immens und anhaltend:
Zum anderen ist zu beachten, dass der Kläger zumindest auch durch die seine Intim- und Privatsphäre verletzende sowie in weiten Teilen reißerische Berichterstattung der Beklagten nicht nur während des Zeitraums derselben, sondern auch in Zukunft als frauenverachtender und gewaltbereiter Wiederholungstäter stigmatisiert wurde bzw. bleiben wird, wodurch sowohl sein berufliches Wirken als auch sein Privatleben massiv beeinträchtigt wurden bzw. bleiben werden.
Die „Bild“-Zeitung hingegen meinte laut Gericht, dass „sämtliche zum Beleg einer angeblich systematischen Verletzung seiner Privatsphäre genannten Berichterstattungen harmlos seien“. Auch hätte sie ihn nicht diffamiert, „da jeweils die Auseinandersetzung in der Sache im Vordergrund gestanden habe“. Und weiter:
Jedenfalls habe der Kläger sich durch den persönlichen Rundumschlag gegen Justiz, die Presse, das vermeintliche Opfer und die Frauenwelt in seinem Buch selbst hinreichend Genugtuung verschafft und Details zu seinem Intim- und Sexualleben preisgegeben. Es gebe deshalb keinerlei Grund, ihm zusätzlich nun auch noch eine Geldentschädigung in Millionenhöhe zuzusprechen.
In Millionenhöhe nicht, entschied das Kölner Landgericht. Aber in Höhe von 635.000 Euro.