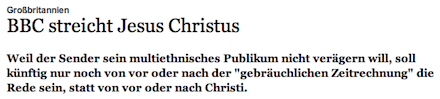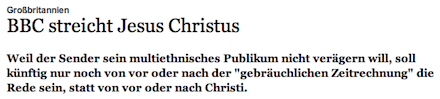
Was bisher geschah: Am Mittwoch behauptet der „Tagesspiegel“ in einem Artikel, die BBC habe die Bezeichnungen „vor / nach Christus“ in Zeitangaben aus übertriebener Political Correctness abgeschafft. Richtig ist, dass die Religionsseiten des Online-Angebotes der BBC auf diese Begriffe verzichten. Eine allgemeine Vorgabe gibt es laut BBC aber nicht. Nachdem ich im BILDblog den „Tagesspiegel“-Artikel als „Urbane Legende von der Political Correctness“ kritisiert habe, antwortet nun der „Tagesspiegel“-Autor auf tagesspiegel.de.
Schon der Vorspann ist falsch. Da steht:
Der Journalist Stefan Niggemeier wirft in seinem „Bildblog“ dem Tagesspiegel vor, falsch über den Verzicht der BBC auf die zeitliche Einordnung „vor Christus“/“nach Christus“ berichtet zu haben. Unser Korrespondent Matthias Thibaut nimmt Stellung.
Es gibt aber gar keinen Verzicht der BBC auf die zeitliche Einordnung „vor Christus“ / „nach Christus“.
Danach wird es nicht besser. Matthias Thibaut nimmt in seiner Erwiderung nichts zurück. Er korrigiert keinen seiner Fehler. Er „erinnert“ stattdessen daran, dass er in seinem „Tagesspiegel“-Bericht über die angeblich zum Orwellschen Ministerium der Wahrheit verkommende BBC ausdrücklich die „Daily Mail“ als Quelle der Berichte genannt habe.
Immerhin, soll das wohl heißen, hat er sich die Fehler nicht selbst ausgedacht. Er hat sie sich aber zu eigen gemacht.
Aber, schreibt Thibaut, er habe doch den von ihm zitierten Behauptungen der „Daily Mail“ folgende Sätze hinzugefügt:
Die BBC selbst betont, es gebe keinen Erlass von oben — jede Redaktion könne selbst entscheiden.
Aber Mitarbeiter wurden nachdrücklich daran erinnert, was für ein multiethnisches Publikum angemessener sei.
Er meint wohl, mit dem Alibisatz mit der BBC-Stellungnahme seiner journalistischen Sorgfaltspflicht genüge getan zu haben. Für die unmittelbar folgende Behauptung, die sie entwertet, nennt er keine Quelle.
Mit keinem Wort geht Thibaut darauf ein, dass auch die Geschichte falsch ist, die er ebenfalls aus dem Lügenblatt „Daily Mail“ abgeschrieben hat, „dass in einigen Gemeinden Weihnachten bereits durch das Kunstwort ‚winterval‘ (Winterfestival) ersetzt wurde, um Nichtchristen nicht zu verletzen“. Und er nimmt auch nicht seine falsche Behauptung zurück, dass „die BBC eine Nachrichtensprecherin abmahnte, die an einer Halskette ein Kreuz trug“. Stattdessen schreibt er: „Ich habe die schöne Fiona Bruce, die ich sehr bewundere, schon lange nicht mehr mit Kreuz gesehen“, als beweise das irgendetwas, außer dass Thibaut den Grundkurs „Weniger offensichtlich erbärmlich argumentieren“ geschwänzt hat.
In einem Punkt hat Thibaut Recht: Selbstverständlich ist mein BILDblog-Eintrag kein „Ausbund an objektiver Berichterstattung“. Er ist polemisch, was daran liegt, dass ich wütend bin. Weil sich seit Jahren immer dasselbe Muster wiederholt: Winzigkeiten, Halbwahrheiten und Komplettlügen werden zu Scheinbelegen dafür gemacht, dass Verfechter der Political Correctness dabei seien, das Abendland zu vernichten, indem sie im angeblichen Kulturkampf gegen den Islam Selbstmord aus Angst vor dem Tode begingen.
Kein Anlass ist dafür zu klein (und zu falsch), keine Überinterpretation zu groß. Die „Daily Mail“, die der Londoner Korrespondent des „Tagesspiegel“ offenbar mit Billigung seiner Redaktion als eine seriöse Quelle behandelt, hat aufgrund der BBC-Zeitenwendenbenamsungs-Sache einen Artikel veröffentlicht, der die vermeintliche Umbenennung in einen Kontext von Herbert Marcuse bis zur RAF stellt und in ihr Teil eines „marxistischen Plans“ sieht, „die Zivilisation von innen zu zerstören“.
Ich bin wütend, weil es mich fassungslos macht, wie die Lügen der „Daily Mail“ und ähnlicher Hassprediger immer wieder um die Welt gehen und unausrottbar werden, wie die Mär vom angeblich christliche Traditionen verdrängenden „Winterval“. Man sollte denken, dass Journalismus eine Barriere bei der Verbreitung dieser Urban Legends darstellt; stattdessen werden sie von Journalisten wie Thibaut begeistert weitergetragen.
Thibaut spricht von den „Diktaten der politischen Korrektheit“ und merkt nicht die Ironie. Tatsächlich verzichtet die BBC ja gerade auf das Diktat einer Formulierung. Sie stellt, im Gegenteil, ihren Redaktionen frei, welche Begriffe sie verwenden wollen — diejenigen, die sich explizit auf Christi Geburt beziehen, oder neutralere. Was die BBC hier predigt, ist die Freiheit der Wahl. Ist es nicht erstaunlich, dass ausgerechnet die Kämpfer gegen die „Diktate der politischen Korrektheit“ diese Freiheit nicht aushalten? Diejenigen, die gegen die BBC wettern und fordern, sie müsse immer und jedesmal Christus‘ Namen gebrauchen, sind es, die einen bestimmten Sprachgebrauch diktieren wollen.
Thibaut schreibt:
(…) ich halte es wirklich nur für eine Frage der Zeit, bis als Beispiel erfolgreicher Integration eine muslimische Nachrichtensprecherin im britischen TV mit Kopftuch auftreten wird — so wie seinerzeit der erste schwarze Nachrichtensprecher Trevor McDonald in England eine Barriere durchbrach.
Ich weiß nicht, ob er bedauert, dass Schwarze in Großbritannien Nachrichten lesen dürfen. Die Aussicht auf eine Nachrichtensprecherin mit Kopftuch jedenfalls hatte er in seinem ursprünglichen Artikel noch als düstere Vision „zynischer Kritiker“ dargestellt.
Nun sagt Thibaut, er würde muslimischen Frauen das Moderieren mit dem Kopftuch gerne erlauben, wenn sie eine Gegenbedingung erfüllen:
Wenn wir, als Gegenleistung für diesen Integrationsakt, in der BBC und anderswo, dann wieder, so wie die längst selbstverständlichen Witze und Lästerungen über Jesus und die Bibel, in der BBC auch wieder Späße oder gar Kritik über Mohammed und den Koran hören dürften, hätte ich persönlich nicht einmal etwas dagegen.
Immerhin kann man dem „Tagesspiegel“ also keine fehlende Toleranz vorwerfen: Er beschäftigt sogar Korrespondenten, die keine freundschaftlichen Beziehungen zur deutschen Sprache unterhalten — Verzeihung, ich bin immer noch und schon wieder wütend.
Für Thibaut hat Freiheit offenbar nichts mit unveräußerlichen Menschenrechten zu tun. Sie werden nur gegen Pfand ausgeliehen.
Wir können uns gern darauf einigen, dass meine Kritik an Thibaut und seinem „Tagesspiegel“-Bericht polemisch, unsachlich und nicht objektiv ist. Auf der anderen Seite: Seine Behauptungen sind falsch. Er weigert sich, sie zu korrigieren.
Übrigens: Die Erklärung im Religions-Ressort der BBC-Webseite, es verzichte auf die Verwendung der Begriffe „vor / nach Christus“, steht da seit mindestens vier Jahren.