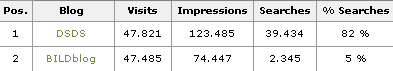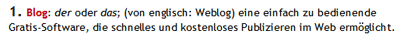Wer bin ich? Warum das Schreiben eines Blogs so befriedigend ist.
· · ·
Für mich ist es eine Sucht. Ein unstillbarer Hunger nach Aufmerksamkeit. Oder, um es positiver und weniger egozentrisch zu sagen: nach Kommunikation.
Das trifft natürlich nicht auf alle Blogger zu, so wie ungefähr nichts auf alle Blogger zutrifft. Außerdem gehört zum Selbstverständnis vieler Blogger das Postulat, nicht für die Leser zu schreiben, sondern für sich selbst. Wer scheinbar auf möglichst große Quote bloggt, gilt als zutiefst verdächtig. Das machen die Massenmedien ja schon zur Genüge: alles der Pflicht unterordnen, möglichst viele Menschen zu erreichen.
Aber gerade wenn einer nicht für ein Publikum schreibt, sondern für sich selbst, aber nicht in eine Kladde, sondern ins Internet, ist es umso beglückender, wenn plötzlich ein Leser vorbeikommt, dem das gefällt. Der begeistert ist, einen Geistesverwandten zu finden. Oder interessiert genug, seinen Widerspruch zu hinterlassen. Vielleicht sogar ein eigenes Blog hat und einen Link setzt.
Links sind eine Währung in der Welt der Blogs, aber der eigentliche Lohn ist Aufmerksamkeit. Die lässt sich messen, anhand von Leserzahlen, Seitenabrufen und Verlinkungen. Aber so fixiert viele auf diese Hitparaden sind (ich auch) – das zutiefst befriedigende am Bloggen ist nicht eine wachsende Zahl, sondern die Kommunikation an sich. Der eine Kommentar von jemandem, der genau verstanden hat, was ich sagen wollte, und meine Sätze durch eine Pointe krönt. Der Fremde, der zum Stammgast wird, zum Dauer-Kommentierer, zum Freund. Auch der Gegner, an dem ich mich immer wieder reiben kann.
Mein Blog kann ein ständiger Abgleich meiner Realitätswahrnehmung mit der anderer sein: Wer bin ich? Wie sehen die anderen mich? Worüber lachen sie? Was lässt sie kalt, was verstehen sie falsch? Die Konversationen, die entstehen, sind immer wieder Experimente in sozialer Interaktion: Welcher Kommentar lässt eine Debatte entgleiten? Wo formieren sich viele Blogs mit gemeinsamem Ziel? Wann macht die Größe einer solchen Welle aus der Masse einen Mob? Und wann eine schlaue, mächtige Bewegung?
Anders als für die meisten Blogger ist für Journalisten die Möglichkeit, zu vielen Leuten zu sprechen, nicht neu. Aber auch sie kannten selten etwas wie diese Unmittelbarkeit der Reaktion, diesen direkten Austausch mit dem Publikum, diese Chance zur virtuellen, aber echten Konversation.
Ich hatte bislang nur eine sehr vage Vorstellung davon, wer meine Texte liest und wie sie gelesen werden. Nun werden Leser und ihre Reaktionen sichtbar für mich (und jeden, den es interessiert). Das ist ein unschätzbarer Gewinn. Und eine Gefahr: Es ist leicht, die engagierten Kommentatoren und die mich zitierenden Internetseiten für das Ganze zu halten, und zu vergessen, dass sie nur einen kleinen Teil des Publikums darstellen, und womöglich nicht einmal einen repräsentativen.
Und dann kann die Internetwelt, die theoretisch so viel größer, reicher und vielfältiger ist als die konkrete nicht-virtuelle Lebenswelt vor unserer Haustür, plötzlich wieder ganz klein und eng werden. Wir lieben die fortgeschrittenen Formen der Kommunikation, die wir pflegen können, weil die anderen, die wir lesen und die uns lesen, die Anspielungen, Running-Gags und Seitenhiebe verstehen. Wie gehen auf in einem Netzwerk, das uns glücklich macht, weil wir uns verstehen oder wenigstens wissen, warum wir uns nicht verstehen; in der sich alles um Kommunikation dreht, um Sprache; um einen Austausch, der ebenso albern sein kann wie tiefgründig — und befriedigender als das nicht-virtuelle, aber flüchtige Gespräch zuhause, in der Kneipe, im Café.
Ich merke, dass mir das Gespräch mit Leuten, die in dieser digitalen Welt nicht zuhause sind, manchmal schwerer fällt. Und ich ahne, warum die Welt der Blogs, die eigentlich so offen und grenzenlos ist, plötzlich hermetisch wirken kann, weil es scheint, als würden alle nur noch für sich selbst schreiben oder für einander.
Aber das täuscht.
(c) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
[Dieser Artikel erschien als Ergänzung zu diesem Text von Harald Staun.]