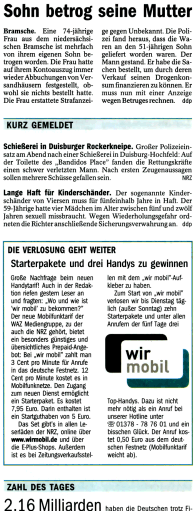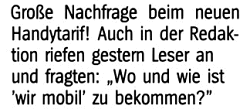Es ist wie ein schlimmer Tinnitus. Ein nerviges Klingeln, das nie wieder aufhört. Seit Monaten läuten Verleger und Privatsender ununterbrochen irgendwelche Alarmglocken. Jeden Tag beschwert sich irgendein Lobbyist wieder lautstark über irgendeine Ungerechtigkeit, beklagt irgendeine Ungeheuerlichkeit, kündigt Eingaben, Klagen, Proteste an. Und jedesmal steht damit alles auf dem Spiel: Die Existenz von tausenden Arbeitsplätzen. Die Zukunft des Journalismus. Die Grundlage unserer Medienordnung. Das Funktionieren der Demokratie.
Wenn morgen die Meldung käme, dass die Verlegerverbände jetzt mit Selbstmordanschlägen drohen, wenn nicht sofort alle tun, was sie sagen — ich wäre nicht überrascht.
Sprachlich sind die Eskalationsmöglichkeiten längst erschöpft. WAZ-Geschäftsführer Christian Nienhaus hat eine Beschlussvorlage des NDR-Rundfunkrates, die dem Angebot tagesschau.de großen Bestands- und Entwicklungsschutz gewähren will, den „größtmöglichen Super-GAU in der deutschen Medienpolitik der vergangenen 20 Jahre“ genannt (und niemand verrät ihm, wofür das „G“ in „GAU“ steht).
Die Logik hat bereits vor einer Weile einen Ausreiseantrag aus der Diskussion gestellt, der offenbar jetzt genehmigt wurde. Der Verlag Gruner+Jahr fordert, den Rundfunkstaatsvertrag zu ändern, weil der NDR die darin nach Ansicht des Verlages enthaltene Beschränkungen nicht versteht. Das ist der eingesprungene Rittberger der Lobbyarbeit: Man behauptet einerseits, dass die gesetzlichen Vorgaben jetzt schon eindeutig sind und der NDR dagegen zweifelsohne verstoßen habe, und andererseits, dass die gesetzlichen Vorgaben verschärft werden müssen, weil sie nicht eindeutig sind, und tut so, als sei das gar kein Widerspruch.
Wenn man aus Verlogenheit Energie machen könnte, ließe sich dank dieser Debatte ein Atomkraftwerk abschalten. Die Verlegerverbände fordern, dass endlich die Politik etwas tun muss. Der oberste Zeitschriftenlobbyist Wolfgang Fürstner hat den niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff gebeten, gegen die „Pläne des NDR“ einzuschreiten. Als aber Wulffs Hamburger Kollege Ole von Beust vorübergehend im Verdacht stand, das Vorgehen des Rundfunkrates gutzuheißen, maßregelte das „Hamburger Abendblatt“ sofort den Politiker, er dürfe sich nicht in ein „laufendes Verfahren“ einmischen.
Nun bin ich kein Experte dafür, was die richtige Strategie ist, um auf Politiker Eindruck zu machen. Immerhin hatten die Verleger mit ihrer Kampagne für ein Leistungsschutzrecht bei der schwarz-gelben Koalition Erfolg, obwohl auch die fast ausschließlich auf die Strategie setzte, möglichst laut und langanhaltend zu brüllen, und bis heute niemand erklären kann, wie genau ein entsprechendes Gesetz aussehen soll und auf welche wundersame Weise es die Verlage retten würde.
Ich frage mich aber, welche Wirkung das ununterbrochene Geheule auf die interessierte Öffentlichkeit hat. Die Verleger schlagen wild um sich wie ein Ertrinkender. Die Botschaft, die sie damit aussenden, lautet: Wir sind nur dann noch in der Lage, genügend Geld zu verdienen, um die Menschen vernünftig zu informieren, wenn alle Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändert und jeder störende Konkurrent ausgeschaltet wird. Die Geschäftsgrundlage ist offenbar so fragil, dass es schon tödlich sein kann, wenn es einem öffentlich-rechtlichen Anbieter erlaubt wäre, seine Inhalte auf einem beliebten Smartphone in etwas attraktiverer Form als bisher anzubieten. Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG, Mathias Döpfner, hat (mutmaßlich) allen Ernstes die geplante „Tagesschau“-App für das iPhone mit dem Verlust von „Tausenden Arbeitsplätzen in der Verlagsbranche“ in Verbindung gebracht und ist trotzdem nicht aus dem Land gelacht worden. WAZ-Co-Geschäftsführer Bodo Hombach will in diesem Zusammenhang nun sogar anderen Verlagen das Geschäftsmodell vorschreiben und geißelt eine App der „Financial Times Deutschland“ als Sünde, weil sie nichts kostet. (Vielleicht hat ihm niemand gesagt, dass es sich beim konkreten Angebot nur um die Aufbereitung auch sonst frei verfügbarer Inhalte handelt und nicht etwa um eine Art E-Paper wie bei den kostenpflichtigen Apps von „Bild“, „Welt“ und „Spiegel“.)
Es spricht nicht für den Glauben an die Einzigartigkeit und Hochwertigkeit der eigenen Produkte, wenn Verlagsleute den Eindruck erwecken, die Leser würden im Internet oder auf ihrem Telefon die erstbeste Gelegenheit nutzen, die kostenpflichtige Zeitung nicht mehr zu lesen, weil sie die „Tagesschau“ umsonst kriegen. (Was ja bisher auch schon so war, sich aber in zwei verschiedenen Medien abspielte.) Rührend ist auch, wenn im Kampf gegen den Konzern Google, dem die Verleger die Einnahmen neiden, anklagend Studien zitiert werden, wonach sich ein größerer Teil der „Google News“-Leser damit zufrieden gibt, dort die Schlagzeilen zu lesen, und gar nicht mehr die eigentlichen Artikel der verlinkten Online-Medien anklickt. Mit derart anspruchslosen Lesern werden Qualitätsmedien ohnehin kein Geld verdienen können — im Zweifel sind die auch jetzt schon zufrieden damit, einen flüchtigen Blick auf die Titelseite der Zeitung am Kiosk zu werfen.
Wenn ich das Getöse richtig verstehe, verhält es sich also ungefähr so: Die Verlage müssen von der (ohnehin schon reduzierten) Mehrwertsteuer befreit werden, Google muss verboten oder zur Zahlung von Lizenzgebühren verpflichtet werden, ARD und ZDF müssen das Internet verlassen, das Zitatrecht muss drastisch eingeschränkt, das kostenlose Anbieten von Informationen untersagt und die Gratis-Kultur im Internet insgesamt vernichtet werden — dann, ja dann könnten die Verlage vielleicht, möglicherweise, wenn das Wetter stimmt, in der Lage sein, auch in Zukunft Qualitätsjournalismus anzubieten, und womöglich sogar im Netz. Sonst können sie für nichts garantieren.
Vielleicht merken Print- und Privatfernsehlobbyisten gar nicht, dass sie damit den öffentlich-rechtlichen Sendern eine neue Legitimationsgrundlage schaffen.
Denn wenn das Geschäft mit der Information für private Medien wirklich so schwierig ist, gibt es für den Staat zwei Möglichkeiten, um dafür zu sorgen, dass seine Bürger gut informiert werden. Die eine ist die, alles dafür zu tun, um den Verlagen und Privatsendern das Leben zu erleichtern, in der Hoffnung, aber ohne Gewähr, dass es reicht. Die andere ist die, die öffentlich-rechtlichen Sender zu stärken und ihnen ein Leben in der digitalen Welt zu erlauben.
Man kann nicht oft genug referieren, wie das Bundesverfassungsgericht, das die deutsche Medienlandschaft mit seinen Rundfunkurteilen maßgeblich geprägt hat, den Begriff der „Grundversorgung“ verstand, die ARD und ZDF zu leisten hätten. Er geht davon aus, dass man sich u.a. aufgrund ihrer Werbefinanzierung nicht darauf verlassen könne, dass die Programme der privaten Sender immer hohen Ansprüchen zum Beispiel an Meinungsvielfalt genügen. Man dürfe die öffentlich-rechtlichen Sender deshalb nicht darauf beschränken, die jeweiligen Lücken zu füllen, die private Anbieter aus wirtschaftlichen Gründen hinterlassen, sondern ARD und ZDF müssten all das bieten, was eine Gesellschaft an Information, Bildung, Unterhaltung brauche — und wenn Private es schaffen, das zu ergänzen, ist es schön und wenn nicht, ist es nicht schlimm. (Gegner von ARD und ZDF missverstehen den Begriff gerne als Minimalversorgung, das Schwarzbrot: Dokumentationen, Nachrichten, hochwertige Filme, die keiner guckt. So ist er nicht gemeint.)
Ähnlicher Schindluder wird mit dem Begriff des „Dualen Systems“ getrieben, insbesondere wenn angesichts wegbrechender Werbeerlöse der Privaten und konstanter oder gar steigender Einnahmen der Öffentlich-Rechtlichen beklagt wird, es sei aus dem „Gleichgewicht“ geraten. Aber die Idee dieses Dualen Systems war nicht, dass Öffentlich-Rechtliche und Private gleich stark sein sollen. Die Idee war, die Öffentlich-Rechtlichen so auszustatten, dass sie uns auch dann gutes Fernsehen liefern, wenn die Bedingungen bei den Privaten einmal dafür nicht ausreichen. Zu argumentieren, dass wenn die Privaten leiden, auch ARD und ZDF weniger kriegen sollen, ist bizarr — zeigt aber, wie sehr die Debatte nicht die Interessen der Zuschauer, sondern die der Privatsender im Blick hat.
Nun sind all diese Grundlagen maßgeschneidert für das Medium Fernsehen, dem ein außerordentlicher Einfluss auf die Zuschauer zugeschrieben wurde und dessen Verbreitung exorbitant teuer war, so dass große Macht zwangsläufig in den Händen weniger liegen würde. Man kann mit gutem Grund fragen, ob dieses System angesichts der digitalen Revolution noch zeitgemäß ist. Man könnte zum Beispiel fragen, ob ARD und ZDF im Internet noch benötigt werden, wenn Verlage, Privatsender und andere dort doch täglich beweisen, dass sie hochwertigen, vielfältigen Qualitätsjournalismus anbieten, der trotz seiner Abhängigkeit von Werbung keine Wünsche offen lässt.
Bis zur aktuellen Wirtschafts- und Werbekrise haben Verlage und Privatsender genau diesen Eindruck erweckt, um den Spielraum von ARD und ZDF im Internet gesetzlich so weit wie möglich einzuschränken. Doch nun zeigt sich plötzlich, dass keineswegs klar ist, ob und wie sich guter Journalismus im Internet finanzieren lässt. Damit bekommen die Öffentlich-Rechtlichen eine neue mögliche Legitimation auch für dieses Medium, genau genommen die alte: durch verlässlich und von allen gemeinsam finanzierte Medien eine umfassende Grundversorgung sicherzustellen, die eine rundum gut informierte Gesellschaft ermöglicht, selbst wenn die privaten Anbieter in schlechten Zeiten oder aus grundsätzlichen Problemen das nicht in befriedigendem Maße tun können.
Wohlgemerkt: Es sind die Verlags- und Privatsenderleute selbst, die diesen Eindruck gerade erwecken, dass sie unter den herrschenden Bedingungen nicht für Qualität im Internet bürgen können.
Springer-Chef Döpfner erregt sich darüber, dass die ARD ihre Nachrichten kostenlos iPhone-gerecht anbieten will und damit die Versuche seines Hauses erschwert, Inhalte auf verschiedenen Plattformen nur noch gegen Geld anzubieten. Das ist aus seiner Sicht konsequent. Natürlich wäre es für alle Verlage besser, wenn es niemanden gäbe, der journalistische Inhalte umsonst anböte, und alle Leser also gezwungen wären, dafür zu bezahlen. Ich glaube nur nicht, dass das auch im Interesse der Gesellschaft wäre.
Wolf-Dieter Ring, der Präsident der Bayerischen Landesmedienanstalt, ist natürlich niemand, der im Verdacht steht, das Interesse der Gesellschaft im Blick zu haben. Er spielt schon lange eine lustige Doppelrolle als Aufseher über die Privatsender und ihr Lobbyist. Im vergangenen Herbst rief er die Verlage dazu auf, geschlossen auf Paid-Content-Konzepte zu setzen, und forderte von der Politik, die Öffentlich-Rechtlichen in Zaum zu halten: Kostenlose Angebote wie tagesschau.de unterliefen die möglichen neuen Erlösmodelle der Verlage im Netz.
Warum soll es gesellschaftlich erstrebenswert sein, journalistische Inhalte nur denen zugänglich zu machen, die dafür zahlen können? Inwiefern ist es gut, wenn Menschen ohne Geld schlecht informiert werden? Wäre es nicht gerade dann, wenn die Verlage ihre Online-Angebote kostenpflichtig machen (müssen), erstrebenswert, ein kostenloses, aber dennoch zuverlässiges Angebot zu haben? „Kostenlos“ ist natürlich der falsche Ausdruck, denn ARD und ZDF werden ja von uns bezahlt, aber Leute ohne Einkommen sind von der Gebühr befreit — eine solidarische, soziale Konstruktion, diese Rundfunkgebühr, die zudem dafür sorgt, dass nicht nur das produziert und finanziert wird, was eine Mehrheit sehen will.
Die Konkurrenten der öffentlich-rechtlichen Sender haben durchgesetzt, dass ARD und ZDF viele Inhalte aus dem Netz löschen müssen — und keineswegs nur zweifelhafte Angebote wie Kochrezepte oder Kontaktbörsen. Seitdem sind diverse Leute in den Anstalten mit etwas beschäftigt, das den schönen Namen „Depublizieren“ trägt. Inwiefern dient es dem Gemeinwohl, wenn ARD und ZDF teuer produzierte Inhalte nur für eine begrenzte Zeit (in der Regel sieben Tage) zugänglich machen dürfen? Inwiefern ist es in meinem Interesse, dass Inhalte, die ich mit meinen Gebühren bezahlt habe, mir nur vorübergehend und nicht auf allen Plattformen angeboten werden?
Eine der lächerlichsten Äußerungen im Zusammenhang mit der geplanten iPhone-Anwendung der „Tagesschau“ war die der Springer-Pressesprecherin Edda Fels, die im vergangenen Advent pikiert formulierte: „Wir gingen davon aus, dass die vorhandenen Gebühren schon nicht mehr zur Finanzierung des bestehenden Angebots ausreichen. Deshalb wundern wir uns, dass im Vorfeld der geplanten Gebührenumstellung das Angebot sogar erweitert werden soll.“ Was wäre es für ein Quark, wenn die ARD erst teure Inhalte produzierte und dann an den im Vergleich lächerlich winzigen Kosten sparen würde, um diese Inhalte möglichst vielen Leuten möglichst bequem zugänglich zu machen? Wie sehr muss man die Welt durch eine eigene PR-Brille sehen, um nicht zu merken, dass ein zickiges „Ach dafür ist also noch Geld da?“ völlig an der Realität vorbeigeht?
Neben der iPhone-Anwendung ist ein Interview von tagesschau.de mit Kathrin Passig zum unwahrscheinlichen Symbol für den ungehemmten Expansionsdrang der Öffentlich-Rechtlichen geworden, der uns alle unter sich begraben wird. Das nette Gespräch (als bekennender Passig-Fan bin ich natürlich nicht objektiv) lief nämlich nicht im Fernsehen und bezog sich auch auf kein bestimmtes Programm, sondern war einfach nur informativ, verstieß damit also gegen die nur in bestimmten Fälllen aufgehobene Pflicht von ARD und ZDF, im Internet ausschließlich sendungsbezogene Inhalte zu veröffentlichen. Bei anderen Web-Formaten wie „Deppendorfs Woche“ (auf das ich persönlich gut verzichten könnte, aber das ist ja nicht die Frage) umgeht die ARD diese Vorgabe dadurch, dass sie sie auch in einem ihrer Digital-Kanäle ausstrahlt. Aber, Verzeihung, was ist das alles für ein Irrsinn?
Was den Tinnitus, der über der Diskussion liegt, noch unerträglicher macht, ist die Parteilichkeit der Medien. In vielen Redaktionen scheinen als Journalisten getarnte PR-Leute in eigener Sache zu arbeiten. Bei „Bild“ als Kampagnenorgan blieben natürlich als erstes die Fakten auf der Strecke. Zur Zeit findet sie fast jeden Tag Platz auf ihrer Seite 2 für einen kleinen Bericht, in dem irgendein üblicher Verdächtiger (im Zweifel auch nur der automatische Anrufbeantworter von Jürgen Doetz) sagt, wie schlimm die iPhone-Anwendung ist. Am vergangenen Montag reichte schon die Tatsache, dass, Zitat: „eine FDP-Kommission für Internet und Medien sich am Wochenende einstimmig gegen die Einführung eines Apps ausgesprochen hat“ für eine größere Meldung. Eine FDP-Kommission, holla!
„Spiegel Online“ kämpft ebenfalls an vorderster Front. Dort werden die öffentlich-rechtlichen Internetangebote schon seit Jahren bösartig als „GEZ-Web“ oder „GEZ-Netz“ bezeichnet. Seit Monaten ergänzt „Spiegel Online“ seine Artikel zum Thema mit einer Tabelle über die meistgenutzten deutschen Medienangebote, in denen ARD.de mit 34,5 Mio Visits auf Platz 3 liegt und tagesschau.de mit 20,2 Mio Visits auf Platz 6 — was höchst irreführend ist, weil die tagesschau.de-Visits in den ARD.de-Visits schon enthalten sind. ARD-aktuell-Chefredakteur Kai Gniffke hat das schon vor über sechs Wochen öffentlich moniert. Irgendwann vergangene Woche muss „Spiegel Online“ die Tabelle endlich korrigiert haben. Klammheimlich, natürlich. Nachtrag/Korrektur: Stimmt gar nicht. Steht immer noch so da.
Leider hat auch die ARD noch nicht verstanden, dass es nicht nur ihre Pflicht ist, in eigener Sache ganz besonders korrekt zu berichten, sondern auch eine Chance darin läge, sich unangreifbar zu machen und von der Pro-Domo-Berichterstattung anderer Medien abzusetzen, wenn sie ihren Kritikern breiten Raum geben würde. Die BBC demonstriert regelmäßig, wie das geht. Über Kritik an der BBC kann man sich zuverlässig im Online-Nachrichtenangebot der BBC informieren. Nicht so in Deutschland. Dass die „Tagesschau“ kürzlich aus Anlass des KEF-Berichtes anstelle eines journalistischen Beitrages einen PR-Bericht in eigener Sache sendete, war ein Skandal und nicht nur frech, sondern dumm.
Denn das muss man von den Öffentlich-Rechtlichen verlangen, wenn sie von uns viele Milliarden Euro jährlich bekommen: Dass sich dieser Vorteil gegenüber der privaten Konkurrenz auch in entsprechender Qualität zeigt — und dazu gehört zu allererst vorbildlicher Journalismus.
Das einzig Gute an der hysterischen Debatte ist, dass sie sich langsam dem Kern der Auseinandersetzung nähert. Früher haben sich die Konkurrenten von ARD und ZDF an irgendwelchen Kochrezept-Seiten und Kontaktbörsen der Öffentlich-Rechtlichen abgearbeitet. Nun lenkt nur noch die scheinheilige Fixierung auf die iPhone-Application davon ab, dass die Verleger auch grundsolide Angebote wie tagesschau.de nicht hinnehmen wollen. „Tagesschau“-Chef Gniffke hat Recht, wenn er schreibt:
Seit 15 Jahren gibt es tagesschau.de, seit vielen Jahren auch mobil. Soll das jetzt zurückgedreht werden? Das wäre der Tod der Tagesschau auf Raten, da muss man kein Medienexperte sein. Dann soll man aber offen sagen: Die Tagesschau soll weg, weil wir sie 60 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik nicht mehr brauchen. Diese Diskussion kann man ehrlich führen. Aber sie hinter einer Diskussion um eine Tagesschau-App zu verstecken, damit habe ich ein Problem.
Kai Biermann hat es bei „Zeit Online“ auf die schlichte, treffende Formel gebracht: Matthias Döpfner will die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen.
Ich wünsche mir starke, freie Öffentlich-Rechtliche im Netz. Ich glaube, dass sie der Qualität und der Vielfalt des Online-Journalismus gut tun können. Und ich glaube, anders als offenbar die Verleger selbst, dass gute private journalistische Angebote trotz dieser Konkurrenz bestehen können.
Vor allem aber wünsche ich mir, dass dieser Tinnitus wieder weggeht.
[Offenlegung: Ich arbeite nicht nur für Verlage, sondern gelegentlich auch für ARD und ZDF.]