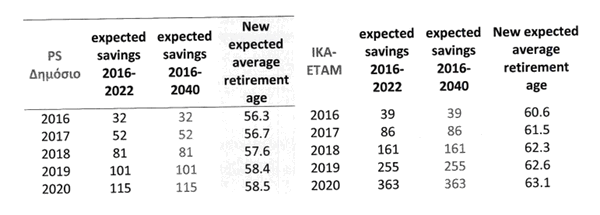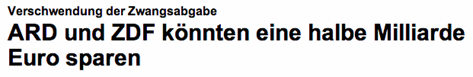Die spinnen doch, die Amis! Jetzt muss das österreichische Unternehmen Red Bull 13 Millionen Dollar an US-Amerikaner auszahlen, die sich die vermeintliche Energie-Limo seit Jahren eintrichtern, aber vergeblich darauf warten, dass ihnen so depperte Flügel an den Schultern wachsen, wie es Red Bull in der Werbung verspricht. Wächst aber gar nix! Echt jetzt! Und nun steht also fast überall, dass der Getränkehersteller die Trinker entschädigen muss.





Der Hammer, oder? Verleiht gar keine Flügel, die Plörre. Und die Klage passt so gut ins europäische Bild von diesen freakigen US-Amerikanern, die andauernd alle verklagen, weil irgendwas passiert, was man nun wirklich nicht ahnen konnte: Dass zum Beispiel der zur Legende gewordene Hamster explodiert, wenn man ihn bloß mal kurz zum Trocknen in die Mikrowelle gibt, was aber so nicht in der Gebrauchsanweisung stand, weder in der für die Mikro, noch für den Hamster.
Liest sich also gut, das mit Red Bull und den Flügeln, ist aber Unsinn. Den Slogan „Red Bull verleiht Flügel“ haben die Initiatoren der Sammelklage durchaus so metaphorisch verstanden, wie er gemeint ist: als Bild für die Leistungssteigerung, die Red Bull in der Werbung und mit Hilfe von Studien suggeriert. Den Klägern geht es also um die versprochene Wirkung, um den Effekt des Getränks.
Das Unternehmen verspreche, Red Bull steigere die Leistung, Konzentration und Reaktion, argumentieren die Kläger, dabei wirke es nicht viel mehr als eine Tasse Kaffee. Als Beleg halten sie ihrerseits eine Studie dagegen. Einer der Kläger behauptet außerdem, er trinke seit zwölf Jahren den Energy-Drink, seither habe sich aber nicht viel verbessert. Die Kläger vermissen also die in der Werbung versprochene Leistungssteigerung, nicht die Flügel.
13 Millionen Euro in einen Fonds zu zahlen, ist der Vergleich, den Red Bull bereits im Sommer einging, was aber jetzt erst zu uns rüber geschwappt ist. So kann man das auf US-amerikanischen Blogs und Websites nachlesen, auf die sich auch einige Nachrichtenseiten hierzulande beziehen. Doch meistens wird die Geschichte hier verknappt dargestellt; verknappt auf den leicht übergeschnappten US-Amerikaner, der ständig klagt – und dann auch noch Recht bekommt.
Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hat den Klägern deshalb erst mal – in dieser Logik folgerichtig – jeden Humor aberkannt: „Humorlose Kläger in Amerika“ titelt sie in ihrem Wirtschaftsteil, um dann bierernst aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus zu kommen:
So etwas gibt es auch nur in den Vereinigten Staaten: Weil der österreichische Energydrink-Hersteller Red Bull für seine angeblich leistungssteigernde Brause mit dem Slogan „Red Bull verleiht Flügel“ wirbt, haben amerikanische Verbraucher diese Losung nun wörtlich genommen. Vor einem Bundesgericht in New York strengten sie eine Sammelklage gegen Red Bull an – weil ein normaler Mensch auch nach dem Genuss einer kompletten Dose des klebrigen Süßgetränks tatsächlich immer noch nicht fliegen könne.
Genau: Nach einer Dose! Nicht fliegen! Diese Amerikaner, Mann!
In der Wirtschaftsredaktion der „Welt“ ist man auch ganz fassungslos. „Deutschland amüsiert sich“, schreibt die Zeitung gleich im Vorspann ihres länglichen Online-Textes, weil bei twitter ein paar Leute jetzt Gags über Red Bull reißen, also: ganz Deutschland. Während die „Welt“ den Amerikanern weiter unten nicht den Humor abspricht, sondern gleich die Vernunft:
Kein vernünftiger Mensch würde nach dem Genuss einer Dose des Energydrinks auf einen Felsen klettern und in die Tiefe springen, blind darauf vertrauend, dass ihm schon Flügel wachsen werden. Weiter könnte man auch argumentieren, dass kein vernünftiger Mensch auf den Gedanken käme, wegen des Ausbleibens der Flügel vor Gericht zu ziehen.
Nö, stimmt. Und kein vernünftiger Mensch käme, wenn er sich ein bisschen eingelesen hätte, auf die Idee, dass es so war. Nur eben etliche Zeitschriften und Zeitungen wie die „Welt“, die noch ein bisschen höhnt über das amerikanische Rechtssystem, wo „immer wieder Großkonzerne mit zweifelhaften Klagen“ überzogen würden, „die wider den natürlichen Menschenverstand sind“.
Kein Wunder also, dass auch das „Manager Magazin“ staunt: „Es ist einer der Fälle, die eigentlich nur in den USA passieren können“, steht dort. Und im Vorspann: „Wer seit 2002 eine Dose Red Bull in den USA gekauft und sich gewundert hat, dass ihm keine Flügel wachsen, könne nun eine Entschädigung beantragen.“
Auch schön. Richtig ist: Wer nach 2002 in den USA eine Dose gekauft hat und die suggerierte Wirkung bei sich nicht feststellen konnte, kann das (hier) beantragen und bekommt dann vielleicht etwas aus dem Fonds. Auf den Vergleich hat sich Red Bull übrigens eingelassen, um nach eigenen Angaben einen potenziell langen und teuren Prozess zu vermeiden, wie das Unternehmen der Nachrichtenagentur APA sagte. Grundsätzlich widerspricht das Unternehmen aber: „Der Red Bull Marketingansatz war immer humorvoll, wahrheitsgemäß und korrekt.“
Mit Dank an Stanz.
Nachtrag 14.10.2014, 17:48 Uhr. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Das „Manager Magazin“ hat seinen Artikel noch mal überarbeitet. Ursprünglich stand da in der Überschrift: „Red Bull kommen seine Flügel teuer zu stehen“. Und im Vorspann:
Red Bull verleiht Flügel – diesen Spruch hätte sich der Brausevermarkter in den USA vielleicht sparen sollen. Um eine Massenklage abzuwenden, stimmte Red Bull laut einem US-Blog einem Vergleich zu: Wer seit 2002 eine Dose Red Bull in den USA gekauft und sich gewundert hat, dass ihm keine Flügel wachsen, könne nun eine Entschädigung beantragen.
Da musste man natürlich noch mal ran. Die Überschrift: okay. Der erste Satz, joah: so halbrichtig. Der zweite stimmt – bis zum Doppelpunkt. Danach, die Sache mit den Flügeln: Unsinn. Und damit zur schlechten Nachricht. Das steht da jetzt in der Überschrift: „Red Bull verleiht doch keine Flügel“. Und im Vorspann:
So etwas funktioniert nur in den USA: Wer dort eine Dose Red Bull gekauft und sich gewundert hat, dass ihm keine Flügel wachsen, kann eine Entschädigung beantragen.
Naja, gut: In der Bildunterzeile steht ja auch immer noch:
Red Bull: Achtung Achtung – man kann nach dem Trinken gar nicht fliegen
Muss man nicht verstehen. Aber vielleicht kann es das „Manager Magazin“ erklären.
Nachtrag 18.10.2014. Sven Clausen, der stellvertretende Chefredakteur des „Manager Magazins“, hat mir gestern geantwortet. Er schreibt:
Wir halten unsere Formulierungen in Überschrift und Vorspann für zulässig und nicht irreführend. Wir bleiben damit im Formulierungskosmos von Red Bull, knüpfen damit also direkt an die ironische Figur des Werbespruchs an. Im Text steigen wir dann aus dieser rhetorischen Figur aus und schildern sauber und sachlich, wie der Stand der Dinge ist. Ironie ist im Nachrichten- und Analyse-Journalismus bekanntermaßen immer gefährlich, weil die Leser und User das tendenziell nicht erwarten. Im Fall von Red Bull ging das aber aus unserer Sicht, weil der Werbespruch – und damit seine ironische Aussage – so bekannt ist. Glücklicherweise hat uns die Reaktion unserer Leser bestätigt: Der Beitrag wurde gern (hohe Leserzahl) und gut (die für mm.de übliche, sehr geringe Bounce-Rate) gelesen. Beschwerden haben mich bislang nicht erreicht.