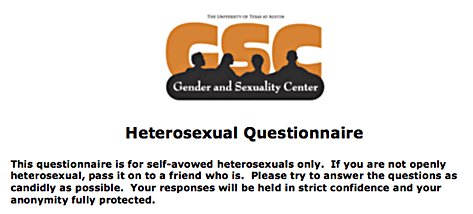Rede in der Frankfurter Paulskirche am 1. Dezember 2014 auf Einladung der Aids-Hilfe.

Foto: ARD
Im vergangenen Monat veranstaltete die ARD eine „Themenwoche“ zum Thema „Toleranz“. Der Sender warb dafür mit mehreren Motiven. Eines zeigte einen Mann im Rollstuhl mit der Frage: „Außenseiter oder Freund?“ Über einem schwarzen Mann stand die Frage: „Belastung oder Bereicherung?“ Und über einem sich zärtlich zugewandten Männerpaar die Frage: „Normal oder nicht normal?“
Als das eine Welle von Widerspruch und Empörung auslöste, musste sich ARD-Koordinator Hans-Martin Schmidt rechtfertigen. Er sagte:
„Dass die Kampagne provoziert, war gewollt, wobei der Grad der Provokation sicherlich im Auge des Betrachters variiert. Wichtig ist bei dem Thema ja, dass wir unsere Komfortzone verlassen.“
Aha, habe ich gedacht. Und mich dann gefragt: Wer ist „wir“? Wessen Komfortzone ist das? Wer sind diese Leute, die beim Thema Toleranz ihre Komfortzone verlassen müssen?
Die Leute, die Homosexualität immer noch als etwas Widernatürliches empfinden, wollte die ARD mit ihren Plakatmotiven jedenfalls nicht zu sehr in ihrer „Komfortzone“ behelligen. Die beiden Männer, die Homosexualität symbolisieren sollen, küssen sich auf dem Plakatmotiv nicht einmal auf den Mund – was doch sonst eine eher klassische Form ist, zu zeigen, dass ein Paar sich nicht nur platonisch liebt. Der eine Mann küsst den anderen bloß auf die Stirn.
Wenn man schon Homosexualtität darstellen und fragen wollte, ob sowas „normal“ ist – wäre es wirklich eine zu große Provokation gewesen, wenigstens zwei Männer zu zeigen, die sich leidenschaftlich küssen? Wäre das schon zu ungemütlich gewesen für die Leute in ihrer „Komfortzone“, denen beim Gedanken an Homosexualität nicht ganz wohl ist, und bei ihrem Anblick erst recht nicht?
Der ARD-Mann sagt, die Plakate sollten provozieren, aber für Leute, die beim Anblick eines schwulen Paares fragen, ob das normal ist, für solche Leute sind diese Plakate keine Provokation. Sie bebildern einfach ihre Vorbehalte.
Oder meinte der ARD-Mann mit dem „Wir“ uns Betroffene, die Minderheiten, die Anderen. Diejenigen, die durch ihre Andersartigkeit anscheinend die Toleranz der „Normalen“ herausfordern? Müssen wir uns aus unserer Komfortzone herausbewegen, in der wir uns in das Gefühl eingekuschelt haben, dass die meisten Menschen tolerant sind, dass es Fortschritte gibt bei der rechtlichen Gleichstellung und immer weniger Diskriminierung?
Müssen wir aus unserer Komfortzone heraus und uns damit konfrontieren lassen, dass es immer noch eine beträchtliche Zahl von Menschen gibt, die tatsächlich vom Anblick zweier schwuler Männer abgestoßen sind? Ist das die Provokation, die die Werbemotive der ARD-Themenwoche „Toleranz“ darstellen wollten? Die Konfrontation der Lesben, Schwulen, Behinderten, Einwanderer mit der harten Realität, dass es mit der behaupteten Toleranz und Akzeptanz im Alltag gar nicht so weit her ist?
— Aber das wissen wir doch. Das erleben wir doch jeden Tag. Da gibt es immer noch viel zu wenige Komfortzonen, das ist doch das Problem.
Der Begriff der Komfortzone steht noch gar nicht im Duden. Er ist so eine typische amerikanische Psycho-Metapher. Der Begriff passt ganz gut zum heiklen Begriff der „Toleranz“, die ja im Gegensatz zur „Akzeptanz“ ein Gedulden und ein Ertragen von etwas beschreibt, das man eigentlich ablehnt oder einem zumindest unangenehm ist – etwas, das mindestens außerhalb der eigenen Komfortzone liegt.
Als Floskel ist das „Verlassen der Komfortzone“ positiv besetzt: Wir sollen unsere Komfortzonen verlassen, um uns neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen, die uns menschlich, beruflich, wie auch immer, voranbringen.
Andererseits beschreibt der Begriff der Komfortzone, fürchte ich, auch sehr gut den Bereich, in den sich viele Menschen in ihrem Verhältnis Minderheiten gegenüber zurückgezogen haben. Sie sind bereit, das, was außerhalb passiert, zu ertragen, solange sie davon in ihrem Bereich nicht behelligt werden.
Ich weiß nicht, ob das eine schweigende Mehrheit betrifft oder nur eine beträchtliche Minderheit, aber mir scheint, als hätten diese Leute auf eine Art Deal gehofft. Er lautet auf Homosexuelle bezogen ungefähr so: Ihr habt doch in den vergangenen Jahren schon so viele eurer Forderungen erfüllt bekommen, jetzt gebt auch Ruhe, hört auf, uns mit weiteren Forderungen zu behelligen – und überhaupt: mit eurer Andersartigkeit.
Die Logik geht ungefähr: Ihr musstet auffallen, um gegen eure Diskriminierung zu protestieren. Nun gibt es keine Diskriminierung mehr, jetzt könnte ihr auch aufhören, aufzufallen.
Es ist der Wunsch, mit der weitgehenden Gleichstellung von Homosexuellen würden die Homosexuellen verschwinden. Das ist doppelt falsch. Es ist falsch, weil es so tut, als gebe es keine Diskriminierung mehr. Und es ist falsch, weil der Wille, sich nicht mehr verstecken und verstellen zu müssen, so zentral ist für den Kampf von Lesben und Schwulen – die Sichtbarkeit ist nicht nur Zweck, sondern auch Ziel.
Es gab im vergangenen Jahr viele Anlässe, darüber öffentlich zu reden. Zum Beispiel das Coming-Out von Thomas Hitzlsperger, als erstem prominenten deutschen Fußballspieler, wenn auch nach dem Ende seiner aktiven Zeit, und das von Tim Cook, dem Apple-Chef, als erstem amerikanischen Top-Manager. Aber die öffentliche Beschäftigung damit löste auch einen erheblichen Widerwillen bei einem Teil des Publikums aus. Menschen beschwerten sich über das Bohei, das um die Sache gemacht werde, die doch eine Privatsache sei, die man nicht in und mit der Öffentlichkeit verhandele. Sie haben nichts dagegen, dass Leute wie Hitzlsperger oder Cook schwul sind, wollen davon aber nichts wissen.
Sie missverstehen die Freude darüber, dass Menschen sich nicht mehr verstecken und verstellen und zu sich selbst stehen, und die Aufmerksamkeit, die damit zusammenhängt, dass sie die ersten in ihrem Bereich sind, mit einer Überhöhung von Homosexualität zu etwas Erstrebenswertem. Sie fühlen sich belästigt.
Über dem Diskurs liegt ein Gefühl von: Jetzt nehmt Euch mal nicht so wichtig. Und: Irgendwann muss auch mal gut sein.
Dahinter formuliert sich auch immer öfter, scheinbar aus der Mitte der Gesellschaft, eine erstaunlich selbstbewusst formulierte Ablehnung von Gleichstellung und Akzeptanz. Der frühere „Spiegel“-Ressortleiter und heutige „Welt“-Autor Mathias Matussek nennt sich stolz und höchstens viertelironisch „homophob“. Der Katzenkrimi-Autor Akif Pirincci wütet gegen die „Verschwulung“ der Gesellschaft.
Es formiert sich ein Widerstand, besonders massiv in der Frage, wie sexuelle Vielfalt in der Schule behandelt werden soll. Versuche, Homosexualität nicht nur als Form von Sexualität zu behandeln, sondern als ein Thema, das ganz selbstverständlich in allen Fächern eine Rolle spielt, werden als Versuche der „Sexualisierung“ diffamiert und als Umerziehungsversuch bekämpft. Medien – leider auch die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“, für die ich schreibe – leisten durch polemische und verfälschende Darstellungen ihren Beitrag dazu, die Diskussion zu hysterisieren und zu entsachlichen.
Der Protest kommt als Widerstand gegen vermeintliche Übertreibungen der Offenheit, Toleranz, Aufklärung daher. Aber er wirkt auch als Versuch, längst erkämpftes und sicher geglaubtes Terrain zurückzuerobern. Er nimmt mindestens fahrlässig in Kauf, dass Homosexualität wieder als etwas Anrüchiges, Gefährliches diffamiert wird. Ein anschauliches Beispiel dafür liefert die „Bild“-Zeitung, die sich – wie viele andere – an dem Pädagogik-Handbuch „Sexualpädagogik der Vielfalt“ abarbeitet, das sie „einfach widerlich und skandalös“ nennt. Sie zitiert dann die CDU-Politikerin Karin Prien: „Das ist hoch fragwürdiges, verstörendes, ideologisch verbrämtes Lehrmaterial.“ Und „Bild“ fügt hinzu:
„Was Prien, die das Ganze mit einer Anfrage aufgedeckt hat, meint: Linke Pädagogen versuchen seit geraumer Zeit, das traditionelle Familien- und Sexualbild aufzubrechen. Vielfalt steht bei ihnen dafür, dass Sexualität alle Spielarten umfasst, eben auch Homo- und Transsexualität.“
Dass Vielfalt bedeutet, dass Sexualität auch Homosexualität und Transsexualität umfasst – das ist anscheinend keine gemeinsame Grundlage der Debatte mehr. Sondern eine radikale ideologische Position linker Pädagogen.
Hier geht es nicht mehr darum, weiteren „Fortschritt“ zu stoppen. Hier geht es um Rückschritte. Plötzlich müssen sich Projekte wie SchLAu für ihre Arbeit rechtfertigen, die dem Kampf gegen Diskriminierung und Vorurteile dient – weil der Eindruck entsteht (und bewusst erweckt wird), sie machten etwas Unanständiges in den Schulen und wollten die Kinder umerziehen.
Im Frühjahr dieses Jahres eroberte Cochita Wurst die internationale Bühne, die verwirrende Persönlichkeit eines Mannes, der als Frau mit Bart auftritt. Sie gewann den Eurovision Song Contest. Es war ein Sieg der Vielfalt, der von Kommentatoren – bis hinein in den Deutschlandfunk – fassungslos als letzter noch fehlender Beweis für die völlige Degenerierung der Gesellschaft gedeutet wurde. Sie empfanden die Provokation der Figur nicht als Herausforderung von Gewohnheiten und Erwartungen, sondern als fundamentalen Angriff auf sich und auf ihre Vorstellungen von Normalität. Längst überwunden geglaubte Bekenntnisse der Scheintoleranz wurden in der Folge wieder geäußert, wie von Bela Anda, dem früheren Regierungssprecher und heutigen „Bild“-Politikchef. Er behauptete in einem Kommentar auf Bild.de: „Einige meiner besten Freunde sind homosexuell“ (und der einzige Satz, der noch trauriger ist, ist natürlich der, den seine homosexuellen Freunde sagen müssen: „Einer meiner besten Freunde ist Béla Anda.“) Und er fügte hinzu: „Ein Bart im Gesicht einer Frau, noch dazu ein Vollbart, stört mich, stört mein ästhetisches Empfinden, stört auch mein Rollenverständnis von Mann und Frau.“
Die harmlose, ganz unaggressive Figur Conchita Wurst machte deutlich, wie sehr Andersartigkeit immer noch als Bedrohung empfunden wird. Der Preis, den Lesben und Schwule nach Ansicht eines Teils der Gesellschaft dafür zahlen sollen, dass sie anerkannt werden, ist der, dass sie möglichst normal und unauffällig sein sollen. Von Trans-Menschen ganz zu schweigen.
Rational lässt sich das am Beispiel Conchita Wurst kaum fassen: Wenn ein Mann als Frau auftritt, soll er sich wenigstens den Bart abrasieren? Aber die Botschaft dahinter ist klar: Es ist eine der Pflicht zur Anpassung. Und ein – gefühlt – wachsender Unwille, sich selbst und sein Verhalten in Frage zu stellen.
Schon Ansätze, die zur Reflexion auffordern, werden als Zumutung abgetan, wie jüngst zum Beispiel ein Papier einer Gruppe, die sich die „Neuen Medienmacher“ nennen. Es soll Journalisten dazu anregen, über Sprache nachzudenken und darüber, wen sie mit bestimmten Formulierungen ausgrenzen. Das ist ausdrücklich als „Debattenbeitrag“ gekennzeichnet. Doch schon debattieren ist zuviel für Publizisten wie Henryk M. Broder, der dafür nur Häme und Verachtung hat und sich an Orwells „Neusprech“ aus 1984 erinnert fühlt.
Die vielleicht größte Zumutung zur Zeit ist eine Person namens Lann Hornscheidt, die sich nicht als Mann oder Frau definiert und entsprechend auch nicht als Professorin oder Professor angesprochen werden will, sondern als Professx. Auch über solche Sprachvorschläge kann und muss man streiten. Man darf sie selbstverständlich auch ablehnen. Aber was bestürzt, ist der Hass, der Lann Horscheidt entgegenschlägt, der Unwille, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, und der Reflex, auch in den Medien, zur Diffamierung. Es scheint da Leute zu geben, die die Herausforderung, dass es Menschen gibt, die anders sind als sie und als sie es für möglich gehalten hätten, einfach nicht ertragen.
Lann Horscheidt wirkt im Vergleich zu ihren Gegenspielern verblüffend wenig radikal. Vor allem, wenn er oder sie formuliert, dass es doch eine Bereicherung sei, auf andere Sichtweisen, fremde Lebenswelten, unbekannte Blicke auf die Welt zu stoßen, sich darauf einzulassen und damit auseinanderzusetzen.
Andersartigkeit zunächst einmal als Bereicherung empfinden, nicht als Zumutung. Warum sollten unsere Komfortzonen so eng zugeschnitten sein, dass wir sie verlassen müssen, um Vielfalt zu akzeptieren?
„Wichtig ist, dass wir unsere Komfortzone verlassen“, hat der ARD-Toleranz-Beauftragte gesagt. Im Rahmen dieser Themenwoche fand dann im HR-Fernsehen auch eine Diskussion mit dem selbsterklärten „homophoben“ Matthias Matussek statt. Und der Moderator und Redaktionsleiter Meinhard Schmidt-Degenhard rechtfertigte sich hinterher noch mit dem Satz: „Meines Wissens ist Homophobie nicht zwangsläufig menschenverachtend.“
Aus dieser Komfortzone werden wir gerade gründlich vertrieben: aus dem Glauben, dass wir hinter bestimmte Standards nicht mehr zurückfallen würden.

Symbolfoto: ARD