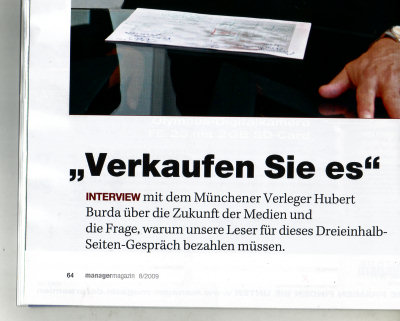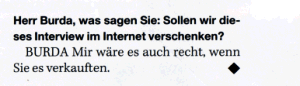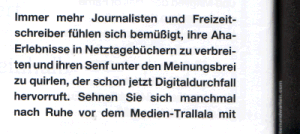„Papier ist geduldig.“
(früheres Sprichwort)
 Vorweg sollte ich sagen, dass das neue Jahrbuch des Verbandes der Zeitschriftenverleger (VDZ) auf schwerem, hochwertigem Papier gedruckt ist. An der Qualität der Texte kann also überhaupt kein Zweifel bestehen.
Vorweg sollte ich sagen, dass das neue Jahrbuch des Verbandes der Zeitschriftenverleger (VDZ) auf schwerem, hochwertigem Papier gedruckt ist. An der Qualität der Texte kann also überhaupt kein Zweifel bestehen.
Und doch wird jemand, der versucht, sich mit Hilfe dieser Essays von Geschäftsführern führender Verlage ein Bild vom Zustand dieser Branche zu machen, ratlos zurückbleiben. Im Vorwort blickt der Verbandspräsident Hubert Burda auf ein „erfolgreiches Jahr 2009“ zurück und findet: „Wir haben allen Grund, selbstbewusst zu sein“.
Auch wenn wir uns von den hohen Renditen der letzten Jahrzehnte verabschieden müssen, bleibt Print ein höchst lukratives Geschäftsmodell, vorausgesetzt, es ist klug gemanagt.
Auf den nächsten gut 200 Seiten aber wechseln solche Lobreden auf die Zukunftsfähigkeit des Geschäftes mit dem Drucken und Vertreiben von Inhalten auf Papier sich mit Beschwörungen ab, dass sein Ende unmittelbar bevorsteht, wenn nicht sofort diverse Gesetze geändert, Steuern erlassen, Konkurrenten ausgeschaltet und Subventionen beschlossen werden.
Das Jahrbuch zeichnet das schizophren anmutende Bild einer Branche, die gleichzeitig demonstrieren will, dass es ihr bestens geht (und all die Todesprognosen verfrüht sind) und dass sie im Sterben liegt (und also alle alles tun müssen, was sie sagt). Es ist eine Branche, die vollkommen davon überzeugt ist, unverzichtbar zu sein, und fassungslos feststellen muss, dass nicht alle die gleiche Überzeugung haben.
Passenderweise wird der VDZ von einem Mann geführt, der Hysterie und Propaganda für angemessene Reaktionen auf eine komplexe Gemengelage hält. Wolfgang Fürstner arbeitet sich in seinem Essay noch einmal an der geplanten Aufbereitung der Inhalte von tagesschau.de auch für das iPhone ab – und hat sich von Jürgen Doetz, der als Cheflobbyist der Privatsender jahrzehntelang gegen ARD und ZDF gekämpft hat, leider immer noch nicht die Grundbegriffe für diese Auseinandersetzung erklären lassen.
Fürstner schreibt:
Zur Erinnerung: Die Idee der Grundversorgung entstammt den fünfziger Jahren, als es noch Frequenzmangel gab, und sie war ein Versuch, einen Mindeststandard zu setzen.
Das hat er fast wörtlich im Januar schon der „Welt“ gesagt und ist falsch. Den Begriff der Grundversorgung hat das Bundesverfassungsgericht 1986 in seinem Vierten Rundfunkurteil geprägt, und er bezeichnet gerade nicht einen Mindeststandard, sondern die umfassende Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, „für die Gesamtheit der Bevölkerung“ Programme zu bieten, und zwar Information, Bildung und Unterhaltung. Dahinter stand, dass das Gericht privat finanziertem Rundfunk dies nicht zutraute. ARD und ZDF sollten nicht die Lücken füllen, die die Privaten ließen, sondern ein vollwertiges Programm machen dürfen und müssen, das alle Ansprüche erfüllt. Das meint der Begriff „Grundversorgung“.
Wolfgang Fürstner kennt nicht einmal die Grundlagen des Dualen Systems, will aber der Politik und der Öffentlichkeit erklären, wie es auszusehen habe.
Nun hätte ich aber vermutlich kein Wort über das VDZ-Jahrbuch verloren, wenn ich darin nicht auf das Gedicht den Beitrag „Das gedruckte Wort ist wie ein Kuss“ gestoßen wäre, verfasst von Wolfram Weimer, dem ehemaligen Chefredakteur von „Cicero“ und neuen Chefredakteur von „Focus“.
Sein Text beginnt wie folgt:
Riechen Sie lieber an einer Blume oder am Bild einer Blume? Erleben Sie lieber einen Sonnenuntergang mit Grillenzirpen aus den Dünen und Sand zwischen den Zehen oder reicht Ihnen der Film eines Sonnenuntergangs? Lieben Sie lieber ohne zu küssen?
Man kann lieben ohne zu küssen, aber warum sollte man? Die Blume und der Kuss sind wie das gedruckte Wort. Sie sind, sie werden nicht, sie sind, das macht sie so faszinierend.
Jawohl, das ist allen Ernstes der Beginn eines Plädoyers, warum gedruckte Inhalte elektronischen Inhalten überlegen sind. (Fairerweise muss ich sagen, dass Sie die ganze Pracht seiner Argumentation hier im Blog natürlich nicht erkennen können. Sie müssten den Text bitte ausdrucken.)
Das „Pic“ von der Blume, das downgeloadete Onlinevideo vom schönsten Sonnenuntergang auf Tonga, der elektronische „Hug“ auf dem Flirtportal haben tausend Vorteile, aber einen entscheidenden Nachteil: sie sind flüchtig. Das virtuelle und das gedruckte Wort sind daher in Wahrheit keine Konkurrenten, weil sie sich auf unterschiedliche Kategorien des Lebens und Lesens beziehen. Das gedruckte Wort wird vom Internet so wenig verdrängt wie der Apfel von der Vitamintablette.
Das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Andererseits ist es so offensichtlich falsch, dass ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt irgendwo anfangen soll.
Zunächst beschreibt Weimer den Unterschied zwischen einem realen Gegenstand oder Erlebnis und seiner Abbildung oder Beschreibung. Dann tut er so, als sei das gedruckte Wort mit dem eigenen Erleben identisch und das digital veröffentlichte Wort mit seiner Beschreibung. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Versuch einer Gehirnwäsche ist oder ihr Ergebnis.
Und dann weitet er den bekannten Irrtum, Online für ein flüchtiges Medium zu halten, auf elektronische Inhalte insgesamt aus – was besonders absurd ist. Schon das Foto von der Blume ist im Gegensatz zur echten Begegnung mit ihr eben gerade nicht flüchtig. Und zumindest in meinem Leben ist auch das elektronische „Pic“ (wie Weimer es mit spitzen Fingern nennt) deutlich weniger flüchtig als der Papierabzug, weil ich den gerne mal verliere. Und man kann, wenn man will, viel gegen den „elektronischen ‚Hug'“ sagen – ein entscheidender Vorteil ist, dass ich ihn mir immer wieder ansehen kann, im Chatprotokoll oder meiner Facebook-Historie.
An der behaupteten Flüchtigkeit des Internets hängt ein Großteil der Argumentation Weimers – und offenbar der Zukunft der Print-Branche. Weimer schreibt:
Das Flüchtige wird in den flüchtigen Medien ein Zuhause finden. Das Relevante aber wird immer nach Gravitation streben.
Sie ist wirklich so schlicht, die Welt der Print-Ideologen: Was schwer wiegt braucht ein schwer wiegendes Medium. Virtuelle Inhalte haben in doppeltem Sinne kein Gewicht.
Dabei ist es schon in einem ganz praktischen Sinne genau umgekehrt mit der Flüchtigkeit: Versuchen Sie mal den Inhalt des Artikels einer Zeitung von gestern herauszufinden. Wenn er online steht, können sich Menschen mühelos auch morgen und nächste Woche noch darauf beziehen und darüber diskutieren.
Die behauptete unterschiedliche Flüchtigkeit der Medien hat immerhin einen wahren Kern: Gute Zeitungen zum Beispiel werden so gemacht, dass sie verlässlich sind, Autorität und Bestand haben. Dass zukünftige Generationen auf sie zurückgreifen können als Dokumentation von Geschichte. Im Englischen gibt es dafür den schönen Begriff „Newspaper of record“. Richtig ist, dass viele Online-Medien nicht mit diesem Anspruch gemacht werden, sondern auf die Schnelle, für den Tag. Ich behaupte aber, dass das nicht im Medium selbst begründet ist, sondern an dem, wie es nicht zuletzt die Verlage nutzen. So gesehen ist es fast eine Frechheit, wenn Weimer von der „zirkusähnlichen Gestalt“ des Medienbetriebs in elektronischen Medien schreibt und „Klickgalerien für Bikini-Outfits“ als typisches Beispiel nennt. Was für eine geschickte Aufteilung: Erst gehen die Verlage in einen ruinösen Wettbewerb um die dümmsten Klickstrecken. Dann verweisen sie auf sie, um die Notwendigkeit ihrer Print-Produkte zu legitimieren.
Aber zurück zu Weimers oben zitierten Vergleich: Print ist der Apfel und Online die Vitamintablette, also nur eine künstliche Nachahmung der natürlichen, echten Sache? Ja, und Weimer hat noch mehr Beispiele:
In den sechziger Jahren gab es Science Fictions, die das Ende des herkömmlichen Essens vorhersagten. Es werde gesundheitsperfekte Pillen, ästhetisches Designerfood und technische Ballaststoffe mit Geschmacks- und Aromastoffen geben. Keiner werde mehr natürliche Früchte, fettes Fleisch, verderbliches Gemüse wollen. Weit gefehlt. Obwohl wir uns längst künstlich ernähren könnten, werden wir weder auf den Geruch von Omas Apfeltorte verzichten noch auf das Erlebnis einer platzenden Traube im Mund.
Für Leser, die es weniger anschaulich und mehr intellektuell lieben, spricht Weimer später auch von der „strategischen Chance von Printmedien als Heimstatt der Eigentlichkeit“: „Print ist (…) nicht nur der Form nach wirklicher als elektronische Medien, auch dem Print-Inhalt wird die Wirklichkeitsnähe stärker zugesprochen.“
Dass wir uns „in immer rascheren Abfolgen mit Scheinskandalen beschäftigen“, liegt laut Weimer natürlich auch am „hastigen Überschlag des Elektronischen“. Als Beispiele, wie wir „von einer Panik in die andere jagen“, nennt er:
Vorgestern das Waldsterben, die Kampfhunde und Sars, gestern Feinstaub, BSE und Vogelgrippe, heute die Klimakatastrophe und die Schweinegrippe – der Alarmismus prägt die Multimediademokratie.
Wenigstens bei der Angst vor dem Waldsterben, die aus einer Zeit stammt, als es noch kein World Wide Web, ja noch nicht einmal nennenswert privaten Rundfunk in Deutschland gab, hätte er doch merken müssen, dass Printmedien diesen Alarmismus ganz gut alleine hingekriegt haben – und was wäre die Panikmache in den Fällen Kampfhunde, Sars, Vogel- und Schweinegrippe ohne das Zutun der gedruckten „Bild“-Zeitung gewesen?
Ich würde mich nicht so lange an diesem Essay abarbeiten, das vermutlich ohnehin außer mir kaum jemand gelesen hätte, weil solche Jahrbücher mit ihrem schönen, schweren Papier doch eher dafür gemacht sind, dass man sie ungelesen ins Büroregal stellt, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es in erstaunlicher Deutlichkeit zeigt, wie irreal das Weltbild dieser Leute geworden ist und wie fern ihnen immer noch die Binsenweisheit ist, dass guter Journalismus nicht davon abhängt, ob er in analoger oder digitaler, gedruckter oder elektronischer Form vorliegt.
Am Ende wagt Weimer noch einen anderen Vergleich:
Ich plädiere daher für mutige Investitionen unserer Verlagshäuser in ihre Kernprodukte. So wie die Autoindustrie seit Jahrzehnten totgesagt wird, so investiert sie doch immer wieder in neue Modelle und in die Verbesserung ihrer Autos. Sie flüchten nicht in den Flugzeugbau, den Bahn- oder Schiffsbetrieb, noch glauben sie ernsthaft daran, dass Geschäftsreisen verschwinden, nur weil Online-Konferenzen möglich sind.
Mag sein, nur wären sie schlecht beraten, wenn sie glaubten, auch in Zukunft müssten Autos mit Benzin angetrieben werden, und anstatt neue Antriebswege zu entwickeln, den Menschen Vorträge darüber halten würden, dass der Otto-Motor das Maß aller Dinge ist — und ein Fahrzeug ohne ihn wie die Liebe ohne den Kuss wäre.
 Vorweg sollte ich sagen, dass das neue
Vorweg sollte ich sagen, dass das neue