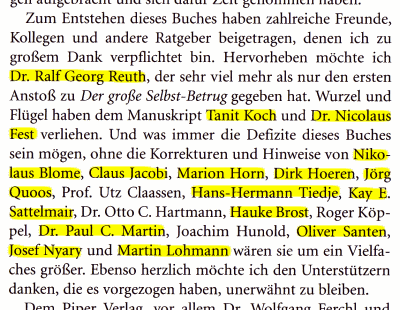„Was sagen Sie zu Katharina Blum“, fragt eine Frau aus dem Publikum spitz, als hätte Heinrich Böll seine Erzählung über eine fiktive große deutsche Boulevardzeitung, die mit ihrer Berichterstattung eine Frau zur Mörderin werden lässt, gerade erst veröffentlicht. Kai Diekmann, Chef der realen großen deutschen Boulevardzeitung, im blauen samtartigen Anzug mit rosa Hemd ohne Krawatte, ist nicht beeindruckt. „Ich weiß nicht, wann Sie das Buch zum letzten Mal gelesen haben“, fragt er in die Runde einflussreicher Hamburger Kaufleute, denen er gerade den „Erfolg der Marke BILD“ erklärt hat. „Ich habe es vor zwei Jahren getan.“ Und er müsse sagen: Immerhin habe Katharina Blum ja einen Terroristen versteckt! „Ich kann bis heute nicht verstehen, was falsch daran sein soll, dass man sich mit einer solchen Figur publizistisch beschäftigt.“ Er halte die geschilderten journalistischen Methoden für „völlig zulässig“.
Die Antwort ist typisch für Kai Diekmann: Sie ist nicht grüblerisch und defensiv, sondern selbstbewusst und angriffslustig, überraschend, unterhaltsam und beim Publikum erfolgreich.
Und falsch. Denn der Mann, den Katharina Blum versteckt, ist kein Terrorist. Er wird nur verdächtigt, einer zu sein. Für alle, die den Unterschied nicht verstehen, hat Böll in einem Nachwort später hinzugefügt: „Es gibt in dieser Erzählung keinen einzigen Terroristen.“ Was es allerdings gibt, in seiner Erzählung, ist ein Reporter, der Tatsachen erfindet und verdreht, der lügt und verleumdet, der der Blum vorschlägt, „dass wir jetzt erst einmal bumsen“, und ihre Mutter sehenden Auges in den Tod treibt.
Vermutlich sollte man Kai Diekmann also in seinem eigenen Interesse nicht glauben, wenn er sagt, dass er an diesen, nun ja: fiktiven Recherchemethoden nichts auszusetzen habe. Sicher hat er das nur gesagt, weil es in diesem Moment die eindrucksvollste Antwort war. Da unterscheidet sich der Chefredakteur nicht von seiner Zeitung, die auch die Wahrheit im Zweifelsfall so optimiert, dass sie kurzfristig besonders eindrucksvoll wirkt.
· · ·
Die Episode ist aus dem Jahr 2006. Sie stammt aus einem längeren Text über Kai Diekmann, den ich im Auftrag des „SZ-Magazins“ geschrieben habe, das ihn dann aber nicht drucken wollte.
Heute kommt mir das unveröffentlichte Stück von damals merkwürdig aktuell vor. Denn die Methode des „Bild“-Chefredakteurs, die ich darin zu beschreiben versuche, hat er in den vergangenen 99 Tagen in seinem Blog, das er am Mittwoch wieder abschalten will, auf die Spitze getrieben.
Damals fragte ich mich, ob das vielleicht eine Berufskrankheit ist: Vielleicht lässt einen die Macht, die man als „Bild“-Chef täglich erlebt und demonstriert, größenwahnsinnig werden. Vielleicht verliert man im täglichen Spiel mit Halb- und Viertelwahrheiten irgendwann den Überblick. Vielleicht muss der Chefredakteur einer Zeitung, die einen Politiker angreift, weil er angeblich „Geld mit ‚tabulosen Girls‘ macht“, und auf derselben Seite eine dreistellige Zahl von Anzeigen von tabulosen Girls druckt, zu einem gewissen Grad schizophren werden. Kai Diekmann sagt, „nur Moralisten können gute Journalisten sein“.
Heute würde ich Diekmanns Schizophrenie nicht mehr als „Berufskrankheit“ bezeichnen. Sie ist sein Erfolgsrezept.
· · ·

Screenshot: kaidiekmann.de
Im Journalismus gilt im Zweifelsfall die alte Kobold-Regel: Was sich reimt, ist gut. Und weil Kai Diekmann seine Kritik an der „Süddeutschen Zeitung“ und der Jury des „Medium Magazin“ in seinem Blog in Form einer Büttenrede vortrug, ging eine kleine La-Ola-Welle durch die Fachpresse. Faziniert dokumentierten „Meedia“, „Turi2“, „DWDL“, und „w&v“ die Rede im Wortlaut, und keiner fragte, ob das überhaupt stimmt, was er sich da zusammenreimt.
Es ging um die Frage, auf wessen Konto die wichtigere Enthüllung über den Einsatz der Bundeswehr gegen die von den Taliban entführten Tanklastzüge in Kundus ging: „Bild“ oder die „Süddeutsche Zeitung“. Das ist eine Frage, die außerhalb der kleinen Journalistenwelt nur wenige interessiert. Aber Kai Diekmann hätte gerne, dass sein Blatt neuerdings als Ort für investigative Recherche respektiert wird. Dabei geht es nicht nur um die Auszeichnung „Journalist des Jahres“ des „Medium Magazins“, sondern auch um den „Henri-Nannen-Preis“, den der „Stern“ und Gruner+Jahr im Mai wieder vergeben — und nach Möglichkeit nicht an „Bild“ vergeben möchten. Hinter den Kulissen geht es da wohl schon rund.
Jedenfalls beschloss das „Medium Magazin“, in Sachen Kundus einen „Sonderpreis für politische Berichterstattung“ zu vergeben. An Stefan Kornelius, weil er in der „Süddeutschen Zeitung“ am 12. Dezember 2009 entscheidende Details des „Schlüsseldokuments in der Aufklärung des Bombardement-Befehls in Kundus/Afghanistan“ öffentlich gemacht habe: dass der Angriff laut dem geheimen Bericht von ISAF-Kommandeur Stanley McChrystal nicht den Fahrzeugen galt, sondern den Menschen.
Diekmann kotzte. Seiner Meinung nach hätte die „Bild“-Zeitung diesen Preis verdient, weil sie (als Teil einer PR-Kampagne für den neuen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg) zwei Wochen zuvor Details aus einem anderen Bericht öffentlich gemacht hatte, die zu mehreren prominenten Rücktritten führten. „Bild“ enthüllte auf der Grundlage eines Feldjägerberichtes, dass Oberst Georg Klein vor dem Befehl zum Angriff zivile Opfer nicht ausschließen konnte und Informationen über solche Opfer frühzeitig vorlagen.
Nun kann man darüber streiten, welche der beiden Zeitungen damit den größeren, den wichtigeren Beitrag zur Aufklärung über den konkreten Angriff und die Natur des Bundeswehr-Einsatzes insgesamt geleistet hat. Unbestreitbar ist allerdings, dass das, was Kornelius in der SZ berichtete, eine Neuigkeit war, die er aus „Bild“ schon deshalb nicht abschreiben konnte, weil sie nicht in „Bild“ stand.
Genau diese Lüge aber verbreitet Diekmann in seiner Büttenrede:
Denn die Recherche war echt schwer.
Zum Kiosk hin in München-Mitte
„Einmal die Bild — doch heimlich, bitte“ (…)So wurde aus der Bild-Geschichte,
Gewinn für Münchner Leichtgewichte.
Doch trotz der Kränze, Freudenmärsche
Ein Makel haftet der Recherche:
Denn für die Infos floss a Geld
An irgendeinen Kiosk-Held.
Denn für die Bild, da muss man blechen
Will man kopieren, kostets Zechen.
Dass das eine Verleumdung ist, hat aber keinen interessiert. Viel wichtiger ist doch: Geil. Der Diekmann. Reimt. Höhö.
· · ·
Als Kai Diekmann mit dem Bloggen begann, habe ich mich gefragt, was wohl der Auslöser für ihn war, plötzlich zum Selbstdarsteller zu werden. In den Jahren zuvor hatte er sich nicht in die Öffentlichkeit gedrängt, im Gegenteil. Er ist nicht durch die Talkshows getingelt, ging nur einmal in eine Gesprächssendung des SWR, deren Moderatorin Birgitta Weber sich gleich mehrere Schichten Samthandschuhe übereinander angezogen hatte. Er mied Auftritte, bei denen mit allzu kritischen Fragen zu rechnen war. Nach einer Podiumsdiskussion beim ökumenischen Kirchentag 2003, bei der das Publikum nicht auf seiner Seite war, soll er diese Entscheidung gefällt und gesagt haben: „Wenn ich da keine Chance habe, mache ich das nicht mehr.“
Die Konfrontation meidet er nach wie vor. Alle Anfragen, öffentlich mit jemandem von BILDblog zu diskutieren, lehnt er immer noch ab. Aber mit einem Mal tourt er durch die Medien, wird scheinbar zum Showmann, den man fast mit seinem langjährigen Freund Dieter Bohlen verwechseln könnte. Was ist da passiert?
· · ·
Womöglich nicht viel. Vielleicht ist es gar nicht erstaunlich, dass Diekmann plötzlich eine Unterhaltungsoffensive als Kommunikationsstrategie für sich entdeckte. Vielleicht ist das Erstaunliche, dass er so lange dafür gebraucht hat.
In gewisser Weise hat sich mit dem Diekblog ein Kreis geschlossen. Als wir vor fünfeinhalb Jahren mit BILDblog anfingen, wehrten wir uns vor allem gegen die weit verbreitete Haltung, die „Bild“-Zeitung als „lustiges Quatschblatt“ zu lesen; zu sagen: Hey, das ist doch lustig, ist doch egal, ob das stimmt, geile Überschrift jedenfalls. Man amüsierte sich auf einer ironischen Metaebene mit „Bild“ und übersah dabei die Folgen ihrer journalistischen Fehler, die ethischen Abgründe und die Opfer, die „Bild“ produzierte.
Genau diese Haltung hat sich Diekmann mit seinem Blog wieder zunutze gemacht. Er hat gemerkt, dass es eine viel bessere Möglichkeit gibt, sich kritischen Nachfragen zu entziehen, als sich hinter der Schweigemauer der Springer-Pressestelle zu verstecken: nämlich die Journalisten durch Unterhaltsamkeit und Unberechenbarkeit von den Inhalten abzulenken.
· · ·
Diekmann beherrscht eine Art Zaubertrick. Sein Standard-Vortrag, mit dem er vor drei Jahren vor ihm gewogeneren Zuschauern auftrat, war in weiten Teilen ein Appell zur Selbstkritik. Er sagte darin Sätze wie: „Beim Boulevard ist Haltung und der Mut, Fehler einzugestehen, besonders wichtig.“ Er zählte dann viele, viele Fehler auf. Kein einziger war von ihm.
Und wer nicht genau aufgepasst hat, ging mit dem Gefühl nach Hause, dass dieser Diekmann ein wirklich vorbildlich selbstkritischer Journalist ist, ohne dass er es tatsächlich sein musste.
· · ·
Ich habe bis heute nicht verstanden, warum so viele Kollegen meinen, Diekmanns Blog sei „selbstironisch“. Ja, gelegentlich demonstriert er eine gutgelaunte Distanz zu sich selbst, und manchmal karikiert er auch die Karikatur, die seine Kritiker von ihm zeichnen. Aber das waren nur Spurenelemente und Ablenkungen in einem Blog, das im Wesentlichen dazu diente, mit seinen Gegnern abzurechnen. Man muss schon sehr geblendet sein von der bunten, fröhlichen, spielerischen Oberfläche des Ganzen (und dem unbestreitbaren Charme seines Namensgebers), um hinter der Fassade einen lockeren Spaßmacher zu sehen und nicht einen rachsüchtigen Mann mit Macht, der mindestens fünfstellige Rechtskosten in Kauf nimmt und nehmen kann, um seine Gegner anzugreifen.
· · ·
So funktioniert Journalismus heute, und natürlich nicht nur in diesem Fall: Politik wird von den Massenmedien vor allem als Sympathie- und Schönheits-Wettbewerb wahrgenommen und inszeniert (die Überhöhung Guttenbergs ist gutes Beispiel). Ganz ähnlich reduzieren die klassischen Medien die Auseinandersetzungen, die Diekmann in seinem Blog angezettelt hat, auf Boxkämpfe, bei denen sie ihre Aufgabe darin sehen, die Treffer zu zählen und Haltungsnoten zu verteilen. Als Diekmann sich an der „taz“ abarbeitete, war er von einer virtuellen Traube von Schaulustigen umringt, die ihn anfeuerten, während er einen Treffer nach dem anderen landete, und sein Gegner orientierungslos vor sich hintaumelte und sich noch nicht einmal über die Kampfregeln im Klaren war. Nun war die Art, wie sich die „taz“ von Diekmann vorführen ließ (und vor allem den Fehler machte, sich überhaupt auf seine Art von „Spiel“ einzulassen), sicher keine Glanzstunde für die alternative Tageszeitung. Aber es war auch ein ungleicher Kampf: Auf der einen Seite eine Vielzahl von Idealisten, die Überzeugungen haben und in aufreibenden Debatten dafür kämpfen, das Richtige zu tun. Auf der anderen Seite die selbstgeschaffene Kunstfigur eines Chefredakteurs, der keine Skrupel hat und keine Werte kennt; der heute das Gegenteil von dem tun kann, was er gestern gefordert hat; der keinen Ruf zu verlieren hat.
Wer in diesem Kampf besser aussehen würde, war von vornherein klar.
Oder die Auseinandersetzung mit dem Berliner Rechtsanwalt Johannes Eisenberg. Natürlich kann man interessiert das juristisch-publizistische Ping-Pong-Spiel verfolgen und sich, wenn man will, darüber amüsieren, wie Diekmann Eisenberg immer wieder mit dem Stinkefinger provoziert. Aber man kann doch darüber nicht vergessen, was den Kern des Verhältnisses ausmacht: Eisenberg ist deshalb Diekmanns Gegner, weil er regelmäßig erfolgreich Menschen vertritt, die Opfer der Methoden der „Bild“-Zeitung wurden. Und weil er Diekmann bei dessen Versuch, die „taz“ wegen einer Satire zu einem Schmerzensgeld zu verurteilen, eine empfindliche Teil-Niederlage zugefügt hat. Das versucht „Bild“ dem Rechtsanwalt seit Jahren heimzuzahlen.
Dieser Hintergrund spielt aber gar keine Rolle mehr bei der Kommentierung des von Diekmann angezettelten Kampfes, als dessen Sieger er ohnehin feststeht. Wenn er juristisch verliert, gewinnt er, dass er sich als Opfer inszenieren kann.
· · ·
Man muss Diekmann dazu gratulieren, wie erfolgreich seine Strategie war und wie sehr ihm die unterhaltungssüchtigen Journalisten auf den Leim gegangen sind. Er steht nun sogar tatsächlich als Kämpfer für das unbedingte Recht auf Satire da, was sehr abwegig ist, nicht nur, weil er selbst noch vor wenigen Monaten einen Volontär teuer abmahnen ließ, der in harmlos-satirischer Form sein Foto verwendete, um als „DerChefred“ zu twittern.
Das Spiel ist fast erschütternd leicht: Diekmann muss nur plötzlich nach Jahren des Schweigens einen winzigen Bruchteil seiner Fehler zugeben, um für seine Offenheit gefeiert und mit dem Rest nicht mehr behelligt zu werden. Natürlich ist es eine tolle Idee, wenn sich Diekmann eine Mini-Kamera auf die Brille montieren lässt und seinen Arbeistag filmt und veröffentlicht. Und er muss nicht einmal die Stelle herausschneiden, in der man sieht, wie eine Schlagzeile formuliert wird, von der der Chef selbst annimmt, dass sie falsch ist. Der Aufmerksamkeitswert der Kamera-Aktion an sich ist viel größer ist als das, was man dadurch tatsächlich erfährt.
· · ·
Vor drei Jahren schrieb ich: Der ganze Größenwahn der „Bild“-Leute, sich alles erlauben zu können, verbindet sich mit einem Minderwertigkeitskomplex, von niemandem wirklich gemocht oder geschätzt zu werden. Fragt man Leute, die ihn ein bisschen kennen, was Diekmann eigentlich antreibt, ob er Macht will, die Welt verändern, berühmt werden, sagen einige auch: Er will geliebt werden. Er kann sich mit den ganzen Wichtigen schmücken, die mit ihm reden, aber wie viele davon tun es wirklich freiwillig und gerne? Natürlich kann ein „Bild“-Chef eigentlich nicht geliebt werden. Natürlich weiß Diekmann das auch. Aber das Wissen genügt halt nicht immer.
Das war der Stand damals. Mit dem Bloggen hat er sich einen Traum erfüllt. Jetzt wird er ein bisschen geliebt und musste dafür nicht einmal ein besserer Mensch werden.