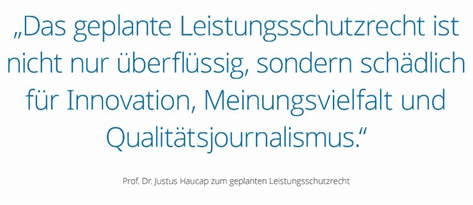Frank Schirrmacher brauchte nur einen einzigen ironischen Satz, um deutlich zu machen, wie wenig erstrebenswert eine Zukunft ist, in der es keine Zeitungsverlage mehr gibt, sondern in der „Konsumhersteller ihre eigenen Nachrichten produzieren“:
Wir freuen uns schon, wenn Apple über die Arbeitsbedingungen in China berichtet oder Coca-Cola über die Segnungen der Globalisierung.
Ja, das ist ein guter Test für die Qualität, für die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit eines Mediums: Wie es mit Themen umgeht, die es selbst betreffen.
Die deutschen Zeitungen versagen gerade in spektakulärer Weise bei diesem Test. Sie demonstrieren jedem, der es sehen will, dass sie uns im Zweifel nicht zuverlässiger informieren, als es irgendein dahergelaufener amerikanischer Konsumhersteller täte.
Es ist eine bittere Ironie, dass sie diesen Beweis im Kampf für ein Gesetz liefern, dessen Notwendigkeit sie im Kern damit begründen, dass sie als zuverlässige Informanten der Bürger unverzichtbar und unersetzbar sind.
· · ·
Am Donnerstag lobte die FAZ in einem Artikel den „virtuosen Eiertanz“, den die „New York Times“ gerade in ihrer Berichterstattung über die Skandale bei der BBC vollbringt. Mark Thompson, der darin verwickelte frühere Generaldirektor der BBC, ist nämlich seit kurzem Vorsitzender der Geschäftsführung der „New York Times“. „Dem amerikanischen Verständnis von journalistischer Objektivität entspricht es“, staunte FAZ-Korrespondent Patrick Bahners, „dass ein Presseorgan eigene Angelegenheiten in gleicher Form darstellt wie die Geschäfte Dritter.“
Meinem Verständnis von journalistischer Objektivität hätte es entsprochen, wenn die deutsche Presse versucht hätte, ihre Leser fair, umfassend und zutreffend über das geplante Leistungsschutzrecht für Verlage zu informieren. Ich hätte es für selbstverständlich gehalten, sich darum zu bemühen, dass die nachrichtliche Berichterstattung in eigener Sache bzw. über einen unmittelbaren Konkurrenten oder Gegner ganz besonders unangreifbar ist.
Auf der Grundlage einer solchen ausgewogenen, sachlichen Darstellung könnten die Redaktionen dann natürlich Kommentare veröffentlichen, in denen sie für die eigene Position werben, die anscheinend mit der ihrer Verleger identisch ist (auch wenn ich mir als Leser vermutlich trotzdem wünschen würde, dass sie ohne den Kniff auskämen, das konkurrierende Unternehmen gleich als einen Agenten Amerikas zu dämonisieren).
Meinem Verständnis von gutem Journalismus hätte es entsprochen, die Gegenseite mindestens so ausführlich zu Wort zu kommen wie die eigene Seite, und zum Beispiel Gastkommentare nicht ausgerechnet von denen schreiben zu lassen, die ohnehin meiner Meinung sind. Das wäre kein Zeichen von Masochismus, sondern von Selbstbewusstsein. Und es würde beim Leser offensiv den möglichen Verdacht ausräumen, dass man ihm in einer solchen Situation abweichende Meinungen oder unliebsame Tatsachen verschweigt, wie man es offenbar von Apple und Coca-Cola erwarten muss.
(Dass das nicht ausschließt, sich kritisch mit Google und seinen höchst beunruhigenden Geschäftspraktiken auseinanderzusetzen, versteht sich von selbst.)
Stattdessen haben sich weite Teile der deutschen Presse dafür entschieden, Propagandaorgane in eigener Sache zu sein. Sie sehen es als ihre Aufgabe, dazu beizutragen, dass sie ihr Leistungsschutzrecht bekommen. Sie sehen es nicht als ihre Aufgabe, die Bürger gut zu informieren.
Nun kann man mir natürlich Naivität vorwerfen, dass ich etwas anderes erwartet hatte. Das ändert aber am Ergebnis nichts: Die deutschen Zeitungen haben genau den Test nicht bestanden, anhand dessen die Untauglichkeit möglicher Ersatz-Verleger wie Apple und Coca-Cola dargestellt werden sollte. Sie haben ihre eigenen Leser verraten, als würden sie die nicht mehr brauchen, wenn sie nur Google besiegen könnten.
Es findet keine kritische Berichterstattung statt über die Verleger-Kampagne und ihre Lobby-Arbeit, über die U-Boote, die in die Debatte geschmuggelt werden, über die würdelose Praxis, dass Chefredakteure zu nickenden Stichwortgebern ihrer eigenen Geschäftsführer werden, über das erbärmliche Agieren des früheren Journalisten Christoph Keese, der in dieser Sache als Sprecher der gesamten deutschen Verlagsbranche auftritt und sich offenbar entschlossen hat, dass die Wahrheit in diesem Kampf nicht sein Verbündeter ist.
· · ·
Neulich habe ich die Journalismus-Krisen-Berichterstattung der „Zeit“ kritisiert und als „Wohlfühljournalismus“ bezeichnet. In seiner Erwiderung verteidigte Chefredakteur Giovanni di Lorenzo nicht nur ausdrücklich einen solchen „Wohlfühljournalismus“. Er beschwerte sich zudem:
Man könnte ja auch sagen, dass wir weniger für die ZEIT, sondern für die ganze Branche eine recht ordentliche Titelgeschichte hinbekommen haben.
Ja, das hätte man auch sagen können. Ich wollte das aber nicht sagen, weil das nicht meine Meinung ist. Ich fand, es ist keine recht ordentliche Titelgeschichte geworden.
Bestürzend an di Lorenzos Satz finde ich nicht nur, dass sich ein leitender Journalist so nach Zustimmung sehnt. Bestürzend finde ich vor allem den Versuch einer doppelten Vereinnahmung: Dass die „Zeit“ da etwas für die ganze Branche geleistet hätte. Und dass ich das dann als Angehöriger dieser Branche doch bitte zu schätzen hätte.
Offenkundig ist der „Zeit“-Chefredakteur in der Branche nicht allein mit dem Wunsch, den ich aus seinen Texten herauslese: Dass die Zeitungen und der Journalismus von Kritik möglichst verschont werden sollen. Er suggeriert, dass es etwas Unanständiges und Selbstzerstörerisches ist, wenn ausgerechnet Zeitungs-Mitarbeiter und Journalisten diese Kritik üben.
Dahinter steckt womöglich der Gedanke, dass wir Journalisten einander in diesen schlechten Zeiten gegenseitig schonen müssen. Dass wir zusammenrücken sollen, zusammenhalten, gegen Google, zum Beispiel. Dass die Lage zu schlecht ist, um sich eine kritische Beschäftigung mit sich selbst und eine wahrhaft unabhängige Berichterstattung über die eigenen Themen leisten zu können.
Das Gegenteil ist richtig. Journalismus hat nur dann eine Chance zu überleben, unter welchen Rahmenbedingungen auch immer, wenn die Menschen ihn für unverzichtbar halten. Wenn sie davon überzeugt sind, dass sie ihm trauen können, auch und gerade dann, wenn es um Themen geht, die ihn selbst betreffen.
Der „New York Times“-Leser, der bemerkt, wieviel Mühe sich das Blatt gibt, ihn trotz der Verwicklung des eigenen Chefs zuverlässig über den BBC-Skandal zu berichten, der wird diesem Blatt zutrauen, sich grundsätzlich darum zu bemühen, ihn gut zu informieren. Der ist im Zweifel sogar bereit, für einen solchen Journalismus Geld auszugeben und für seine Existenz zu kämpfen.
Ich finde das naheliegend und keine amerikanische Eigenart. Die deutsche Presse aber scheint gerade zu jeder Unwahrheit bereit, um zu beweisen, wie wahrhaftig ihre Berichterstattung ist. Sie beteuert mit maximaler Einfalt ihre Vielfalt.
Der Kollege Richard Gutjahr bringt es auf die treffende Formel:
Journalismus. War das nicht genau das, was uns von Google unterscheidet?
Ich habe mich selten so unwohl gefühlt, Mitglied dieser Branche zu sein.