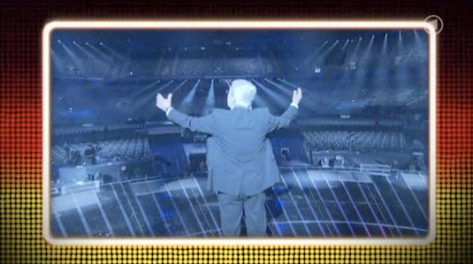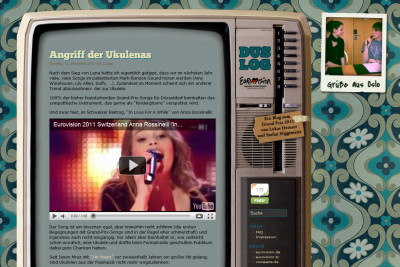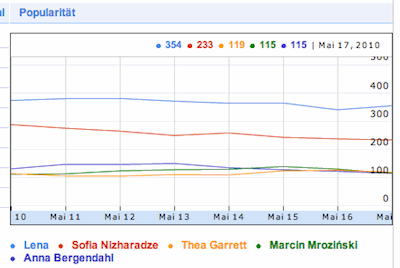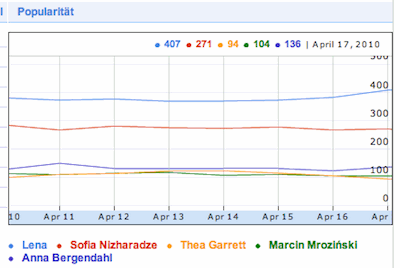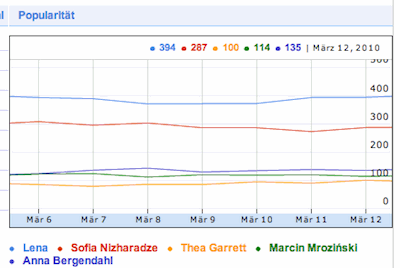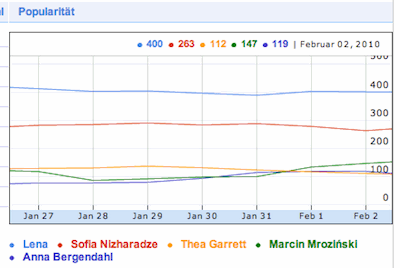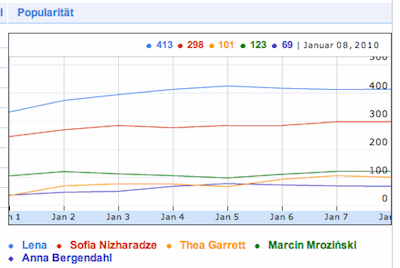Das Nervige am Siegeszug der Lena Meyer-Landrut ist, dass er von diesen ganzen angestrengten und anstrengenden Versuchen der Medien begleitet wird, etwas Welt- oder mindestens die Nation Bewegendes in ihn hineinzuinterpretieren. Eine gute Antwort auf ein besonders beliebtes Erklärmuster — und einen der klügsten Texte zum Phänomen Lena — habe ich nicht in einer der großen Zeitungen gelesen, nicht im „Spiegel“ (der sich schon vor Wochen beim gewaltsamen Pressen von „Unser Star für Oslo“ in sein vorgegebenes Interpretationskorsett nicht von Fakten stören ließ) und schon gar nicht im „Stern“ (der vergangene Woche delirierte: „Aus Lenas schwarzen Siegerstrumpfhosen könnte der Präsident der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, einen Sparstrumpf nähen, dem jeder von Vilnius bis Lissabon sofort sein Gesamtvermögen anvertrauen würde.“) — sondern ausgerechnet in einem Internetforum, auf den Seiten eines Lena-Meyer-Landrut-Fanclubs.
Der Autor D. Lauer hat mir freundlicherweise erlaubt, den Text hier zu veröffentlichen, und ihn dafür leicht überarbeitet:
I.
Die Lenamania – der Aufstieg Lena Meyer-Landruts von der anonymen Abiturientin zum derzeit größten Popstar des Landes innerhalb von nur drei Monaten – verlangt nach Deutung. „Lenamania“ bezeichnet hier das Phänomen, dass LML bei einem Großteil der Bevölkerung offenbar reflexhaft den dringenden Wunsch auslöst, sie (je nach Alter) auf der Stelle als große Schwester, beste Freundin, Traumfrau oder Wunschtochter zu adoptieren. Auf der Suche nach einer Erklärung dieses Phänomens hat sich eine Erzählung etabliert, die LML als Projektionsfläche einer Sehnsucht des Publikums nach Normalität und Anstand im TV- und Musik-Business sieht: Lena als der „Popstar fürs Bürgertum“, wie der „Stern“ titelte. Diese Erzählung entstand mit einem „Spiegel“-Beitrag, in dem „Unser Star für Oslo“ als kultiviertes Musizieren für Abiturienten und Studenten vor einer seriösen Fachjury bespöttelt und zur Antithese der Trash-Konkurrenz von „Deutschland sucht den Superstar“ stilisiert wurde, wo gescheiterte Existenzen aller Art zu den vulgären Kommentaren eines Dieter Bohlen in Gladiatorenkämpfe gehetzt werden. Zum Sinnbild dieser Gegenüberstellung wurde der typisierte Vergleich zwischen den beiden jeweiligen Show-Favoriten: Hier der Freak Menowin Fröhlich, abschluss- und arbeitsloser, mehrfach vorbestrafter Ex-Sträfling, der drei Kinder mit der eigenen Cousine hat, schrill und bedrohlich – dort die Lichtgestalt Lena Meyer-Landrut, Abiturientin aus gutem Hause, Diplomaten-Enkelin, Taizé-Begeisterte, „Sophies Welt“-Leserin, wohlerzogen und eloquent.
Nach dieser Erzählung – nennen wir sie die Höhere-Tochter-Erzählung (HTE) – ist LMLs Erfolg darauf zurückzuführen, dass sich die silent majority des bürgerlichen Mittelstandes mit ihr identifiziert und sie in erster Linie als Inkarnation des eigenen Idealbildes einer höheren Tochter liebt, als Gegenfigur zum skurrilen Comic-Proletariat, das die Nachmittagstalkshows bevölkert.
Die HTE ist seit ihrer Entstehung in medialer Dauerschleife wiederholt worden und hat sich im Diskurs über LML mehr oder weniger als die offizielle Deutung ihres Erfolgs durchgesetzt, selbst dort, wo sie (wie jüngst von Matthias Matussek) in leicht herablassendem Ton ironisiert oder kritisch gegen LML und deren angebliche Bürgerlichkeit (lies: Bravheit und Harmlosigkeit) gewendet wird.
II.
Meiner Auffassung nach ist die HTE zur Erklärung des Phänomens LML vollkommen untauglich. Darum geht es mir hier. Zunächst ist LML nicht die Figur, als die sie in der Erzählung auftaucht. Das hätte man von Anfang an wissen können, hätte man auf die Details geachtet, die sich schlecht mit ihr vertrugen. Höhere Töchter – auch exzentrische – haben keine Tattoos und keine Zahnpiercings. Sie tanzen Ballett, nicht Hip-Hop. Sie geben nicht fröhlich zu, mittelmäßige Schülerinnen zu sein, zu rauchen und sich gelegentlich zu besaufen, auch fahren sie TV-Urgesteinen nicht rotzfrech über den Mund und sagen nicht ständig „scheiße“ und „kotzen“ im Fernsehen.
Bis hierher könnte man natürlich noch argumentieren, dies sei doch bloß das Quäntchen Bohème und Unangepasstheit, das einem aufgeklärten, sozusagen post-bourgeoisen Bild der höheren Tochter erst den richtigen Schliff verleiht. Das mag sogar stimmen, taugt jedoch nicht mehr zum Kitten des fundamentalen Bruchs zwischen der HTE und der Realität, der sichtbar wurde, als durch das unappetitliche Wühlen der Boulevardmedien noch andere Details bekannt wurden, darunter ein so überhaupt nicht distinguierter untergetauchter Vater, vor allem aber natürlich LMLs Auftritte als Laiendarstellerin in genau jenen dubiosen Nachmittags-TV-Formaten, in die sie sich, ginge es nach der HTE, niemals hätte verirren dürfen. Schon gar nicht ganz und gar nackt.
Träfe die HTE zu, hätte sich zu diesem Zeitpunkt ein Großteil ihrer Bewunderer enttäuscht von LML abwenden müssen. Mit genau diesem Ziel wurden die entsprechenden Medienberichte natürlich auch lanciert. Tatsächlich aber haben all die rechten Haken gegen das Höhere-Tochter-Image der Lenamania keinen messbaren Abbruch getan. Was das bürgerliche Mittelschichtspublikum bei seinen eigenen Töchtern zweifellos stören würde, stört es bei LML offenbar kaum. Also basiert seine Liebe zu LML wohl doch nicht vorrangig auf deren „bürgerlichen“ Attributen, wie die HTE behauptet.
III.
Dabei beruht die HTE auf einer richtigen Beobachtung: LML ist eine Gegenfigur zu all den hunderten Kandidatinnen und Kandidaten, die wir im letzten Jahrzehnt in Dutzenden von Casting Shows im Fernsehen haben vorbeiziehen sehen. Das Phänomen LML ist zweifellos darin begründet, dass sie in dem Rahmen, in dem sie zur öffentlichen Person wurde, so vollständig aus dem Rahmen fiel. Aber es ist schlecht beobachtet und verkürzt gedacht, ihre Andersartigkeit schlicht darin zu sehen, dass sie, im (angeblichen) Gegensatz zum Personal einer Show wie DSDS, der bürgerlichen Mittelschicht entstammt. Dieser Unterschied hat, wenn überhaupt, mit dem eigentlichen Phänomen nur indirekt etwas zu tun. LMLs Andersartigkeit liegt vielmehr in dem, was Entdecker und Mentor Stefan Raab schon vom ersten Moment an als ihre „Haltung“ bezeichnete.
Worin besteht diese Haltung? Sie besteht darin, die Gehirnwäsche zu durchbrechen, die das Format der Casting Shows seit über einem Jahrzehnt betreibt und mit der es nicht nur unsere Wahrnehmung von Popmusik infiziert hat. Nicht umsonst spricht man inzwischen von einer Generation Casting, welche die in diesem Genre üblichen Prinzipien und Regeln längst fürs Leben akzeptiert und verinnerlicht habe. Welche Prinzipien? Das lässt sich in jeder beliebigen Casting Show – ob nun DSDS, „Popstars“ oder „Germany’s Next Topmodel“ – mühelos beobachten.
Regel Nr. 1: Der Weg zum Erfolg besteht darin, sich der Jury vollständig zu unterwerfen. Die Jury ist Gott. Sie agiert nach dem Prinzip, dass der Wille des Kandidaten zunächst gebrochen werden muss, damit er sich den Anweisungen der Experten vollständig ausliefert und sich von ihnen formen lässt. Du sollst nicht so sein, wie Du selbst Dich haben willst, sondern wie andere Dich haben wollen. Es gibt daher keinen sichereren Weg, im Casting-Universum den sozialen Tod zu erleiden, als an der Jury Kritik zu üben, ihre Anweisungen zu hinterfragen oder auf eigenen Vorstellungen zu beharren. Beleidigung, Erniedrigung und aufgezwungene Demuts-Rituale sind die unvermeidliche Folge.
Regel Nr. 2: Der Weg zum Erfolg besteht aus Blut, Schweiß und Tränen und dem bedingungslosen Willen, ihm alles andere unterzuordnen. Dies ist die wichtigste Botschaft der Casting Show. Deshalb gibt es in ihren Beurteilungsritualen keine vernichtenderen Abmahnungen als „Du arbeitest nicht hart genug an dir“ und „Wir können nicht erkennen, dass du das hier wirklich willst“. Die Kandidatin kann diesen Verurteilungen nur entkommen, indem sie sich so lange schindet, bis sie auf offener Bühne kollabiert oder wenigstens einen Weinkrampf erleidet, und außerdem in den immergleichen Floskeln gegenüber der Jury beteuert, dass sie bereit ist „alles zu geben“ für den Erfolg in der Show, dass sie „nichts anderes will als kämpfen und weiterkommen“ und überhaupt diese Sendung ihre „einzige und letzte Chance“ sei, etwas aus sich zu machen. In den Schauprozessen von DSDS und GNTM gibt es deshalb kein den Kandidaten häufiger abgepresstes Bekenntnis als dieses. Es gehört zwingend dazu. Mit selbstbewussten Kandidaten, die einfach lachend gehen, wenn sie genug davon haben, sich anpöbeln zu lassen, weil sie nämlich noch etwas anderes mit ihrem Leben anzufangen wissen, funktioniert das Konzept der Sendung nicht.
IV.
LMLs „Haltung“ ist die radikale Antithese zu den beiden genannten fundamentalen Grundregeln der Casting Show. Sie besteht in der Weigerung, sich von den Unterwerfungs-, Leistungs- und Wettkampf-Imperativen dieses Formats bestimmen zu lassen. Berühmtheit hat LML unter anderem damit erlangt, dass sie schon bei ihrem ersten Auftritt gegen Regel Nr. 1 verstieß und darauf bestand, lieber auszuscheiden statt nicht den von ihr selbst präferierten Song zu singen. Insbesondere aber verstößt LML in praktisch jedem ihrer Interviews konsequent gegen Regel Nr. 2. Unbedingter Siegeswille, so sagte sie schon zu USFO-Zeiten und wiederholte es anlässlich des Eurovision Song Contests immer wieder, sei ihr fremd, darauf habe sie keinen Bock. Jedes Ergebnis sei ihr recht, solange sie mit sich im Reinen sein. Konkurrenzdenken und Kampf um die Plätze auf dem Podest seien „nicht so ihr Ding“, ebenso wenig wie hartes Training und tägliches Üben. Sie habe, gab sie kichernd zu, keine Technik, keine Strategie und nicht die Absicht, sich eine andrehen zu lassen. Sie entwickele die Dinge lieber spontan: So tanz‘ ich.
Überhaupt habe sie nie ein Star werden wollen, und die Erfüllung ihres „großen Traums“ sei ihr überwältigender Erfolg als Sängerin schon gar nicht. Vielleicht mache sie bald etwas völlig anderes. An Ideen mangele es ihr nicht. Wichtig sei nur, dass ihr das Ganze momentan Spaß mache, eine tolle Erfahrung sei und sie als Mensch voranbringe. Jeder einzelne dieser Sätze wäre das Ende des TV-Lebens eines normalen Casting-Produktes.
V.
Ich behaupte, dass es einen Namen für diese Haltung gibt. Sie ist nämlich bei Licht betrachtet keinesfalls revolutionär oder neu. In Wahrheit ist sie bloß die fast triviale Erinnerung an die Haltung, die man noch nicht vor allzu langer Zeit grundsätzlich mit der Popmusik verbunden hat – bevor der Casting-Show-Diskurs die Kontrolle übernahm, und zwar so erfolgreich, dass man mit der bloßen Erinnerung an dieses Prinzip des Pop (dieses Wort hier im weitest denkbaren Sinne verstanden) inzwischen wie ein Wesen von einem anderen Stern erscheint.
Denn das war doch das Versprechen, das mit dieser Musik einmal einherging: Jung sein. Lässig sein. Feiern und Spaß haben. Und die Chuzpe zu sagen: Ich brauche eure Lehren nicht, weder Gesangsstudium, noch Musikschule, noch Tanzdrill. Ihr habt mir nichts beizubringen. Eine Gitarre und drei Akkorde, das reicht – sofern man jung ist, und schön, und talentiert, und ohne Angst. Und jenes Charisma besitzt, das die Zuhörer schon beim ersten Chorus auf die Knie fallen und mitsingen lässt: We learned more from a three-minute record baby than we ever learned in school.
Pop war mal das Gegenteil dessen, was die Casting-Show-Idee verkauft, nämlich das Versprechen vom Triumph der Leichtigkeit und der Mühelosigkeit. Und der entscheidende Punkt ist, dass dieses Glücksversprechen des Pop zutiefst antibürgerlich ist. „Bürgerlich“ ist nämlich nicht nur das, was sich die Vertreter der HTE gerne darunter vorstellen (etwas, das vage mit Thomas Mann, dunklen Bücherregalen, Klavierunterricht und gepflegtem Abendessen im Familienkreis zu tun hat). Die real existierende Bürgerlichkeit der Mittelschicht ist in erster Linie der praktizierte Glaube an ein ganz anderes Versprechen, nämlich jenes der disziplinierten Selbstzucht in Kombination mit dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Jeder ist seines Glückes Schmied, und diejenigen werden den Lohn davontragen, die sich am meisten anstrengen, am fleißigsten schuften und am eisernsten sparen – und schon ihre dreijährigen Kinder in Chinesischkurse schleifen, der späteren Chancen am Arbeitsmarkt wegen.
Das Glücksversprechen des Pop hingegen ist die Verweigerung dieses protestantischen Arbeitsethos. Pop scheißt auf Selbstdisziplin und Leistungsgerechtigkeit. Darin ist er zutiefst romantisch. Er belohnt nicht die Arbeitsbienen und die Klassensprecher, er verachtet die Philister. Er verschenkt sein Herz lieber an die arbeitsscheuen Spinner, genialen Dilettanten und verspielten Prinzessinnen. Pop kennt und will keine andere Rechtfertigung als die, dass eine wie LML schlicht ein Liebling der Götter ist, Punkt. „Du hast Star-Appeal. Menschen werden dich lieben.“ Das ist alles.
Weil man solche Gabe nicht erwerben, sondern nur geschenkt bekommen kann, können die, welche sie empfangen haben, es sich leisten, mit ihr nicht nach Art der guten Wirtschafterin sparsam zu haushalten, sondern sie in geradezu aristokratischer Verschwendung weiterzuverschenken. Und das zu ihrem bloßen Vergnügen, ohne dabei nach Tauschwerten, Regeln und Verdienst zu fragen, die eigenen Fähigkeiten nicht penibel dokumentierend, sondern mit ihnen ironisch herumspielend, scheinbar nichts ernst nehmend – während die Braven, die sich das alles eisern angeeignet haben und handwerklich viel besser sind, fassungslos über die Ungerechtigkeit der Welt daneben stehen. Bei manchen, das lässt sich im Fall LML im Netz gut beobachten, kippt diese Verständnislosigkeit in ungezügeltes Ressentiment und Hass auf das Glückskind, oder in wüste Verschwörungstheorien.
VI.
Darum komme ich zu der Schlussfolgerung: LML ist nicht die Ikone der Bürgerlichkeit. Sie ist die (sehn-)süchtig machende Erinnerung an das Glücksversprechen des Pop, verkörpert in dem Gesicht einer Caravaggio-Madonna mit ironischem Grinsen und frechem Mundwerk. Die Sehnsucht, die LML weckt, ist nicht die Sehnsucht nach Bürgerlichkeit, sondern das Versprechen, dass – wenigstens stellvertretend in ihrer Person – die Befreiung vom Korsett der Bürgerlichkeit möglich ist. Deshalb träumen so viele laut oder leise davon, so zu sein wie sie – und schon allein diesen Traum träumen zu können, indem man sie beobachtet, führt ein Stück des Glücks mit sich. Wenn das Mittelschichts-Bürgertum LML liebt, dann nicht deswegen, weil sie genauso ist, wie es selbst, sondern weil es sich heimlich danach sehnt, ganz anders zu sein, als es ist.
Allerdings kommt es noch schlimmer für die Anhänger der HTE, denn die ganze Überlegung zeigt noch ein Zweites: Wenn es überhaupt eine Verkörperung des Bürgerlichen im deutschen Fernsehen gibt, dann sind das ironischerweise eben die just von jenem Bürgertum so verachteten, proletigen Casting Shows. Als Dieter Bohlen verkündete, der von ihm nicht favorisierte Mehrzad Marashi habe DSDS dank „deutscher Tugenden“ (er meinte Fleiß und Disziplin) gewonnen, hätte er damit um ein Haar einmal etwas Wahres gesagt. Sicher, begriffen hat er es wahrscheinlich nicht. Das deutsche Feuilleton aber auch nicht.