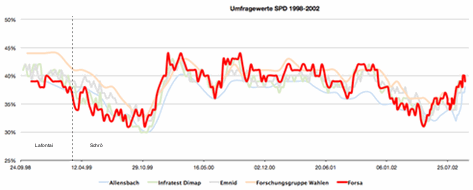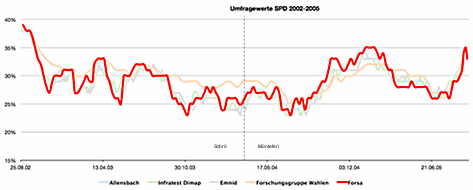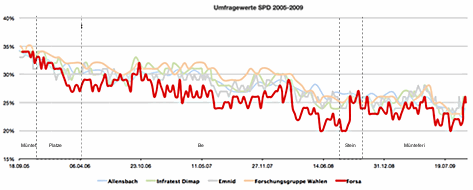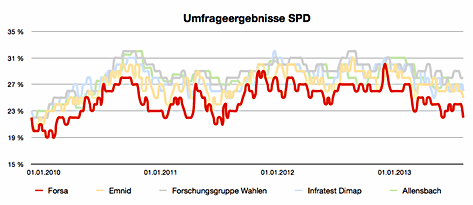Manfred Güllner ist besorgt. Mit großem Unbehagen beobachtet er, dass die Eliten des Landes zunehmend auf das hören, was im Netz gesagt wird. Und nicht auf das Volk.
Das ist womöglich schlecht für das Land, denn die Leute, die sich im Internet artikulieren, sind nicht unbedingt repräsentativ für das Volk. Ganz sicher aber ist es schlecht für ihn, denn Güllner ist Meinungsforscher und lebt davon, anderen zu erzählen, was das Volk denkt und meint.
Wenn Forsa-Chef Manfred Güllner sich wortreich darum sorgt, dass die Politik nicht mehr auf das Volk hört, sorgt er sich in Wahrheit, dass die Politik nicht mehr auf ihn hört.

„Das vergessene Volk“ heißt Güllners Artikel, den heute mehrere Zeitungen, darunter der „Kölner Stadt-Anzeiger“ und die „Frankfurter Neue Presse“, als Gastbeitrag veröffentlicht haben. Anlass ist vorgeblich das 6. Hessisch-Thüringische Mediengespräch. Es findet zwar erst am 1. Oktober statt, aber man kann mit dem Vordenken ja nicht früh genug anfangen.
Man könnte Güllners Artikel leicht als eines der üblichen staatstragenden Essays missverstehen, die aus solchen Anlässen formuliert werden. Aber Güllner geht es um viel mehr als die Gesellschaft. Es geht ihm um sich selbst.
Das Forsa-Chef wettert gegen „das Netz“ und vor allem gegen das Missverständnis, dass es sich bei der großen Zahl von Bloggern, Kommentatoren, „Followern“ und „Freunden“ um einen „auch nur annähernd repräsentativen Querschnitt des gesamten Volkes“ handle:
Die angeblich den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkenden „Communities“ bestehen überwiegend aus Vertretern von Partikular-Interessen – die ja durchaus legitim sein mögen -, meist aber aus Extremisten jedweder Couleur, Querulanten, in der Gesellschaft zu kurz Gekommenen – wie jenes „Medienjournalisten“, bei dem es zu einem ordentlichen Journalisten nicht gereicht hat – oder selbst ernannten Advokaten, die unter dem Deckmantel „hehrer Ziele“ nur ihre ideologischen oder persönlichen Süppchen kochen wollen – zum Beispiel solch undurchsichtigen Gebilden wie „Lobby-Control“, etc..
Huch, „Medienjournalist“? Er wird doch nicht schon wieder mich gemeint haben?
Für das Publikum der Tageszeitungen, die sich von Güllner vollschreiben ließen, dürfte das eine eher rätselhafte Referenz sein. Aber vielleicht tun ja einige der Leser das, was ich gemacht habe, weil ich über das für mich ähnlich rätselhafte Abwatschen von „Lobby-Control“ gestolpert bin, und googlen ein bisschen und werden schlauer.
Wenn man nach Lobby-Control und Güllner sucht, findet man auch sehr schnell eine gute Erklärung für den kleinen Wutpickel in Güllners Text: „Lobby-Control“-Aktivist Timo Lange hat Meinungsforscher wie Forsa vor ein paar Jahren in einem „Handelsblatt“-Interview kritisiert:
Diese Institute liefern zum Teil bestellte Wahrheiten. Forsa beispielsweise hat mal eine Umfrage für die Deutsche Bahn zur Bahnprivatisierung gemacht, vermittelt über eine Agentur. Gefragt wurde nach den Vorteilen einer Privatisierung, die Nachteile wurden erst gar nicht thematisiert. Platziert wurden die Ergebnisse dann sehr geschickt am Tag der Expertenanhörung zur Bahnprivatisierung im Bundestag. Das floss dann natürlich in die mediale Berichterstattung mit ein, mit dem Tenor: Experten sehen Privatisierung kritisch, die Bürger versprechen sich aber davon einen besseren Service.
(Dass die Forsa-Fragen „einseitig bahnfreundlich formuliert“ waren, hatte 2009 auch der PR-Rat festgestellt.)
Güllners Essay lässt sich also auch als Bewerbung zum Präsidenten des Retourkutscherverbandes lesen. Unter dem Deckmantel „hehrer Ziele“ kocht er seine persönlichen Süppchen – Moment, wo hatte ich das gerade noch gelesen?
Nun sind die Fragen, die Güllner scheinbar aufwirft, wichtig und richtig: Wie gehen Entscheider in Gesellschaft, Medien und Politik mit den Wortmeldungen im Netz um? Wie ordnet man sie ein, welche Bedeutung misst man ihnen bei? Wie verhindert man es, sich von einem vermeintlichen „Shitstorm“ von einer Handvoll lautstarker Krakeeler einschüchtern zu lassen, erkennt aber, wenn nötig, auch die darin enthaltene Relevanz?
Güllner ist aber an dieser Diskussion nicht gelegen, denn er hat eine einfache Antwort auf diese Fragen: Alles ignorieren. Wenn ich wissen will, was das Volk bewegt, darf ich auf keinen Fall ins Netz gucken. Ich muss in die Markt- und Meinungsforschung gucken, die ich bei einem Institut wie, sagen wir, Forsa in Auftrag gegeben habe. Güllner vertritt das Volk (und nicht etwa das komische Volk, das sich im Netz äußert).
Der Forsa-Geschäftsführer sagt nicht nur, das die Wort-Meldungen im Netz nicht repräsentativ sind. Er erklärt sie für vollständig irrelevant:
Sie können (…) nicht als eine Art „Schwarm-Intelligenz“ gewertet werden; denn anders als bei dem historischen Beispiel der „Ochsenfleischzählung“ von 1906, als das Gewicht des Ochsen trotz großer Abweichungen der individuellen Schätzungen im Durchschnitt exakt eingeschätzt wurde, finden sich im „Netz“ ja durchweg nur von der Mehrheit völlig abweichende Positionen, so dass die behauptete identitätsstiftende Wirkung des „Netzes“ nicht stattfinden kann.
Nach Güllners Worten finden sich im Netz „durchweg nur von der Mehrheit völlig abweichende Positionen“. Die Mehrheitsmeinung, die Ansichten des Mainstreams, sie sind für ihn hier nicht nur unterrepräsentiert. Sie sind nicht vorhanden. Normale Menschen mit normalen, vernünftigen Mehrheitsmeinungen äußern sich nicht im Netz. Alle im Netz sind bekloppt.
Und für den Fall, dass der Leser glauben könnte, dass Güllner da in seiner Wut vielleicht einfach mal etwas übertrieben formuliert hat – sagt er es sicherheitshalber drei Sätze später noch einmal:
Die im Netz vorzufindenden Äußerungen und Kommentare werden [von politischen und gesellschaftlichen Eliten] missinterpretiert als Meinung des Volkes, obwohl es sich ja in der Regel nur um völlig abwegige Artikulationen von Minderheiten handelt.
In der Regel nur um völlig abwegige Artikulationen von Minderheiten.
Die Demütigung, die er mit dem Verlust der Deutungshoheit erfährt, scheint für Manfred Güllner unerträglich zu sein. Und dann muss er auch noch Widerspruch und Kritik von Leuten hinnehmen, die nicht selbst Manfred Güllner sind! Er macht, was er dem „Netz“ vorwirft: durchweg extremisieren. Und größere Zeitungen des Landes geben ihm dafür und für ein paar billige Polemiken gegen seine Kritiker gerne das dafür notwendige Papier.
Wer in erster Linie auf das „Netz“ hört, verliert (…) schnell das Gespür dafür, was das Volk insgesamt wirklich umtreibt, bewegt, besorgt oder beunruhigt. Damit aber verärgert man die große Mehrheit des Volkes nachhaltig. Zu Recht beklagen ja die immer zahlreicher werdenden Nichtwähler, dass die politischen Akteure sich zu sehr an den Meinungen und Interessen von Minoritäten orientieren, die Interessen der großen Mehrheit des Volkes aber unberücksichtigt lassen.
Ja, das beklagen Nichtwähler. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie damit meinen, dass Politiker zu sehr auf das Netz hören. Vor allem aber haben Nichtwähler mit dem Netz überhaupt erst die Möglichkeit zu sagen, warum sie nicht wählen, und sie tun es in Scharen.
Güllner aber setzt seine Geisterbahnfahrt fort:
Noch reagiert dieser Teil des Volkes, der sich nicht mehr verstanden und vertreten fühlt, nicht mit aggressivem Wahlverhalten, sondern „nur“ mit Wahlverweigerung. Doch die historische Erfahrung in Deutschland mit der Zerklüftung und Polarisierung der Gesellschaft sollte Warnung genug sein, um ähnlich gefahrvolle Entwicklungen nicht wieder entstehen zu lassen. Nicht um „communities“ sollten sich deshalb die Eliten der Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien kümmern, sondern um das Volk insgesamt, das sich immer mehr vergessen vorkommt.
Es ist sicher kein Zufall, dass Güllner hier immer vom „Volk“ als Ganzem spricht und nicht vom Bürger als einzelnem. Er plädiert nicht für Bürgernähe, die man zum Beispiel als Politiker zum Beispiel in sozialen Medien und vor Ort erreichen kann. Er plädiert dafür, herauszufinden, was „das Volk“ will. Und wer könnte das für einen herausfinden, wenn nicht ein Forschungsinstitut wie Forsa?
Wenn die Eliten des Landes aber zu sehr auf das Netz hören, droht mindestens der Untergang des Abendlandes, vielleicht sogar von Forsa.