Man kann darüber streiten, ob es eine gute Idee war, den „Spiegel“ und „Spiegel Online“ für ihre Berichterstattung über Schwule und Lesben auszuzeichnen. Ein guter Anlass war es sicher.
Ein guter Anlass für Kritiker (wie mich), auf die furchtbare Aids-Berichterstattung des „Spiegel“ in den achtziger Jahren hinzuweisen. Und ein guter Anlass für den „Spiegel“, sich mit dieser Berichterstattung und der Kritik daran auseinanderzusetzen.
Der „Spiegel“ hat diese Chance nicht genutzt.
Markus Verbeet, der stellvertretende Deutschlandchef der Zeitschrift, hatte bei der Preisverleihung gesagt:
„Es war nicht alles gut, was wir damals geschrieben haben. Es gab Grenzüberschreitungen. Es gab nicht nur zugespitzte Darstellungen, sondern auch verletzende Worte. Manches hätten wir auch damals besser wissen müssen und ich ahne, was für Verletzungen wir hervorgerufen haben.“
Das hat vielen Zuhörern imponiert.
Verbeet hatte auch gesagt, dass er sich die alten Aids-Artikel aus der fraglichen Zeit aus dem Archiv suchen ließ. Manche verstanden das als Auftakt für eine öffentliche Aufarbeitung.
Ein paar Tage später veröffentlichte Verbeet unter der treuherzigen Frage „Sind wir preiswürdig?“ einen Eintrag im „Spiegel“-Blog, in dem er über den Preis und die Kontroverse berichtete und dies und jenes verlinkte. Einen Hinweis, was konkret der „Spiegel“ (oder Verbeet persönlich) im Rückblick an der „Spiegel“-Berichterstattung über HIV, Aids und homosexuelle Männer falsch und verletzend fand, gab der Text nicht.
Der Blogger und Aktivist Marcel Dams hatte in seiner bewegenden Laudatio auf den „Spiegel“ gesagt:
Ich finde auch, dass es Zeit für eine längst überfällige Entschuldigung ist. Nicht nur hier und heute, sondern am besten auch am Ort des Geschehens — im Blatt.
Am Ort des Geschehens erschien in dieser Woche stattdessen dies:
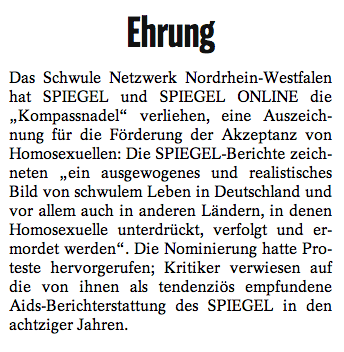
Das ist aus „Spiegel“-Sicht ganz normal. Ganz hinten im Heft sammelt die Redaktion, was irgendwo irgendwer Positives über den „Spiegel“ gesagt hat. Und in diesem Fall hat sie, obwohl es sich um eine „Ehrung“ handelt, sogar die Kritik erwähnt.
Oder genauer: So getan als ob.
Dams nannte die damalige „Spiegel“-Berichterstattung in seiner Laudatio „menschenverachtend“ und „homophob“. Die deutsche Aids-Hilfe nannte sie „unsäglich“ und „an die Grenze zur Hetze reichend“. Martin Dannecker nannte sie „fragwürdig“ und „eine regelrechte antihomosexuelle Kampagne“, die „niedrige Affekte bediente“. Ich nannte sie „infam“ und „apokalyptisch“.
Und der „Spiegel“ glaubt allen Ernstes, das angemessene Wort, diese Attribute zusammenzufassen, wäre „tendenziös“?
Der „Spiegel“ tut so, als gebe er ehrlich die Kritik an sich wieder und beschönigt sie dabei. Mir fiele dazu das Wort „unverfroren“ ein, aber vermutlich ist es viel schlimmer: Gedankenlos.
Fast ein halbes Jahr hätte der „Spiegel“ Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Deutsche Aids-Hilfe, die ja nun nicht irgendein souverän zu ignorierender Quatschverein ist, ihm vorwirft, den „Grundstein für die Stigmatisierung der Menschen mit HIV“ gelegt zu haben. Betroffene hätten bis heute unter den Folgen dieser Skandalisierung zu leiden.
Trotz der positiv aufgenommenen Worte von Markus Verbeet bei der Preisverleihung hat er sich seitdem nicht zu mehr als einem vagen Es-war-nicht-alles-Gut durchringen können. Jedem anderen würde gerade der „Spiegel“ eine solche Form der Vergangenheitsscheinbewältigung um die Ohren hauen.
Marcel Dams, der Laudator, nennt die Notiz im Blatt, „um es nett auszudrücken, absolut unverständlich“. Er schreibt:
Das was (…) abgedruckt wurde, ist nicht nur zu wenig. Nein. Es ist sogar ein Schlag ins Gesicht derer, die die damalige Zeit miterleben mussten.
Was mich nämlich am meisten stört ist folgendes: Das geschrieben wird, es gehe um ein Empfinden. Es liest sich so, als ob die Berichterstattung nicht homophob oder tendenziös war, sondern nur ein paar Schwule — die sich nun aufregen — es so empfinden.
Das Fazit, das der 24-jährige Blogger dem 66-jährigen Nachrichtenmagazin mitgibt, lautet:
Zu jeder Biographie gehören Narben. Wir alle haben keine weiße Weste. Nobody’s perfect. Sich den Fehlern zu stellen, diese zu erkennen, sie zu benennen und daraus zu lernen. Das erwarte ich.
Das ist zuviel verlangt vom „Spiegel“.
[Offenlegung: Ich habe eineinhalb Jahre für den „Spiegel“ gearbeitet.]