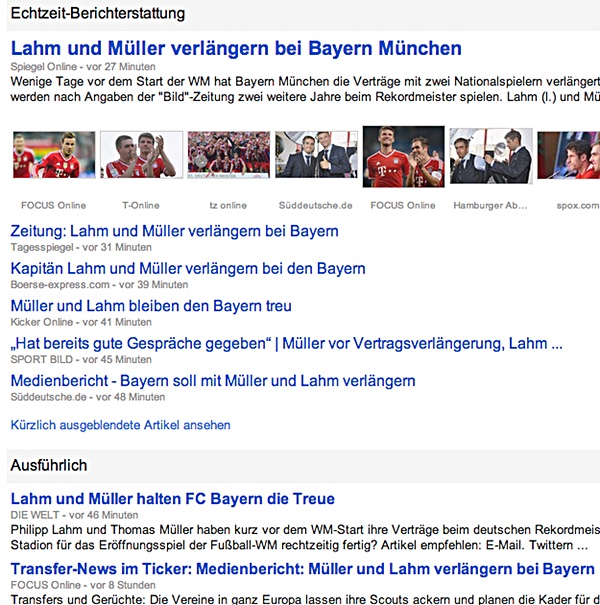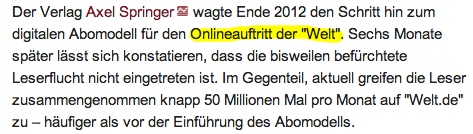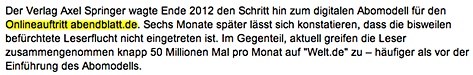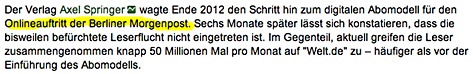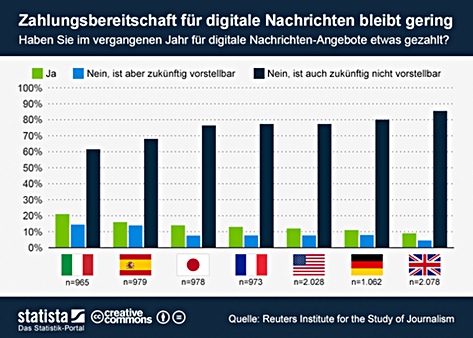Die Axel Springer AG hat also das „Hamburger Abendblatt“ dazu erkoren, der Branche vorzumachen, wie Bezahlinhalte („Paid Content“) im Internet vermutlich nicht funktionieren.

Ohne jede Ankündigung standen die Leser heute plötzlich vor geschlossenen Schranken mit Euro-Zeichen. Und nicht nur die Leser: Auch viele Mitarbeiter wussten nichts davon, dass die Angebote, für die sie arbeiten, nicht mehr frei zugänglich sind. Die Online-Inhalte der Lokalausgaben sind komplett kostenpflichtig; in den Haupt-Ressorts ist es eine größere Auswahl.
Wer alle Texte lesen will, muss entweder Abonnent der gedruckten Zeitung sein oder für 7,95 Euro im Monat Abonnent der Online-Ausgabe werden. Sich einen einzelnen Artikel, an dem man besonders interessiert ist oder über den man vielleicht bei Google gestoßen ist, für ein paar Cent freizuschalten, ist nicht möglich. Damit folgt das „Abendblatt“ exakt der tödlichen Strategie der Musikindustrie, die sich jahrelang geweigert hatte, dem offenkundigen und technisch leicht zu erfüllenden Wunsch der Kundschaft nachzukommen, einzelne Musiktitel erwerben zu können. Die Musikindustrie aber wollte um jeden Preis am für sie lukrativen Geschäftsmodell der CD festhalten — mit dem Ergebnis, dass sie fast am Ende ist und branchenfremde Unternehmen wie iTunes jetzt groß im Geschäft sind.
Die Zeitungsbranche glaubt aber immer noch, dass ihr Geschäft so läuft, dass die Leser die Inhalte gefälligst so zu kaufen haben, wie die Verlage sie verkaufen wollen. Die Verleger glauben offenkundig, dass sich bei Journalismus nicht um eine Dienstleistung handelt, bei der die erfolgsversprechendste Strategie die ist, die den Wünschen der Kundschaft so weit wie möglich entgegenkommt. Sie halten sich für unverzichtbar und ihre Produkte für unersetzbar. Sie folgen der Musikbranche in den Abgrund.
Das Bezahl-„Konzept“ des „Abendblattes“ ist kein neues Geschäftsmodell. Es ist der verzweifelte Versuch, das alte, für die Verlage komfortable Geschäftsmodell des Abonnements und des Kaufs ganzer Zeitungen, in ein neues Medium zu retten, das die Kunden von den Fesseln solcher Geschäftsmodelle befreit.
Man muss den Text „In eigener Sache“ vom stellvertretenden „Abendblatt“-Chefredakteur Matthias Iken lesen, der heute auf der Startseite von abendblatt.de steht. Man könnte denken, dass ein Händler, der plötzlich eine so radikale Verteuerung seines Angebotes bekannt geben muss, alles dafür tut, seine Kunden zu umwerben, ihm treu zu bleiben. Ikens Text aber ist eine Frechheit. Er liest sich fast, als müsste man sich als Leser von Online-Medien schämen, dafür so lange nichts gezahlt zu haben. Das muss man erst einmal bringen: Bei der Bewerbung seines eigenen „Qualitätsjournalismus“ Absätze lang rumzuschimpfen wie ein einarmiger Renter 1968 über die langhaarigen Studenten.
Viele Nutzer, schreibt er, hätten „eine echte Freibiermentalität entwickelt“. Man kann nicht oft genug wiederholen, dass das Problem der Verlage im Internet nicht die angeblich dort herrschende Kostenlos-Mentalität ist. Eigentlich würden sich die Online-Inhalte auch allein durch Werbung finanzieren lassen, da die Vertriebs- und Druckkosten wegfallen und die Reichweite größer ist. Der Grund, warum die Werbeeinnahmen in den meisten Fällen (noch) nicht ausreichen, hat nichts mit den Lesern und ihrer „Freibiermentalität“ zu tun, sondern damit, dass die Medien im Internet ihr Monopol als Werbeflächen verloren haben. Früher musste ein Unternehmen, das Kunden mit Werbung erreichen wollte, auf Zeitungen und Zeitschriften, Fernsehen, Radio und Außenmedien zurückgreifen. Heute kann es auf eine Vielzahl weiterer Werbeflächen zurückgreifen, darunter solche, die in vielen Fällen ein weitaus erfolgversprechenderes Umfeld darstellen als Journalismus: Suchmaschinen zum Beispiel. Vor allem deshalb sind die Werbeerlöse im Internet so frustrierend niedrig: Das Angebot an Werbeflächen ist viel größer. Man nennt das Markt.
Und wenn der „Abendblatt“-Vize ernsthaft glaubt, dass in der Anfangszeit des Web vor lauter Begeisterung über die technischen Möglichkeiten die Frage der Einnahmen „vergessen“ worden sind — vielleicht könnte ihm jemand erklären, wie das zum Beispiel war mit Google. Wo auch alle jahrelang dachten, die hätten kein Geschäftsmodell, dabei hat Google nur eine interessante Reihenfolge gewählt: Das Unternehmen hat erst alles daran gesetzt, die größtmögliche Reichweite aufzubauen und seine Kunden glücklich bis süchtig zu machen. Und dann Wege gesucht und gefunden, diese Reichweite und diese Treue in Geld zu verwandeln. Mag sein, dass das mit Journalismus schwerer ist als mit einer Suchmaschine. Aber wenn man die Augen fest vor der Realität verschließt, ist es unmöglich.
Das Geschäftsmodell der vergangenen Jahre nennt Iken das „Mutter-Theresa-Prinzip“, was vermutlich tatsächlich der Selbstwahrnehmung vieler seiner Kollegen entspricht: Sie haben ihre Inhalte nicht ins Internet gebracht, um ihre Reichweite zu vergrößern; um neue, junge Leser zu erreichen; um eine Zukunft zu haben, wenn in absehbarer Zeit kaum noch Menschen Zeitung lesen; um mit Texten, die ohnehin durch die Print-Ausgabe schon finanziert waren, noch zusätzliche Werbeerlöse zu generieren, nein: Sie haben ihre Inhalte kostenlos ins Internet gebracht als gute Gabe für die armen Menschen, die sonst nicht wüssten, was in der Welt passiert. Das „Mutter-Theresa-Prinzip“.
Der Gedanke, dass Medien sich zumindest teilweise über Werbung finanzieren, kommt in Ikens verlogenem Text nicht einmal so vor. Er behauptet, man habe „vergessen, Geld zu verdienen“. Er schreibt: „Wer Qualitätsjournalismus zum Nulltarif will, will keinen Qualitätsjournalismus.“ Was für ein „Nulltarif“? Ikens Text ist umgeben von Werbeflächen. Man kann darüber reden, inwiefern eine vollständige Abhängigkeit von Werbeeinnahmen gefährlich sein kann für unabhängigen Journalismus, aber mit jemandem, der so unredlich ist wie Iken, kann und muss man darüber nicht reden.
Iken behauptet, dass der Leser von abendblatt.de etwas „Werthaltiges“ bekommt (womöglich hat irgendein versehentlich eingebauter Realitätscheck im Redaktionssystem verhindert, dass er „wertvoll“ schreibt). Er schreibt:
Längst ist der Online-Journalismus zu einer eigenen Gattung geworden. Das einfache Verfügbarmachen von Texten aus der Zeitung im Netz war noch wenig originell, inzwischen aber sind neue und aufwendige Formate hinzugekommen.
Ja, „originell“ war es natürlich vom „Hamburger Abendblatt“, Inhalte so für das Internet aufzubereiten, dass man Dutzende Male klicken musste, um sie lesen zu können, was insofern natürlich ein „aufwendiges Format“ ist — für den Leser. Es lohnt sich übrigens, die gewaltige Zahl von empörten Leserkommentaren unter Ikens Text zu lesen, die keineswegs nur je zur Hälfe aus Angetrunkenen und Durstigen bestehen, die ihr Freibier vermissen, sondern auch aus enttäuschten „Abendblatt“-Lesern (die ohnehin damit geschlagen sind, in einer Millionen-Metropole zu leben, in der das die einzige ernstzunehmende Lokalzeitung ist wäre). Das heißt: Es würde sich lohnen, die Kommentare zu lesen, wenn die qualitätsbewussten Leute von abendblatt.de das nicht geschickt so programmiert hätten, dass man immer nur drei Beiträge angezeigt bekommt. Für die aktuell über 300 Kommentare müsste man also 100-mal klicken.
Iken fragt:
Ist es zu viel verlangt, in Zeiten, wo aufgeschäumter Kaffee im Pappbecher drei Euro kostet oder das Telefonvoting für sinnbefreite Casting-Shows mindestens 50 Cent, für das Produkt Qualitätsjournalismus knapp 30 Cent am Tag zu bezahlen?
Was er offensichtlich nicht verstanden hat: Die Antwort auf diese Frage gibt nicht er. Die Antwort geben die Menschen, denen vielleicht tatsächlich der „Kaffee im Pappbecher“ drei Euro wert ist, aber der Artikel aus dem „Abendblatt“, und sei er noch so aufwendig recherchiert, keine drei Cent. Weil sie der Kaffee glücklich macht, und sie sich nicht von irgendeinem dahergelaufenen Vize-Chefredakteur bei Springer erzählen lassen wollen, ob die Casting-Show, bei der sie mitfiebern und mitwählen, „sinnbefreit“ ist.
Die einzige Chance, die der Journalismus hat, liegt darin, den Menschen etwas anzubieten, das sie lesen wollen. Das einen Wert hat für sie, weil sie sich gut informiert fühlen oder gut unterhalten oder beides. Das sie so gut und so wichtig finden, dass sie darauf nicht verzichten wollen und bereit sind, dafür etwas zu geben: Zu allererst ihre Zeit. Das ist der eigentliche Tausch, der da stattfindet: Leser belohnen Medien dadurch, dass sie ihnen Aufmerksamkeit schenken, ein rares Gut. Und vielleicht geben sie sogar Geld. Aber dazu lassen sie sich nur überzeugen durch ein Angebot, das ihnen Geld Wert ist — und vermutlich nicht durch das Gefühl, dass so Journalismus ja theoretisch wichtig ist und jemand dafür zahlen sollte. Und ganz sicher nicht durch einen Verkäufer, der ihnen Vorwürfe macht, dass sie ihr Geld für sinnlose Sachen wie „Kaffee in Pappbechern“ ausgeben.
Ikens Text ist ein notdürftig als Werbetext getarnter Abwasserrohrbruch. Er endet mit den Worten:
Vielleicht ist es aussichtslos. Vielleicht ist es selbstmörderisch. Vielleicht ist es auch unverschämt. Doch vor allem ist es eins: Es ist alternativlos.
Anscheinend glauben die Verantwortlichen beim „Abendblatt“, die Redensart vom „Selbstmord aus Angst vor dem Tode“ sei keine Warnung, sondern ein Ratschlag.
Nachträge, 17. Dezember.