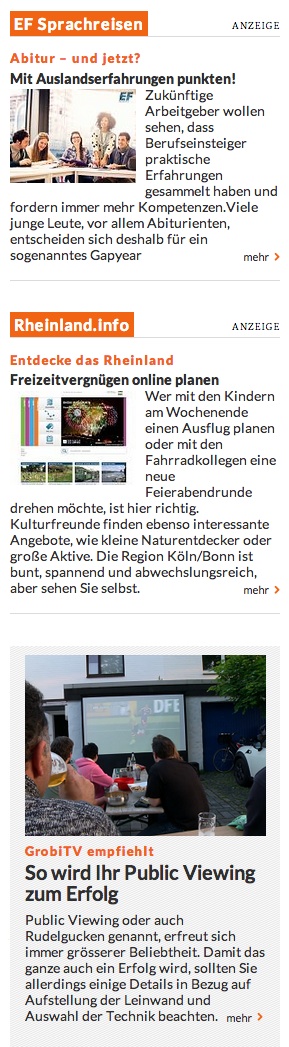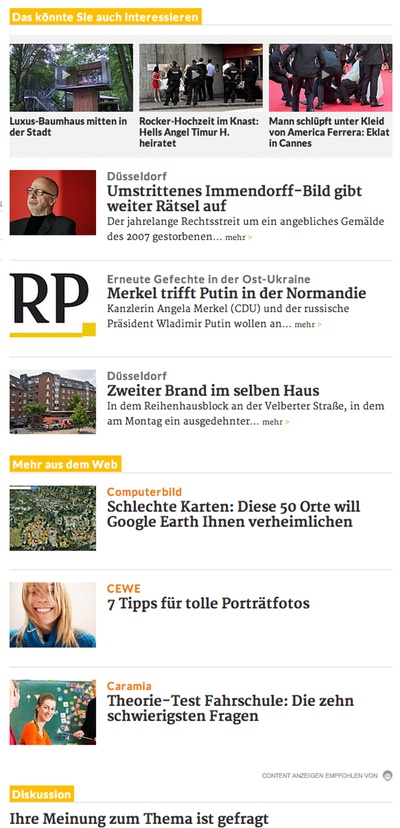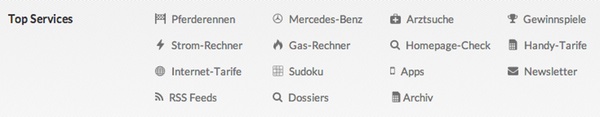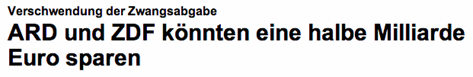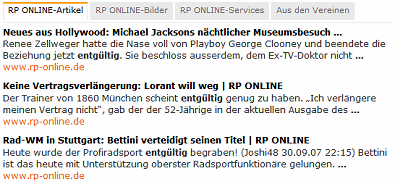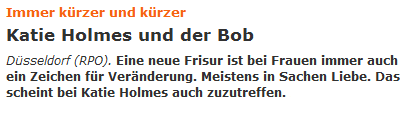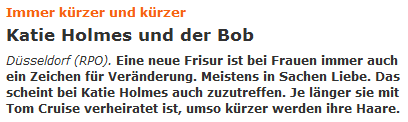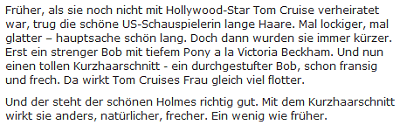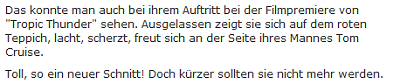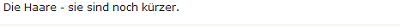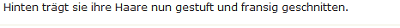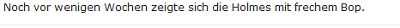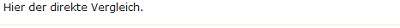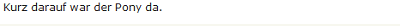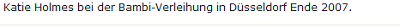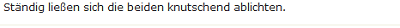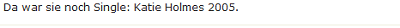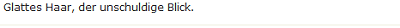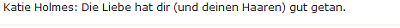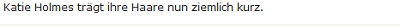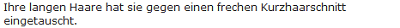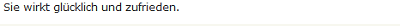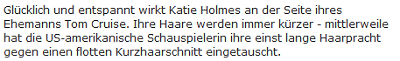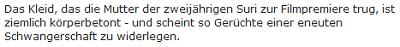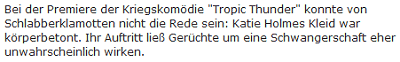Für den britischen Premierminister David Cameron läuft es gerade richtig gut. In einem Monat, Anfang Mai, sind in Großbritannien Unterhauswahlen, was ganz spannend wird, weil das unter Umständen auch Bedeutung hat für die EU. Und wie immer im Wahlkampf geht es deshalb um harte Themen, um Inhalte, ist ja klar.
Vor ein paar Tagen zum Beispiel machte die Nachricht die Runde, dass Cameron nicht richtig essen kann bzw. falsch isst, weil er bei einem Gartenfest an einem Tisch saß und – halten Sie sich fest: einen Hotdog mit Messer und Gabel verzehrte. Worüber die feinen Briten dann gegackert haben. Und woraus man natürlich auch als deutschsprachiger Journalist viele tolle Überschriften basteln kann.
Jawoll, „das Volk tobt“! Und seit es sich ausgetobt hat, hält sich „das Volk“ jetzt den Bauch vor Lachen, es kugelt sich, und Journalisten schenkelklopfen dazu den Takt dieses Hohn-und-Spott-Liedes, denn, und nun halten Sie sich bitte noch mal fest: Es ist ein weiteres unheimlich krasses Foto aufgetaucht.
Süß, die Kleine, nicht? Wie sie da liegt und schläft, weil der olle Cameron ja ein so langweiliger Mensch ist, bei dem alle sofort kollektiv ins Koma plumpsen, sobald sie seiner ansichtig werden. Und diese Politik! Und der Anzug! Und wenn der dann noch aus einem Kinderbuch vorliest – schnarch! So ungefähr klingt das gerade in vielen (vor allem britischen) Medien, die über Camerons Besuch in der Sacred Heart Primary School berichten. Aber auch deutsche Journalisten stürzen sich inzwischen auf die neue vermeintliche Wahlkampf-Panne des Premiers.
 („Die Welt“)
(„Die Welt“)
Das ist schon toll, was da so alles über den Premier geschrieben steht, über den „abgehobenen Snob“, den „volksfremden Snob“, den einfach nur „Snob“, der „weltfremd und langweilig“ sei, was ja nun dieses Foto wieder mal belege. „Die unfreiwillige Botschaft“ des Bildes sei, schreibt die „Rheinische Post“ freiwillig: „Cameron langweilt seine Untertanen bis in den Tiefschlaf.“
Glücklicherweise existieren etliche Fotos von der Situation, und es gibt auch Videos, die zeigen, widewidewie sich Journalisten die Welt zurechtbiegen; wie sie ein schnödes Foto, einen einzigen Augenblick hochjazzen; wie erneut eine Geste mehr zählt, als jede inhaltliche Annäherung, auch wenn es dieses Mal kein Stinkefinger ist. Manche Journalisten lernen halt nicht dazu, da können noch unendlich viele gefälschte oder verfälschende Fotos oder Videos kursieren – immer dasselbe Spiel.
Tatsächlich war es ganz vergnügt in der Klasse. Die Kinder gibbelten, der Premier machte einen eher lockeren Eindruck. Cameron las aus einem Buch vor und animierte das Mädchen, mitzulesen, laut, vor allen anderen. Als sie ein Wort partout nicht herausbekam, schlief sie nicht augenblicklich aus Langeweile ein, sondern ließ eher aus Scham und kichernd ihren Kopf auf die Tischplatte sinken.
Während es bis hierhin eher still war im Klassenzimmer, schnatterten nun, im kurzen Kopf-Tisch-Moment, die Kameras der Journalisten so wild, wie sich die Fotos jetzt im Netz verbreiten. Und als ob es nicht schon kurios genug wäre, dass sich Journalisten heutzutage nicht kurz fragen, ob das Bild tatsächlich das zeigt, was man auf den ersten Blick denken könnte – einige haben sich das wohl gefragt und wissen, dass die Story nicht so ganz stimmt, schreiben es aber trotzdem auf.
Die „Welt“ titelt groß: „Der britische Premier dilettiert im Wahlkampf: Er langweilt die Jüngsten im Kindergarten und isst Hotdog mit Messer und Gabel.“ Im Text wird das dann wieder eingeschränkt, aber so eine Überschrift ist ja auch einfach zu gut. Bei t-online.de ist es in etwa das Gleiche. Und besonders bräsig, aber erwartbar, schafft die „Huffington Post“ die gleichzeitige Rolle vor- und rückwärts.

Das steht da so, als Überschrift. Im Text, in dem auch das Video aus der Schule eingebaut ist, steht dann wenig bis gar nichts, außer eben, dass Cameron als „Snob“ gelte, der einen Hotdog mit Messer und Gabel esse, und dass nun auch der Auftritt in der Grundschule „nach hinten los“ ging. Im letzten Absatz dann:
Dass das Bild aus dem Zusammenhang gerissen und das Mädchen den Kopf eigentlich auf den Tisch hat fallen lassen, weil ihr eine Antwort auf eine Frage Camerons nicht eingefallen ist, interessiert die Öffentlichkeit nicht.
Naja, und die „Huffington Post“ offenbar auch nur so halb.
 (
( (
( (
( (
( (
(



 Nichts gegen Werbung. Werbung ist theoretisch und oft auch praktisch eine wunderbare Art, hochwertige Inhalte zu finanzieren. Das Unternehmen gibt Geld und ich zahle mit meiner Aufmerksamkeit.
Nichts gegen Werbung. Werbung ist theoretisch und oft auch praktisch eine wunderbare Art, hochwertige Inhalte zu finanzieren. Das Unternehmen gibt Geld und ich zahle mit meiner Aufmerksamkeit.