Kommen wir zu weiteren Antworten auf die beliebte Frage: „Wer glaubt schon, was in der ‚Bild‘-Zeitung steht?“
Die Nachrichtenagentur AP glaubt es. Sie übernahm bekanntlich aus „Bild“ die ebenso doofe wie falsche Behauptung, das „Gerangel um die Aust-Nachfolge … zieht offensichtlich auch die Auflage [des ‚Spiegel‘] nach unten“, die „Bild“ zufällig einfiel, nachdem der „Spiegel“ über den Auflagenrückgang von „Bild“ berichtete.
Die „taz“ glaubt es auch. Sie ließ die Quelle „Bild“ weg, machte sich die Interpretation aber zu eigen und vermeldete sie sogar unter der Überschrift „Nach Posse um Chefredaktion / „Spiegel“-Verkauf bricht ein“:
(…) Die Einzelverkäufe sind im vierten Quartal 2007 auf 337.500 Exemplare gesunken. (…) Ein Einbruch von fast 20 Prozent und das schlechteste Ergebnis seit 2003. Möglicherweise liegt das an der schlechten Presse, die im vierten Quartal ordnerweise über den Spiegel erschien und nicht gut fürs Image war.
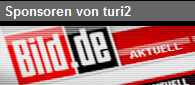 Und im Zweifel glaubt es auch „turi2“, der „Aufsteiger unter den Branchendienst für Medien und Kommunikation“ und BILDblog-Kritiker, der gestern berichtete:
Und im Zweifel glaubt es auch „turi2“, der „Aufsteiger unter den Branchendienst für Medien und Kommunikation“ und BILDblog-Kritiker, der gestern berichtete:
Übrigens hat die dilettanische [sic] Nachfolgersuche für Aust dem „Spiegel“ einen erheblichen Imageschaden verpasst: Im vierten Quartal 2007 ging der Einzelverkauf laut IVW um 20 Prozent zurück.
(Von einem Rückgang um 20 Prozent zu sprechen, wie „taz“ und „turi2“ es tun, ist ohnehin unzulässig, weil nur ein Vergleich mit dem Vorjahresquartal aussagekräftig ist; nicht der des Herbstes mit dem Sommer.)
taz.de und turi2.de demonstrieren auch schön die Attrappenhaftigkeit vieler Kommentarfunktionen. Unter beiden Artikeln stehen Kommentare von Lesern, die unter Verweis auf BILDblog schreiben, dass der behauptete Zusammenhang zwischen der Personalie Aust und dem Auflagenrückgang nicht stimmen könne. Und bei beiden Artikeln gibt es keine Reaktion auf diese Hinweise: Keine Korrektur, Ergänzung oder wenigstens Antwort eines Redakteurs oder Mitarbeiters in den Kommentaren. Das ist so interaktiv und Web-2.0-ig wie ein Anrufbeantworter.
Und wer glaubt noch, was in der „Bild“-Zeitung steht? Das Fernsehen natürlich. Die Mär, dass der Hai, der auf einem „Bild“-Leserreporter-Video zu sehen ist, 3,50 Meter lang sein soll, verbreiteten nach Informationen von BILDblog-Lesern gestern „Brisant“ (ARD) und „Hallo Deutschland“ (ZDF), ProSieben und der „Nachrichtensender“ N24 — und betonten dabei teilweise auch noch diese unglaubliche Länge, die schon bei einem Blick auf das Video selbst noch unglaublicher wird.