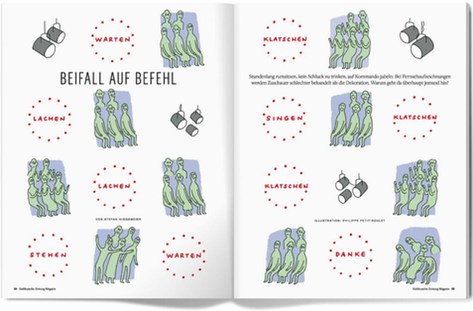Ich bin kein investigativer Journalist. Mir fehlen dafür nicht nur die Kontakte, sondern vor allem Ausdauer und Disziplin. Als mir das „SZ-Magazin“ in der vergangenen Woche angeboten hat, hier einen Beitrag aus dem Heft über die Probleme deutscher Blogger zu veröffentlichen, wollte ich mir vorher nur kurz einen Eindruck von dem Autor machen und habe seinen Namen schnell mal gegoogelt. Nach einer Minute wusste ich immer noch nicht viel über diesen Felix Salmon, aber immerhin schon mehr als das „SZ-Magazin“, das behauptete, er betreibe das außerordentlich erfolgreiche amerikanische Wirtschaftsblog portfolio.com. („Portfolio“ ist kein Blog, es wird mangels wirtschaftlichem Erfolg gerade eingestellt, und Salmon bloggt da seit Wochen nicht mehr.)
Das herausgefunden zu haben, ist nichts, worauf ich stolz sein könnte. Ich hätte dieses Nachschlagen, das man kaum „Recherche“ nennen mag, für einen selbstverständlichen Reflex gehalten, bevor man einen Artikel von jemandem auf seiner Seite veröffentlicht, den man nicht kennt.
Ist es aber nicht. Das „SZ-Magazin“ hat denselben Beitrag auch anderen Medien angeboten, die ihn — im Gegensatz zu mir — veröffentlicht haben. Bei taz.de hat man die falschen Autorenangaben erst übernommen, aber inzwischen korrigiert. „Spiegel Online“ verlinkt immer noch sinnlos auf das „Wirtschaftsblog portfolio.com“; der Online-Auftritt der „Financial Times Deutschland“ behauptet nach wie vor den Unsinn, den das „SZ-Magazin“ über Salmon verbreitet hatte.
Man mag das für einen unwesentlichen Fehler halten, wie man jeden einzelnen Fehler für unwesentlich halten kann, aber ist das nicht erstaunlich? Das sind alles Online-Angebote, die sich bestimmt für Qualitätsmedien halten, und wenn sie so ein kostenloses Text- und PR-Angebot bekommen, reicht das eigene Engagement exakt dafür, mit einer schwungvollen Mausbewegung den Artikel aus dem Mailprogramm ins Redaktionssystem zu ziehen und auf „Veröffentlichen“ zu drücken? Es ist ihnen ganz egal, wer den Text geschrieben hat? Und es klickt nicht einmal jemand probeweise auf den selbst gesetzten Link unter portfolio.com und stutzt?
Mein flüchtiges Googlen war für diese Medien schon zu viel verlangt (schnellebiges Internet / Redaktionsstress / ist doch egal)?
Man müsste keine Zeile darüber verlieren, wenn nicht immer noch und gerade wieder mit zunehmender Heftigkeit dieser publizistische Krieg der etablierten Medien gegen die neue Konkurrenz tobte. Im Mittelpunkt steht fast immer die Behauptung, dass nur der professionelle Zeitungsjournalismus die Qualität garantiere, die Voraussetzung für eine informierte Debatte und eine aufgeklärte Gesellschaft sind.
Es sind die schlichtesten Gegensatzpaare, die da aufgestellt werden: Etablierte Medien recherchieren, informieren, prüfen und sind unbestechlich, Blogger plappern nach, krakeelen und fallen auf jede PR-Finte herein. Auch durch viele Texte der Sonderausgabe des „SZ-Magazins“ zur Krise der Tageszeitung, die sich selbstkritisch und nachdenklich geben, wabert das Gefühl eigener Überlegenheit oder, schlimmer: Das Gefühl, dass diese Überlegenheit selbstverständlich ist.
Im Kapitel „F wie Fakten“ behauptet Andrian Kreye, dass die „neuen Medien die Generierung von harten Fakten“ erschwerten. Das halte ich für schlicht falsch. Kreye fügt hinzu:
Emotionen (Angst, Wut, Lust) und Glaube (an Religionen, politische Meinungen, das eigene Rechthaben) spielen im Netz mindestens eine so große Rolle wie Fakten.
Da möchte ihm nicht widersprechen, aber empfehlen, in dem Satz versuchsweise die Wörter „im Netz“ durch „in den Zeitungen“ zu ersetzen. Er verliert nichts an Wahrheit. Im Gegenteil, die schöne Formulierung vom Glauben an das eigene Rechthaben gewinnt erst richtig an Anschaulichkeit.
Auch Kurt Kisters Plädoyer unter „H wie Haltung“, dass Journalisten recherchieren, berichten und klug einordnen sollen, degeneriert am Ende zu einem plumpen Herabreden dessen, was Nicht-Journalisten publizieren:
Weder das Finden noch das Erklären von Dingen ist die Sache der berühmten 2.0-Bürgerjournalisten. Die können am besten kommentieren, was andere schon aufgeschrieben, schon kommentiert haben. (…) Eine Vielzahl der Blogs, Chatrooms und was es an Gezwitscher mehr gibt, besteht aus solchen Kommentaren der Kommentare anderer. Das ist oft einfach, befriedigend für alle und außerdem völlig in Ordnung. Es ist nur kein Journalismus, sondern eine manchmal durchaus interessante Mischung aus Meinungsäußerung, Stammtischgeschwätz und Laut-auf-dem-Bürgersteig-vor-sich-Hinschimpfen. Für die, die es mögen, ist es das Höchste. Die einen essen eben gern Vogelnester, die anderen fahren mit dem Fahrrad durch Nepal, und die Dritten schreiben irgendwo in der weltumspannenden Virtualität, dass Zeitungen Holzmedien sind und Journalisten moribund, altmodisch sowie wahnsinnig arrogant.
Das ist natürlich die hohe Kunst der Arroganz, es arrogant als Spleen abzutun, für arrogant gehalten zu werden. Aber das Problem ist nicht die Geringschätzung dessen, was im Netz passiert. Das Problem ist die eigene Selbstüberschätzung. Wieviele Journalisten erfüllen mit ihrer Arbeit Kisters Definition dessen, was Journalismus ist?
· · ·
Viele Journalisten, die sich in diesen Debatten über die Folgen der digitalen Revolution äußern, haben die Verklärung des zu verteidigenden Status-Quo perfektioniert: Es vergeht gerade kein Tag, in dem nicht irgendein Blatt voller Pathos zur Verteidigung des Urheberrechts gegenüber irgendwelchen „Piraten“ oder Google aufruft. Sie fordern, als sei es ein Menschenrecht, dass Autoren selbst entscheiden dürfen müssen, was mit ihren Texten geschieht, wo sie veröffentlicht werden, wer an ihnen verdient. In der aktuellen „Welt am Sonntag“, um nur ein Beispiel zu nennen, gipfelte das in der — zugegeben: tollen — Überschrift: „Mein Buch gehört mir.“
In diesem Empörungsgetöse fast vollständig ausgeblendet ist, dass die meisten freien Journalisten schon deshalb nicht von Google enteignet werden können, weil die Verlage das längst erledigt haben. Viele Zeitungsverlage verlangen von ihren Mitarbeitern, „Total-Buy-Out“-Verträge zu unterzeichnen, mit denen sie die Rechte an ihren Texten inhaltlich, räumlich und zeitlich unbeschränkt abgeben, inklusive der Rechte, diese Rechte an Dritte zu übertragen. Ist es nur der Gipfel der Heuchelei, wenn Zeitungen diese eigene Praxis beim Kampf gegen Google ausklammern, oder schon eine Form von Schizophrenie?
Marc Felix Serrao schrieb in der „Süddeutschen Zeitung“ über den skandalösen Umgang des „Nordkurier“ mit seinen freien Mitarbeitern, die „das unbeschränkte Nutzungsrecht“ an ihren Leistungen abtreten müssten: „Das ist zwar Usus für Festangestellte, aber nicht für Freie, die sich finanziell von Auftrag zu Auftrag hangeln.“ Ich fürchte, er glaubt das wirklich.
Überhaupt, die „Nordkurier“-Geschichte. Die SZ berichtete am Freitag, dass sich dort unter dem Regime des berüchtigten Geschäftsführers Lutz Schumacher freie Mitarbeiter neuerdings in einer Online-Börse um Termine und Themen bewerben müssen. Der Autor schrieb wörtlich:
Der Nordkurier vergibt keine Aufträge mehr an Freie oder nimmt deren Text- und Bildangebote an, sondern schreibt die von ihm gewünschten Fotos und Artikel in einer Art Online-Börse aus. Wer will, kann sich dann bewerben und ein Honorarangebot abgeben. Allerdings muss er erst der Rahmenvereinbarung zustimmen.
Soweit die Formulierungen der „Süddeutschen“. Und hier zum Vergleich die Formulierungen, die der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) vier Tage zuvor in einer Pressemitteilung gewählt hatte:
Der Nordkurier vergibt keine Aufträge mehr an Freie und nimmt auch keine Text- und Bildangebote mehr von ihnen an, sondern schreibt die gewünschten Fotos und Artikel in einer Online-Börse aus. Die freien Journalisten können sich dann um das Thema bewerben und ein Honorarangebot abgeben. Voraussetzung dafür ist, dass sie vorher einer Rahmenvereinbarung zustimmen, mit der sie Rechte “für alle Nutzungsarten” an den Verlag abtreten.
Immerhin hat die SZ nicht nur die Formulierungen der Gewerkschaft ungekennzeichnet in ihren Artikel kopiert, sondern auch mit Schumacher gesprochen und zitiert ihn mit dem Satz, der Honoraretat seiner Zeitung werde nicht gesenkt. Die Frage der Honorare ist ohnehin eher ein Nebenaspekt in dem Artikel. Zur Hauptsache machte ihn der Branchendienst „turi2“. Aus der SZ-Formulierung, dass die Freien beim Nordkurier „sich bewerben und ein Honorarangebot abgeben“ müssen, wird bei turi2:
Drei, zwei, eins — dem billigsten seins: Der „Nordkurier“ aus Neubrandenburg schreibt sämtliche Text- und Bildaufträge auf einer Ebay-ähnlichen Plattform im Web aus. In der Onlinebörse „Nordost-Mediahouse“ sollen Journalisten ihre Honorarangebote zu Berichten vom Kaninchenzüchterverein und Co machen — und der billigste Anbieter bekommt den Zuschlag.
Hahaha, „dem billigsten seins“. Inzwischen ist das meiste davon durchgestrichen, denn nach den Worten Schumachers gibt es beim „Nordkurier“ feste Honorarsätze — es gehe keineswegs um den Preis. (In der Korrektur gibt turi2 natürlich nicht sich, sondern der „Süddeutschen“ die Schuld. Sie hätte behauptet, die Texte würden an den Journalisten mit dem niedrigsten Angebot vergeben. Es muss sich um eine Halluzination handeln.)
Aber „turi2“ war nicht das einzige Medienangebot, das alle Energie in die Maximierung der Lautstärke investierte, und keine in die Recherche. Auf „Meedia“ schrieb sich Chefredakteur Georg Altrogge in Rage und beklagte wort- und wutschaumreich das Lohndumping. Über die genaue Regelung beim „Nordkurier“ wusste er allerdings so wenig wie über die Lage der Stadt Neubrandenburg, die er von Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg verlegte.
(Dass die Honorare, die der „Nordkurier“ seinen Freien zahlt, erbärmlich sind, steht außer Frage. Und Schumachers Argument, die meisten freien Mitarbeiter seiner Zeitung seien eh Studenten, Hausfrauen und pensionierte Lehrer, merken wir uns dann für die nächste Diskussion der „Nationalen Kommission Printmedien“ darüber, wie wichtig der Erhalt dieses hochwertigen Lokaljournalismus für unsere Gesellschaft ist.)
Auch „Spiegel Online“ übernahm ungeprüft die Behauptung von der Versteigerung der Aufträge und musste sich hinterher berichtigen.
Bis hierhin sind an der Produktion, Verbreitung und Verschlimmerung einer Falschmeldung ausschließlich hauptberufliche Journalisten beteiligt. An welcher Stelle dieser Geschichte, Herr Kister, finden wir den viel beschworenen Journalisten, der prüft und wägt, recherchiert und einordnet?
Ich ahne schon, welcher Einwand jetzt von den Turis, Meedias und SpOns kommt: Sollen wir denn jede Meldung prüfen? Müssen wir uns nicht auf eine Quelle wie die „Süddeutsche Zeitung“ verlassen können? Ich glaube, dass die Frage die falsche ist. Denn die entscheidende Perspektive ist nicht die der Macher, sondern der Leser. Welchen Nutzen hat es für ihn, wenn immer mehr Journalisten damit beschäftigt sind, dieselben wenigen Inhalte zu vervielfältigen, ungeprüft, aber verzerrt durch immer weitere Erhöhung der Lautstärke? Welchen Wert hat für ihn ein System, das Falschmeldungen inflationiert?
· · ·
Miriam Meckel schreibt heute in der F.A.Z.:
Bislang ist es der Journalismus, der die Menschen mit Neuigkeiten aus der Welt versorgt, sie durch gut recherchierte und erzählte Geschichten interessiert und fasziniert.
Ist es nicht faszinierend, wie in all diesen Qualitätsjournalismus- und Zeitungsverteidigungsartikeln das einfach immer als gegeben hingestellt wird, dass unser real existierender Journalismus seine gesellschaftliche Aufgabe erfüllt? Die Wörter „gut recherchiert“ stehen einfach in diesem Satz herum, gucken unschuldig und versuchen, nicht weiter aufzufallen. Im Gegensatz dazu:
Das Internet hat dem professionellen Qualitätsjournalismus einen bunten Strauß an publizistischen Aktivitäten an die Seite gestellt, bei dem Amateure zu Autoren werden, die eine subjektive, volatile und momentorientierte Berichterstattung praktizieren.
Sie meint das nicht böse, aber wir können gerne einmal gemeinsam eine durchschnittliche Tageszeitung, vermutlich auch eine überregionale Tagespresse, durchblättern und schauen, wie viele Filzstifte wir brauchen, wenn wir alle subjektive, volatile und momentorientierte Berichterstattung darin durchstreichen wollen.
Meckel geht noch weiter und malt sich eine Zukunft ohne Journalisten aus:
Wie in einer Dienstleistungsgesellschaft, in der sich alle nur noch gegenseitig die Haare schneiden, bereiten wir am Computer die Informationen der anderen aus dem Netz neu auf, gefangen in einer Zeit- und Inhaltsschleife der fortwährenden Reproduktion und Rekombination des immer Gleichen.
Wie kommt dann das Neue in die Welt? Gar nicht. Es wird lediglich simuliert als Ergebnis der innovativen Verlinkung von Altbekanntem.
Das ist ein süßer Gedanke, wenn man weiß, dass es reicht, eine Pressemitteilung im Abstand von mehreren Monaten noch einmal zu schicken, damit sie von Journalisten als neue Nachricht verkauft wird, aber im Ernst: Ich möchte in keiner Welt ohne professionellen Journalismus leben, aber diese Dystopie entbehrt jeder Grundlage. In einer Welt ohne Journalisten gingen uns die Neuigkeiten nicht aus, und wir würden einander auch nicht alle dasselbe erzählen. Die Lawblogger würden uns Neuigkeiten aus den Gerichtssälen erzählen, Parteimitglieder über neue Gesetzesentwürfe streiten, Foodblogger neue Restaurants erkunden, Medizinprofessoren kritisch neue Medikamente bewerten und chinesische und iranische Blogger uns mit Einblicken in ihr Leben bereichern.
Was fehlen würdem in einer Welt ohne Journalismus, ohne Massenmedien, wäre neben den großen Plattformen für einen Diskurs der Gesellschaft vor allem das Sortieren und Gewichten, die Systematik und Kontinuität. Fehlen würde eine Struktur, die dafür sorgt, dass die Berichterstattung über wichtige Themen nicht davon abhängt, ob sich zufällig ein Blogger für sie interessiert oder sie sich unmittelbar rechnet, und die die größtmögliche Chance bietet, dass diese Berichterstattung professionell und unabhängig geschieht.
Meckel schreibt:
Wir brauchen Menschen, die von ihrem Schreibtisch aufstehen und sich von ihrem Computer lösen, um zu beobachten, was in der Welt geschieht. Wir brauchen Menschen, die unter Recherche mehr als die Eingabe eines Begriffs in eine Suchmaschine verstehen. Die mit anderen Menschen sprechen, um zu verstehen, was sie bewegt und ihr Leben bestimmt. Wir brauchen Menschen, die diese Geschichten so erzählen können, dass andere sich für sie interessieren.
Ja! Aber wir brauchen Menschen, die unter Recherche schon einmal mindestens die Eingabe eines Begriffs in eine Suchmaschine verstehen. Und ist es nicht eine bizarre Verklärung, die relativ kleine Elite professioneller Journalisten mit Draußen und In der Welt gleichzusetzen, die vielen Menschen, die aber dort sind, wo die Journalisten erst hingehen sollen, als Stubenhocker zu beschreiben, die den Blick nicht vom heimischen Computer nehmen?
· · ·
Wir brauchen professionellen Journalismus, und wenn ich es mir aussuchen kann, dann bitte auch in Zukunft nicht nur online, sondern auch auf Zeitungspapier. Aber wir brauchen ihn nicht als verklärtes Ideal, das seine Unverzichtbarkeit behauptet, sondern einen Journalismus, der ganz konkret täglich seine Zuverlässigkeit beweist. Einen Journalismus, der transparent ist, seine Unzulänglichkeiten offenlegt und seine Fehler korrigiert, der hingeht, wo es wehtut, sich die Zeit nimmt, die nötig ist, der recherchiert statt kopiert und Verantwortung für die Folgen seiner Arbeit übernimmt.
Wenn der Zeitungsjournalismus so wäre, wie er in den vielen Zeitungsjournalismus-Verteidigungstexten beschrieben wird, dann müssten Zeitungen zum Beispiel in der gegenwärtigen Auseinandersetzung um die Zukunft des Urheberrechts der Ort für die gepflegte Debatte sein, allen begründeten Standpunkten ihren Raum geben, abwägen und differenzieren und die eigenen Interessen deutlich machen. Ich sehe stattdessen an vielen Stellen Zeitungen als Propagandainstrumente in eigener Sache, die einseitig und penetrant Stimmung machen und dabei grotesk übertreiben. Es ist das Gegenteil einer vertrauensbildenden Maßnahme.
Wie überzeugend sind all diese Plädoyers für die Großartigkeit, die Einzigartigkeit des Zeitungsjournalismus, den wir haben, wenn die Menschen im Alltag das Gegenteil erleben? Wie sehr würde sie, zum Beispiel, die Leute überzeugen, die gegen den Weiterbau einer Autobahn demonstrieren und feststellen müssen, dass die lokale Monopolzeitung, die für den Weiterbau ist, ihre Aktion bewusst so fotografiert hat, dass sie viel winziger wirkt als sie war?
· · ·
Das „SZ-Magazin“ hat für seine „Wozu Zeitung“-Ausgabe auch auf „turi2“ Anzeigen geschaltet. Sie führen zu einer Selbstbeschreibung, in der der Verlag dem Magazin „kreativen Journalismus auf höchstem Niveau“ bescheinigt. Ist es nicht ironisch, dass dieses sensationell anspruchsvolle Magazin in einer Ausgabe, in der er fast auf jeder Seite um Faktenliebe und Qualität und den gedruckten Journalismus als Garant von beidem geht, es nicht einmal schafft, den Hintergrund seines Gastautor Felix Salmon zu recherchieren? Und, schlimmer, seinen Text, der sich im Original mit dem (angeblichen) Fehlen spezieller Wirtschaftsblogs in Deutschland beschäftigt, flugs zu einer Analyse der deutschen Blogs schlechthin umdeklariert?
Überhaupt ist es interessant, sich die Form des Heftes genauer anzuschauen. Fast alle Texte sind Mini-Essays, die ohne all das auskommen, was angeblich den Zeitungsjournalismus so auszeichnet: die Vor-Ort-Recherche, das Neue-Fakten-Schöpfen. Es sind nette Artikel dabei, keine Frage, viele sind klug und gut geschrieben und manche sehr lesenwert. Aber eigentlich ähneln sie verblüffenderweise: Blog-Einträgen. Es sind aus persönlicher Betroffenheit geschriebene Kommentare. Das ist nichts Schlimmes (sagt ja auch Kister), bleibt aber doch verblüffend hinter den behaupteten eigenen Möglichkeiten zurück.
Aber die Autoren sind dann doch keine Blogger. „SZ“-Chefredakteur Hans-Werner Kilz schreibt unter „Q“ wie „Qualität“ zwar:
Wer schreibt, braucht kämpferisches Temperament, eine polemische Bereitschaft, eine Freude an Kontroversen.
Aber wenn ich es richtig gesehen habe, hat sich an keiner Stelle einer der Autoren dazu herabgelassen, tatsächlich mitzudiskutieren. Das „SZ-Magazin“ hat die Texte breit gestreut, damit andere über sie diskutieren können. Manche Kritiker haben positiv bemerkt, dass das „SZ-Magazin“ auf all diese Debatten verlinkt, und das muss man tatsächlich würdigen, weil die Online-Ableger der klassischen Medien gerade erst ganz langsam lernen, dass es im Internet die Möglichkeit gibt, Links zu setzen, die auf andere Seiten als die eigenen führen. Aber das reicht nicht.
Es ist natürlich auch eine Folge des Gefühls der eigenen Überlegenheit, dass viele Journalisten nicht im Traum auf die Idee kämen, mit Lesern in den Kommentaren über ihre Artikel zu diskutieren. Den Abstand zwischen dem, der etwas publiziert, und denen, die das lesen und — neuerdings — öffentlich darüber diskutieren dürfen, muss doch bitte gewahrt bleiben.
· · ·
Wir brauchen guten Journalismus und gute Journalisten. Aber wenn die Diskussion darüber, wie wir beides auch in Zukunft gewährleisten können, irgendwie konstruktiv sein soll, muss sie sich endlich von den falschen Gegensätzen verabschieden. Die Front verläuft nicht zwischen Profis und Amateuren oder Redakteuren und Freien oder Verlagen und Einzelkämpfern oder zwischen Print und Online. Sie verläuft zwischen gutem Journalismus und schlechtem Journalismus. Es ist wirklich so einfach.