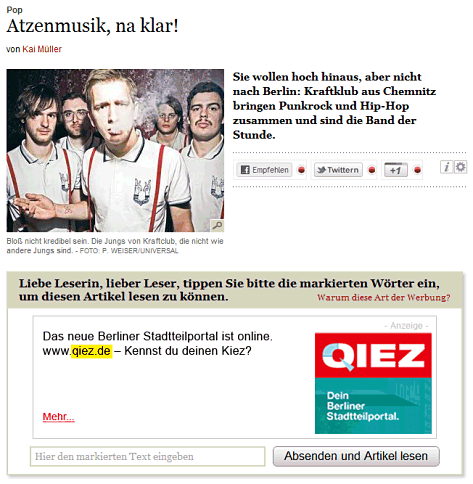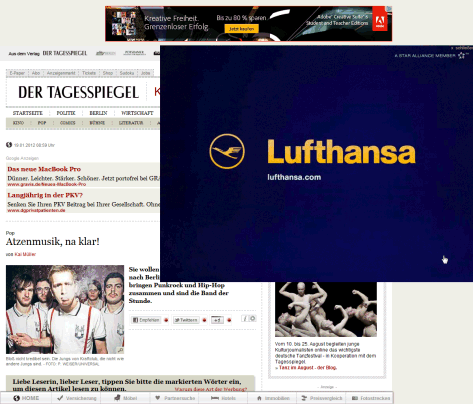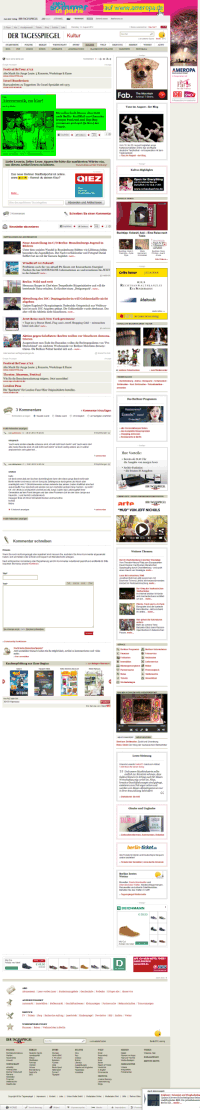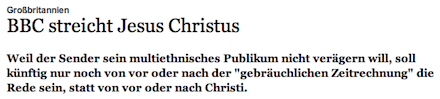Bisher ist alles, was mit Angela Merkel zu tun hat, historisch. Sie ist, zum Beispiel, die „Rekordkanzlerin“. Keiner war länger Bundeskanzlerin als sie. Gut, Konrad Adenauer und Helmut Kohl waren länger im Amt. Aber die waren ja nicht Kanzlerin, sondern bloß Kanzler. Kanzlerin war keiner länger als sie. Schon vom ersten Tag im Amt war sie die Kanzlerin mit der längsten Amtszeit in der Bundesrepublik. Das muss ihr erst mal jemand nachmachen! (Beziehungsweise: hätte ihr erst einmal jemand vormachen müssen.)
Nun sagen Sie nicht voreilig, das sei ja wohl der größte Unfug. Das ist nur einer von vielen Unfugen, die Stephan-Andreas Casdorff, der Chefredakteur des „Tagesspiegel“, am Wochenende online und am Montag leicht verändert Form auf Zeitungspapier veröffentlicht hat, und den größten davon auszuwählen, ist gar nicht so einfach.
Casdorff hat sich von den Spekulationen inspirieren lassen, die angeblich das politische Berlin umtreiben: Was passiert, falls Joachim Gauck nicht für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident kandidiert? Bis zur Wahl sind es nur noch zwei Jahre, und da ist es fast schon zu spät, Namen voreilig in die Diskussion zu werfen. „Spiegel Online“ berichtete vor einer Woche, dass der Name Frank-Walter Steinmeier bei der „Nachfolgedebatte in den Parteien und politischen Zirkeln Berlins“ „immer häufiger genannt“ werde.
Allerdings verpassten die Kollegen von „Spiegel Online“ – untypischerweise – die Gelegenheit, die Meldung maximal aufzusexen und sich vorzustellen, ob nicht auch Merkel 2017 Bundespräsidentin werden wollen würde. Das tat stattdessen der „Tagesspiegel“, und dessen Chefredakteur Casdorff nahm seine Leser deshalb mit auf eine faszinierende Reise durch seinen Kopf, den er extra vorher nicht aufgeräumt hatte. „Das klingt …“, begann er,
Ja, das klingt erst einmal weit entfernt: Bundespräsidentin Merkel. Und tatsächlich steht es auch nicht gleich morgen an, wenn je. Aber es steht die wahre Wirklichkeit dafür.
Es ist keine der anderen vielen Wirklichkeiten, in denen sich dieser „Tagesspiegel“-Chefredakteur so bewegt, die dafür steht, dass Angela Merkel – nicht morgen, vielleicht nie – Bundespräsidentin wird, sondern die wahre. Und wie tut sie das?
Irgendwann ist die Amtszeit eines jeden Regierungschefs zu Ende.
Tatsache. Irgendwann wird Merkel nicht mehr Kanzlerin sein. Das ist die wahre Wirklichkeit, und insofern steht die auch dafür ein, dass Merkel dann irgendetwas anderes sein wird; warum also nicht Bundespräsidentin?
Selbst die [Amtszeit] von Helmut Kohl war es mal [nämlich: zuende], obwohl eine ganze Generation dachte, er werde ewig Kanzler sein. So ist es auch bei seiner, sagen wir frei nach Willy Brandt, Politik-„Enkelin“ Angela Merkel. Gerade Kohl kann ihr ein Vorbild sein; in der Ausübung der Macht ist er es ja schon, obzwar unausgesprochen.
Obzwar „obzwar“ nichts anderes bedeutet als „wenngleich“, wertet so ein Wort einen Kommentar natürlich ungemein auf! Und lenkt womöglich davon ab, dass die Logik schon an dieser Stelle Casdorffs Kommentar fluchtartig verlassen hat. Denn wenn Kohl Merkel ein Vorbild wäre, würde sie ja gerade nicht davon ausgehen, dass ihre Amtszeit endlich ist und entsprechend einen selbstbestimmten Abgang planen, sondern sich immer weiter an das Amt klammern, obzwar erfolglos.
Keiner konnte sich seiner Konkurrenten so entledigen wie der Alt- und Rekordkanzler. Keine kann es wie die Rekordkanzlerin – die sie jetzt schon ist, als erste ihrer Art. Und das soll keine Verlockung sein: der erste selbstgewählte Abgang?
Nun: Für Kohl, den sie sich zwei Sätze zuvor noch als Vorbild nehmen sollte, war das gerade keine Verlockung, jedenfalls keine so große wie die minimale Chance, noch vier weitere Jahre im Amt zu bleiben. Aber dafür war Merkel ja auch, anders als Kohl, schon immer Rekordkanzlerin.
Natürlich ist es keine Schande, vom Souverän, vom Volk abgewählt zu werden. Etwas, das nach aller Wahrscheinlichkeitsrechnung ja dann doch irgendwann passiert. Diesen Zeitpunkt selbst zu gestalten, nicht zu erleiden, das wäre neu. Das wäre: historisch. So wie bisher alles, was mit Merkel zu tun hat. Die erste Kanzlerin ist sie schon, die erste Bundespräsidentin könnte sie werden, den Umstieg schaffen, was Konrad Adenauer nicht gelang, ihre Nachfolge regeln überdies.
Bisher alles, was mit Merkel zu tun hat, ist historisch, sagt Casdorff. Weil sie die erste Kanzlerin ist. Weil das historisch ist, ist vermutlich alles, was mit ihr zu tun hat, historisch. (Lustigerweise wäre es nach dieser Logik auch historisch, wenn sie nicht die erste Bundespräsidentin wird, denn das hat vor ihr auch noch keine Kanzlerin geschafft.)
Klar ist, dass Merkel nach ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin natürlich auch privatisieren kann.
Klar. Und das wäre, wie gesagt, auch historisch.
Sie hat vielfältige Interessen, die nicht im Geschäftlichen liegen.
Welche auch immer das sein mögen.
Das ist anders als bei ihrem Vorgänger, der hart daran arbeitet, dass man bald seinen Namen nicht mehr ohne Vorbehalte nennen mag, obwohl er sich wegen der Reformen um Deutschland verdient gemacht hat.
Ach guck: Der Schröder hat sich nur deshalb so blöd mit dem Putin eingelassen, weil er keine anderen Hobbys hat, mit denen er seine Tage füllen könnte?
Wegen ihres untadeligen Rufs ist Merkel für die CDU allerdings auch so viel mehr wert als der Ex-Kanzler für die SPD. Dieses Kapital muss nutzbar bleiben. Wie besser denn als Bundespräsidentin?
Ähm, vielleicht als Bundeskanzlerin? Solange ihr Ruf im Volk noch, wie war das, „untadelig“ ist?
Das klingt… Weit entfernt? Genau betrachtet nicht. Merkel regiert schon präsidial, im Präsidialamt könnte das sogar noch ausgeprägter werden und eine Kräfteverschiebung zur Folge haben. „Die Kanzler in der Ära Merkel“ hieße es dann, nicht umgekehrt. Und die CDU könnte mit ihrer Strahlkraft sogar auch noch das Amt des Ersten der Exekutive halten.
Nun geht’s aber im Galopp. Wenn Merkel also als Bundeskanzlerin schon so bundespräsidentinnenhaft agiert, könnte sie als Bundespräsidentin ja noch bundespräsidentinnenhafter agieren, sagt Casdorff, wobei: Er sagt „regieren“, was streng genommen gar nicht das ist, was ein Bundespräsident tut. Eigentlich meint er also (womöglich), dass sie als Bundespräsidentin vergleichsweise bundeskanzlerinnenhaft agieren könnte. Jedenfalls fände das Volk es dann so toll, dass Merkel bundeskanzlerinnenhafte und superbundespräsidentinnenhafte Bundespräsidentin ist, dass sie dann auch jemanden von der Union zum Kanzler wählen würden. Wegen der Strahlkraft.
Das muss nicht Ursula von der Leyen sein, wie es schon heißt, der Regierungschef kann dann auch immer noch Thomas de Maizière heißen. Er würde dann in etwa so arbeiten wie als Kanzleramtsminister, vor allem administrativ also.
Also, kurz nochmal rekapituliert: Wenn Gauck nicht noch einmal antritt und wenn Merkel 2017 sich zur Wahl als Bundespräsidentin stellt und wenn sie gewählt wird und wenn Thomas de Maizière als Kanzlerkandidat der Union aufgestellt wird und wenn er eine Mehrheit bekommt – dann könnte er in etwa so arbeiten wie als Kanzleramtsminister, falls die Merkel als Bundespräsidentin das präsidiale Regieren übernähme.
Die SPD müsste, um diese strategische Entwicklung nicht zuzulassen, logischerweise den Beliebtesten aus ihren Reihen aufstellen und für eine Mehrheit in der Bundesversammlung kämpfen: Frank-Walter Steinmeier. Und weil alles mit allem zusammenhängt, müsste sie im Blick darauf ihre Koalitionsoptionen für Regierungen in den Ländern erweitern.
Natürlich würde die SPD das nicht tun, um einfach in möglichst vielen Ländern an der Regierung beteiligt zu sein, sondern um einer potentiellen (und historischen!) Bundespräsidentinnenkandidatin Angela Merkel eine Mehrheit in der Bundesversammlung entgegensetzen zu können.
Verzwickt ist das für die SPD deshalb, weil es das Bündnis Rot-Rot-Grün ins Zentrum der Überlegungen rückt; das will in der Partei, überhaupt in den drei Parteien, beileibe nicht jeder. Und Steinmeier zählt bekanntermaßen zu denen.
Ja, blöd. Steinmeier verhindert sich also quasi selbst als Bundespräsidenten. Und nun?
Sigmar Gabriel, der SPD-Parteichef, könnte von einem Kandidaten Steinmeier, wohlgemerkt Präsidentenkandidaten, nur profitieren. Dann stünde der nicht mehr als Kanzlerkandidat zur Verfügung (was Steinmeier vom Naturell her sowieso nicht so liegt wie das andere), und ein etwaiger Sieg würde umgekehrt die Chancen der SPD erhöhen, der ewigen Merkel in der Regierung zu entrinnen.
Hilfe! Wenn Steinmeier als Präsidentenkandidat antritt (weil er sich aufgrund von rot-rot-grünen Landeskoalitionen, die er nicht will, Chancen ausrechnet), kann Gabriel auch einfacher Kanzler werden? Weil Steinmeier ja entweder Bundespräsident ist oder nicht? Und Merkel ja entweder Bundespräsidentin ist oder nicht? Womöglich will der „Tagesspiegel“-Chefredakteur sagen, dass die Chance Gabriels, Kanzler zu werden, darin besteht, dass alle anderen außer ihm entweder erfolgreich oder erfolglos als Bundespräsident kandidieren, vielleicht habe ich das aber ganz falsch verstanden.
Das Ende seines Textes ist jedenfalls keine Hilfe:
Weit entfernt: Manchmal müssen wie in der Physik bei einem Experiment die Kräfte so weit wie möglich berechnet werden. Dennoch kann dabei etwas ganz anderes herauskommen. Möglich ist auch so eine Art politische Relativitätstheorie. Wenn keiner ein Experiment will, dann kann Joachim Gauck ja auch Bundespräsident bleiben.
Welches Experiment? Was hat Einstein damit zu tun? Verwechselt Casdorff vielleicht die Chaos- mit der Relativitätstheorie? Ist sein Text der Schmetterling, der mit seinem Flügelschlag einen Wirbelsturm im Schloss Bellevue auslöst? Und: Würde man diesen Artikel relativ blöd nennen? Oder bewegen wir uns hier in historischen Dimensionen?
 Ihren Ursprung nahm die Sparschweinente offenbar im „Daily Express“, der im Oktober 2005 sogar damit aufmachte. Als eines der ersten deutschen Medien übernahm sie noch im selben Monat die „B.Z.“.
Ihren Ursprung nahm die Sparschweinente offenbar im „Daily Express“, der im Oktober 2005 sogar damit aufmachte. Als eines der ersten deutschen Medien übernahm sie noch im selben Monat die „B.Z.“.