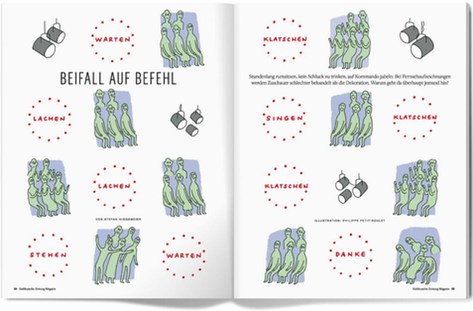Gehen wir zurück ins Jahr 1987 und blenden uns ein in die Rezension der damals noch an einer mittelschweren Parenthesie leidenden „Neuen Zürcher Zeitung“ über die Premiere von Thomas Gottschalk als Moderator von „Wetten, dass“:
Jedenfalls hat der ein überschweres Erbe antretende Gottschalk ein Début gegeben, das sich sehen lassen kann. Nicht mehr der mitunter enervierend „aufgestellte“ Zappelphilipp begegnete einem; zwar nicht domestiziert, aber – zu seinem eigenen Vorteil – zurückgebunden, führte er zunehmend unverkrampfter durch die Wettspielshow, liess die von ihm erwarteten sarkastischen Seitenhiebe nicht missen, dosierte sie aber unter Eliminierung jeder Schnoddrigkeit auf das zuträgliche Mass – und traf mehrheitlich ins Schwarze.
Kann sein, dass das Lampenfieber, das Gottschalk zu Beginn des Abends augenscheinlich gehörig plagte, eine heilsam dämpfende Wirkung zeitigte. Gerade die kleinen Unsicherheiten, die Versprecher, sekundenlang sichtbar werdende Hilflosigkeit, schlagen ja nicht a priori negativ zu Buche. Vielmehr dürften sie die Sympathie des Publikums erhöhen; denn wer mag schon einen perfektionierten Unterhaltungsroboter.
Gelingt es dem zweifellos über eine gute Portion Mutterwitz und handwerkliches Können verfügenden Gottschalk, weder programmierte noch programmierbare menschliche Unmittelbarkeit dieser Art beizubehalten, zugleich die paar negativ wirkenden Misstritte – etwa die abrupte Unterbrechung von Gesprächspartnern oder andere, sofort als Zeichen von Kaltschnäuzigkeit ausgelegte Ungereimtheiten im Umgang mit seinen Gästen – zu vermeiden, ist er auf einem guten Weg.
Mit „Wetten, dass“ stirbt heute auch das Genre der „Wetten, dass“-Kritik. Jemand müsste mal nachhalten, wie viele Quadratkilometer Platz dadurch jährlich in deutschen Tageszeitungen frei werden und wie viele Kapazitäten in den Online-Redaktionen. Abgesehen vielleicht vom „Tatort“ ist wohl keine Fernsehsendung hierzulande so manisch und obsessiv besprochen worden wie diese Show.
Eigentlich wollte ich zu deren Abschied eine ausführliche Würdigung des journalistischen Genres der „Wetten, dass“-Kritik schreiben. Aber der Textkorpus war einfach zu groß. Und die Auswertung zu ermüdend – auch wenn genau das das Ziel der Übung gewesen wäre: die Eintönigkeit und fehlende Originalität über die Jahre zu demonstrieren.
Sprachlich kommt an die oben zitierte NZZ-Kritik natürlich niemand heran. Allerdings bemühte sich auch die FAZ nicht unerfolgreich um eine gewisse Unverständlichkeit. In der Besprechung der ersten „Wetten, dass“-Sendung bestaunte sie am 16. Februar 1981 „die Macht des Apparates“:
Vor allem aber präsentiert das Fernsehen seine technische Potenz. Ein Computer für Zuschauervoten ist da, Direktschaltungen zu fernen Orten gelingen, Bildmontage, Verzerrer und Zeitlupe sind nötig. Aus dem bunten Abend, von dem die Unterhaltungsshow abstammt, ist ein gigantischer Jahrmarkt geworden, der etwas inzwischen Abstraktes vermitteln soll: Freude. Fast selbstverständlich sind die Mitspieler und auch der Moderator dem Apparat unterlegen: Was passiert, soll ganz unvorbereitet wirken. „Natürlich bin ich präpariert“, rief Curd Jürgens dazwischen. Die Kandidaten schmuggeln zwar noch etwas Persönliches in ihr Wettangebot ein, wie etwa die Geburtsdaten der Familie. Die Sendung aber schient etwas anderes von ihnen zu wollen, ein auf die Rolle reduziertes Verhalten. Die beiden Stars im Team mußten noch einmal ihre vergangenen „Images“ spielen, statt den dazu inzwischen gewonnenen Abstand darstellen zu können.
Vielleicht ist das der Grund, warum ihnen das Mitmachen so schlecht gelang. Frank Elstners auf Unmittelbarkeit zielende Gesprächsführung konnte sich nicht gegen den Apparat durchsetzen. Ein gieriger Zuschauer soll bedient werden, der sich am Monströsen ergötzt und alles sofort haben will.
Das Fernsehen bildet, das zeigten viele Elemente der Show, gegen die Beiträge seiner Mitspieler eine eigene Tradition aus, indem es auf frühere Sendungen zum Beispiel von Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kulenkampff und Lou van Burg zurückgreift. Es scheint so, als ginge im Verlauf dieser Tradition der Sinn der Einzelideen langsam verloren.
Sechs Jahre später verabschiedete die NZZ Frank Elstner aus der Show mit folgenden, offenkundig lobend gemeinten Sätzen:
(…) Frank Elstner ist im Grunde kein Showmaster, auch er ist nur ein Präsentator, einer jedoch, der sein Handwerk beherrscht. Dass er stets gut vorbereitet auf die Bühne kommt, dass er von seinen Gästen, die er aus den Reihen der politischen und der Bühnen- sowie der Sportprominenz holt, weiss, was es in diesen Augenblicken der Schaustellung und des leichtzüngigen Geplauders zu wissen gilt, das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Und dass er dieses zugeschnittene Wissen um Personen und Situationen heiter, gelassen und gängelnd seinem Publikum vorsetzt, lässt ihn sogar als intelligent erscheinen.
Sic!
Was Frank Elstner auszeichnet, womit er spielt, das ist sein Charme, ist die Liebenswürdigkeit, mit der er auf die Menschen, die Gäste also, die wetten, aber auch und vor allem die Konkurrenten im Wettbewerb, zugeht. Er biedert sich ihnen zwar nicht an, aber er ist auf eine ganz natürliche Art freundlich mit ihnen, lässt es an Respekt nie fehlen; er bringt Respekt nicht bloss vor Leuten von politischer Prominenz auf, in diesem Fall vor Oberbürgermeister Diepgen, sondern behandelt den kleinen Mann so umgänglich wie den grossen, und wie er diesem gegenüber nie unterwürfig wird, klopft er dem anderen nie auch in misslicher Jovialität auf die Schulter.
(…) Und auch jenem Zuschauer, dem das Unterhaltungsvergnügen eines solchen Showabends eher fremd ist, empfiehlt er sich in dieser seiner Natur.
Was mutmaßlich ungefähr bedeuten sollte: Natürlich gucke ich, der NZZ-Rezent, sonst so einen Quatsch nicht. Aber auch wenn es Quatsch ist, so ist es doch – zwar, aber – ganz ordentlich gemachter Quatsch.
„Wetten, dass“-Kritiken scheinen fast vom ersten Tag Abgesänge gewesen zu sein. Als Thomas Gottschalk 1987 zum ersten Mal moderierte, begann die „Süddeutschen Zeitung“ ihre Besprechung so:
Die große Samstagabend-Familienshow ist doch längst gegessen, sagen sie alle, die beim Fernsehen für Unterhaltung zuständig sind. Ein urdeutsches Fossil ist das, woanders gibt es so was längst nicht mehr. Wenn erst der Kuli nicht mehr mag und der Carrell aufhört, ist es sowieso aus.
Und als Thomas Gottschalk 1992 zum ersten Mal aufhörte, schrieb die „Welt“:
Gottschalk tritt ab von der Bühne der Samstagabendunterhaltung. Das ist schade, weil mit ihm endgültig auch das Familienfernsehen ihr [sic!] Ende gefunden hat.
Seinen Nachfolger Wolfgang Lippert begrüßte die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ mit perfidem Lob:
Es ging nichts daneben, Lippert ist ein ausgelernter Profi des Gewerbes. Er hat es in der verblichenen DRR gelernt und praktiziert. Wir müssen uns allmählich daran gewöhnen, daß es zu den Eigenschaften totalitärer Staaten gehört, nebenbei eine Bevölkerung, die nicht viel zu lachen hat, mit ordentlich ausgebildeten Volksbelustigern bei Laune zu halten. Die Leute, die das Metier beherrschen wie Lippert, sind ganz einfach gut ausgebildet. In seinem speziellen Fall sind sie sogar auf dem Weg, richtig gut zu werden. Lippert ist schnell, sympathisch, witzig und – völlig humorlos.
Er ist ein Symptom und nicht allein daran schuld, daß einen „Wetten, daß…?“ von Sendung zu Sendung immer verdrießlicher stimmen kann.
Lippert ging wieder, Gottschalk kam wieder, und die FAZ notierte zu seiner Rückkehr im Januar 1994 sorgfältig, was er alles nicht falsch gemacht habe:
Gottschalk unterlief in der Tat kein Fehler. Er entgleiste nicht im Gespräch mit Heinz Rühmann. Den reizenden alten herrn so sanftmütig zu umsorgen zeugte von liebenswürdiger Beißhemmung. Niemand kann hier etwas einwenden. Er beleidigte keine Kandidaten, und er hatte – wohl eher Verdienst der perfekten Logistik seines Teams – mit den „Scorpions“, der am besten als Hard-Rocker verkleideten Combo der Nation, und mit Meat Loaf stromlinienförmige Musikeinlagen.
Man könnte ein Quiz machen mit Versatzstücken aus „Wetten, dass“-Kritiken und fragen, ob sie zwei, zwölf oder zweiundzwanzig Jahre alt sind und in welche Moderatoren-Ära sie gehören. Es wäre ein sehr, sehr schweres Quiz. Das hier zum Beispiel:
Eines steht fest: Hätte der immer zu Gelächter bereite Sonnyboy diese Mischung aus selbstdarstellerischen bzw. nervösen Gesten und nicht gerade von den Sitzen reißenden Wetten vor einem Monat abgeliefert, wären die Kritiker des Moderatorenwechsels in den meisten ihrer Befürchtungen bestätigt gewesen. (…) Die Diskrepanz zwischen penetranter Eigenwerbung der Prominenten aus Politik, Kultur und Sport und ihrer späteren Überflüssigkeit, die läppische Einlösung der Wetteinsätze noch innerhalb der Sendung und die an sich gut gemeinte Kinderwette, aus der aber eine Präsentation von altklugen Vorschulsonderlingen zu werden droht, ist offensichtlich nicht der Weisheit letzter Schluß.
Das würde, mit kleinsten Variationen, zu fast jedem Moderator nach Elstner passen. Es war die Kritik der „Stuttgarter Zeitung“ vom 9. November 1992, also nach der zweiten Sendung mit Wolfgang Lippert.
Oder das hier:
Weil [der Moderator] den Leuten fast auf dem Schoß sitzt, jede Fremdheit leugnend, die erst Neugier möglich macht, kann er keine richtigen Fragen stellen. So fehlen jenseits einer gewissen Flottheit des Augenblicks auch Ironie und Selbstironie in seinem Programm. Anflüge von Humor werden da schon als Höchstleistung gefeiert. Der Rest aber ist Fröhlichkeit zum Anfassen. Auch wenn man gar nicht lacht.
Auflösung: Nicht Gottschalk, nicht Lanz, auch Lippert. In der FAZ aus Anlass seiner „Dernière“ Ende 1993.
All die Abgesänge auf „Wetten, dass“, sie sind in den letzten dreißig Jahren alle schon einmal geschrieben worden. Die „Berliner Zeitung“ im November 2000:
12,8 Millionen Zuschauer, 40 Prozent Marktanteil. Blendende Zahlen für das ZDF. Wie immer mit Gottschalk.
Aber diese Ergebnisse erscheinen inzwischen wie schwerfällige Gewohnheiten, wie ein Echo, dessen kräftiger Anfangsschrei lange zurückliegt. Es ist wie mit einer Ehe, die langsam erlischt, der Sex bleibt auf der Strecke, auch wenn man noch das Bett teilt. Thomas Gottschalk hat an Qualität verloren.
Der „Tagesspiegel“ stimmte einen Monat später zu:
Man ist noch kein Denkmals-Stürmer, wenn man „Wetten, dass…?“ die Qualität des ewigen Selbstläufers abspricht. Die ZDF-Show ist stehen geblieben. Sicher, kaum ein Mega-Star, der sich nicht aufs Sofa quetschen lässt, unbestreitbar, dass Gottschalk seine Live-Sendung fest im Griff hat. Aber das Berechenbare kann auch enttäuschen. Bestimmt wird Gottschalk immer den Unsicheren geben, wenn ein Super-Super-Model auftaucht, er wird Röcke, Selbstgehäkeltes und blondes Wallehaar tragen, mit präsentem Wortwitz punkten. Die Überraschungsmomente sind ganz, ganz klein geworden. Bei den Wetten überfällt den Zuschauer immer öfter das Gefühl, mehr mit Varianten von erprobter Geschicklichkeit als mit origineller Geschicklichkeit gelockt zu werden. In der jüngsten Ausgabe wurde die Reprise einer Wette von 1983 angeboten.
Das einzige, was vielleicht noch berechenbarer war als „Wetten, dass“: die Besprechungen von „Wetten, dass“.
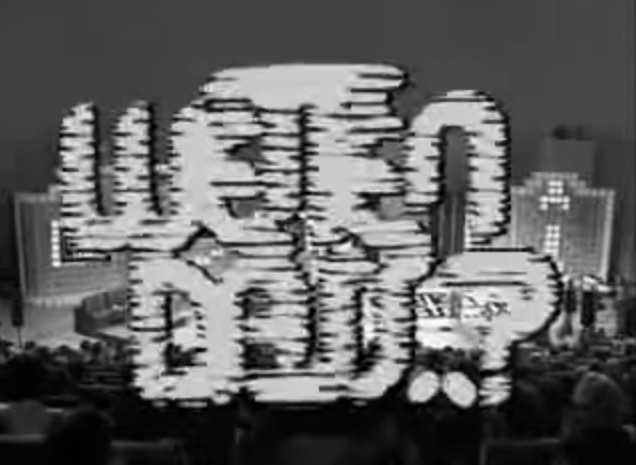
Nachtrag, 16 Uhr. Für die FAZ habe ich zum Abschied der Sendung darüber geschrieben, wie „Wetten, dass“ immer als etwas Bedeutungsvolles behandelt wurde.