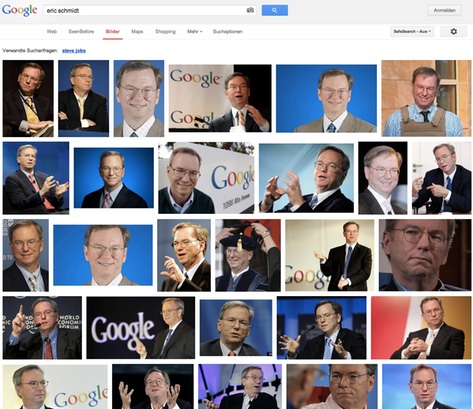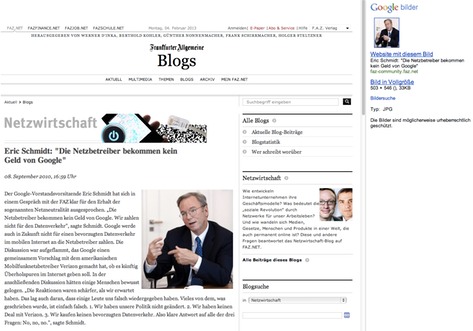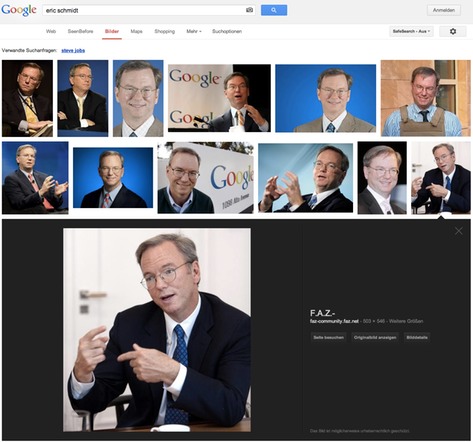Vermutlich werde ich es bereuen, Julia Schramm zu verteidigen, aber bei einer Frau, die so viele tatsächliche Angriffspunkte für Kritik bietet, erscheint es mir besonders abwegig, sie noch für Dinge zu beschimpfen, die sie gar nicht getan hat.
Die Piraten-Politikerin Julia Schramm hat ein Buch geschrieben, angeblich für ein gutes Honorar. Jemand hat das Buch bei Dropbox hochgeladen, wo man es sich kostenlos herunterladen konnte, bis der Verlag erreichte, dass es gelöscht wird.
Angeblich steckt darin eine große Ironie und ein Beweis für die Verlogenheit der Piraten insgesamt. Denn eigentlich, so geht die Argumentation, seien die Piraten doch dafür, dass man sich an urheberrechtlich geschützen Inhalten einfach frei bedienen kann. Um es auf die unnachahmliche Art von Bild.de zu formulieren:
Wasser trinken und Wein predigen ist auch bei den Piraten schwer in Mode.
(Sic!, inzwischen korrigiert.)
Bild.de meint, es sei „eine Geschichte so grotesk wie eigentlich auch komisch“:
Julia Schramm selbst hat die Idee des geistigen Eigentums als „ekelhaft“ bezeichnet. Doch bei ihrem eigenen Buch sieht sie das plötzlich ganz anders.
Das Wort „ekelhaft“ hat eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf fast alle, die über Julia Schramm und ihr vermeintlich bigottes Verhältnis zum Urheberrecht schreiben. Es fiel im April in einem Podcast, den man sich hier anhören kann. Sie sagt darin wörtlich:
Das ist das Ekelhafte an dem Begriff [geistiges Eigentum], das ist das Widerliche an dem Begriff: Dieser Begriff wird genutzt, um Immaterialgüter auf Grundrechtsniveau zu heben. Und das ist ein Problem.
Sie lehnt nicht das Urheberrecht ab, sondern den Begriff des „Geistigen Eigentums“. Man muss natürlich nicht ihrer Meinung sein, aber das ist eine Position, für die es gute Gründe gibt. Der Begriff des „Geistigen Eigentums“ ist eine Metapher, die Parallelen zwischen materiellen und geistigen Gütern behauptet, die nicht zwingend vorhanden sind. Sie suggeriert zum Beispiel, dass das Anfertigen einer illegalen digitalen Kopie dasselbe ist wie der Diebstahl eines Gegenstands, und wird entsprechend häufig als Kampfbegriff benutzt.
Wolfgang Michal hat auf „Carta“ einen lesenswerten Beitrag über die Entstehung und Problematik des Begriffs vom „Geistigen Eigentum“ geschrieben. Er plädiert dafür, dass Netzaktivisten ihn nicht mehr bekämpfen, sondern ihm sein „ideologisches Mäntelchen ausziehen“ sollen.
Jedenfalls ist es möglich und argumentativ nachvollziehbar, wenn jemand den „Begriff“ des „Geistigen Eigentums“ „ekelhaft“ findet, und trotzdem das Urheberrecht nicht ablehnt.
Julia Schramm sagt in dem berüchtigten Podcast ausdrücklich:
Die Piraten wollen das Urheberrecht nicht abschaffen.
Und sie spricht sogar damals schon, im April, dezidiert darüber, was ihre Haltung zum Urheberrecht für den Umgang mit ihrem Buch und möglichen illegalen Kopien bedeutet:
Ich versuch das auch gerade meinem Verlag zu vermitteln. Ich saß in so’ner Vertreterkonferenz und dann kam die Marketinchefin und sagte: „Ja, Frau Schramm, wie sieht das denn aus, wenn das illegal runtergeladen wird?“ Ich so: „Naja gut, ich will natürlich, dass die Leute dafür bezahlen, aber ich will auch nicht, a), dass Sie sie behandeln, als wären das Mörder, und, b), dann schaffen Sie doch legale Angebote. Es müssen legale Angebote geschaffen werden.“
Worin soll nun der Widerspruch zwischen diesen Äußerungen vorher und dem aktuellen Vorgehen von ihr und ihrem Verlag bestehen? Was genau ist die Heuchelei?
Das Hauptproblem an der Durchsetzung des existierenden Urheberrechtes sieht Schramm laut Podcast in der Kriminalisierung der Nutzer sowie in der Gefahr, dass sich die Weitergabe und das Anfertigen illegaler Kopien nur durch eine totale Überwachung von Kommunikation verhindern ließen. Beides passiert aber in diesem Fall nicht.
Im übrigen demonstriert das Gespräch eindrucksvoll, wie wenig Schramm von einem Thema wissen muss, um sich dazu meinungsstark zu äußern, aber davon mal ab: Sie hat nicht das Urheberrecht als „ekelhaft“ bezeichnet, sondern den Begriff des „Geistigen Eigentums“. Die Frage ist nun: Wollen oder können Journalisten den Unterschied nicht verstehen? (Nicht-Journalist und Julia-Schramm-Hasser „Don Alphonso“ schreibt es auf FAZ.net natürlich auch falsch auf.)
Das Online-Angebot der „Süddeutschen Zeitung“ musste seinen Artikel zum Thema schon nachträglich korrigieren. Die beiden Autoren hatten Schramm mit den außerordentlich sinnlosen Worten zitiert:
„Ich lehne nicht das Urheberrecht, sondern den Begriff des Urheberrechts ab, weil er ein Kampfbegriff ist.“
Gesagt hatte sie aber:
„Ich lehne nicht das Urheberrecht, sondern den Begriff des geistigen Eigentums ab, weil er ein Kampfbegriff ist.“
Verstanden hat sueddeutsche.de den Unterschied aber immer noch nicht. Am Ende des Artikels heißt es:
Wie Spiegel Online berichtet, hatte die Piratin das Urheberrecht in einem Podcast als „ekelhaft“ bezeichnet.
Nein, das hat sie nicht, und das berichtet auch „Spiegel Online“ in dem von sueddeutsche.de verlinkten Artikel nicht. „Spiegel Online“ formuliert dort nur, „Julia Schramm findet geistiges Eigentum ‚ekelhaft'“, was allerdings natürlich auch irreführend ist.
Die „Bild“-Zeitung nennt Schramm heute die „gierige Piratin“ und fragt: „Wie verlogen ist diese Partei?“ Dabei sollte, wenn überhaupt jemand, doch dieses Blatt Verständnis aufbringen für den Unterschied zwischen Theorie und Praxis bei diesem Thema. Welcher Kleptomane verteidigt sonst so entschieden die Idee, dass man nicht stehlen darf?
Am Mittwochabend hat Bild.de im Jagdrausch noch einmal nachgelegt und treibt die Verleumdung der Politikerin auf die Spitze:
Der eigentliche Aufreger ist eine andere Tatsache. Schramm bezeichnete Urheberrechte einst als „ekelhaft“. Jegliches geistiges Eigentum sollte ihrer Meinung nach für alle gratis zur Verfügung stehen.
Das gilt aber anscheinend nicht für sie.
Falsch. Und weiter:
In der Zeitung „Die Welt“ hat sich Schramm dazu jetzt in einem Interview geäußert. Auf die Frage, ob sie das Vorgehen gut finde, versucht Schramm das als generöse Geste zu verkaufen: „Ich bin froh, dass mein Verlag und ich uns dazu entschieden, nicht gleich eine hohe Strafzahlung zu fordern, sondern zunächst eine kostenpflichtige ‚Gelbe Karte‘ zu vergeben.“
Nein, das hat sie nicht gesagt. Der Satz lautet wörtlich (Hervorhebung von mir):
„Ich bin froh, dass mein Verlag und ich uns dazu entschieden haben, nicht gleich eine hohe Strafzahlung zu fordern, sondern zunächst eine nicht kostenpflichtige ‚Gelbe Karte‘ zu vergeben.“
Welche Möglichkeit ist beunruhigender? Dass die Leute bei Bild.de sogar zu doof sind, einen Satz zu kopieren, ohne seinen Sinn ins Gegenteil zu verkehren? Oder dass sie den Kampf gegen ihre politischen Gegner mit solch plumpen Lügen und Fälschungen führen?
Nachtrag, 13:00 Uhr. Sueddeutsche.de hat sich transparent korrigiert, Bild.de unauffällig, als wäre nichts gewesen.