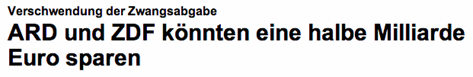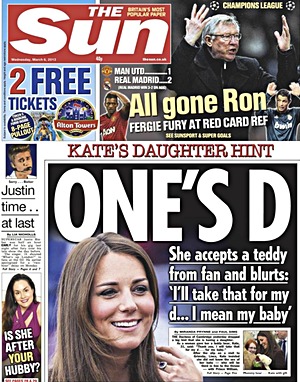Philipp Gut mag keine Schwulen mehr sehen. Wo er auch hinguckt, sind Homosexuelle: in der Politik, im Militär, auf der Straße, im Internet, selbst in den Schulen. Philipp Gut fühlt sich davon belästigt. Er hat nichts gegen die Leute an sich, und eigentlich auch nichts gegen ihre Homosexualität. So lange sie sie nur verstecken. Jetzt, da Homosexualität nicht mehr diskriminiert werde, sagt er, gebe es auch keinen Grund mehr, sie zu zeigen.
Philipp Gut ist Kultur- und Gesellschaftschef der „Weltwoche“. Die Schweizer Wochenzeitung hat sich unter Roger Koeppel geschickt eine publizistische Nische erobert, indem sie all die überwundenen geglaubten Ressentiments von ihrem muffigen Geruch befreit und neu als frischen Kampf gegen vermeintliche Denkverbote des vermeintlichen Mainstreams verkauft.
Guts Beschwerde über die „Homosexualisierung der Gegenwart“ erschien dort im Sommer, und der Text war dumm und homophob genug, um gestern von der „Welt“ recyclet zu werden. Über dreieinhalb Monate später wirken die konkreten Beispiele in dem Artikel zwar merkwürdig inaktuell, aber die Ignoranz und Bösartigkeit der Argumentation ist zweifellos zeitlos.

Philipp Gut verbrämt seine Ablehnung von Homosexualität hinter der Behauptung, sie sei „zu einer Art Religion“, ein „Glaubenssystem“ geworden:
Wer sich outet, wird zum leuchtenden Märtyrer einer bekennenden Kirche.
Nun ist es ein bisschen bedrückend, dass ein Kulturchef die Bedeutung des Wortes „Märtyrer“ nicht kennt. Vermutlich wollte er einfach „Helden“ oder gar „Heiligen“ sagen. Aber er belegt ohnhin nicht einmal im Ansatz, worin eigentlich dieses „Glaubenssystem“ besteht, was das quasi Religiöse daran sein soll, dass viele Menschen ihr Schwul- und Lesbischsein nicht mehr verstecken.
Nein, es geht nicht um Religion. Es geht darum, dass Philipp Gut eine Art gesamtgesellschaftliches „Don’t Ask Don’t Tell“ fordert. Er schreibt:
Man braucht nur ein paar Minuten im Internet zu surfen, um auf alle möglichen Interessen- und Lobbygruppen zu stoßen.
Das Angebot reicht von den Schwulen Eisenbahnfreunden in Deutschland über die Schwulen Väter und den LesBiSchwulen Jugendverband bis zu schwulen Offizieren und Polizisten.
Ist das nicht schön? Menschen mit gleichen Interessen tun sich zusammen. Solange der Verein Schwuler Eisenbahnfreunde niemanden zwingt, bei sich Mitglied zu werden, wüsste ich nicht, was man dagegen haben könnte – oder was es Herrn Gut überhaupt angeht. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es gerade für Soldaten oder Polizisten auch im Jahr 2009, auch in Deutschland nicht immer ganz einfach ist, schwul zu sein oder gar zur eigenen Homosexualität zu stehen, und so ein Verband sehr hilfreich sein kann.
Philipp Gut spricht von einem „Siegeszug des schwulen Lifestyles“. Ich weiß nicht, was er damit meint. Ich weiß allerdings, dass sich ein Guido Westerwelle von den Oliver Pochers dieser Welt immer noch schlechte Schwulenwitze anhören muss. (Gut selbst macht auch einen kleinen Witz, der aus den sechziger Jahren oder der sechsten Klasse kommen könnte, und spricht von der „pardon: Penetrierung des öffentlichen Lebens mit der Homosexualität“. Da weiß man wenigstens, wovor er sich am meisten fürchtet.)
Der Punkt scheint erreicht, wo die Propagierung des eigenen Lebensstils auf Kosten der Meinungsäußerungsfreiheit ins Intolerante kippt. Jüngstes Beispiel ist der Fall von Carrie Prejean, die den Titel einer Miss California wegen kritischer Äußerungen zur Homo-Ehe abgeben musste.
Mal abgesehen davon, dass ich nicht sehe, wo Schwule ihren Lebensstil „propagieren“ (das Wort knüpft wohl nicht zufällig an die uralte Mär an, man könne oder wolle heterosexuelle junge Menschen für sich rekrutieren), und mal abgesehen davon, dass es ja so dramatisch nicht zu sein scheint, mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn das „jüngste Beispiel“ Monate zurückliegt: Carrie Prejean musste den Titel einer Miss California nicht wegen kritischer Äußerungen zur Homo-Ehe abgeben.
Philipp Gut behauptet, Homosexuelle übten „heute selbstverständlich alle erdenklichen Bürgerrechte aus“ und spricht von einer „rechtlichen Gleichstellung“. Ich weiß nicht, von welchem Land er spricht, aber in Deutschland haben schwule Paare nicht die gleichen Rechte wie heterosexuellen Paare, und in den Vereinigten Staaten fliegen sie sogar aus der Armee, wenn ihre Homosexualität bekannt wird.
Gut schreibt:
In Berlin zogen auch dieses Jahr aus Anlass des Christopher Street Day Zehntausende von Lesben und Schwulen zur Siegessäule, angeführt vom schwulen Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD). Riegelt man für diskriminierte Minderheiten ganze Innenstädte ab?
Das ist die verquere Logik des Herrn Gut: Wenn die Schwulen noch diskriminiert würden, dürften sie nicht auf die Straße. Wenn sie aber nicht diskriminiert werden, haben sie auch auf der Straße nichts zu suchen.
Nun gebe ich zu, dass die CSD-Veranstaltungen eine verwirrende Mischung sind: Es sind Partys, in denen man öffentlich die eigenen Sexualität feiert, es sind ultra-kommerzielle Werbeveranstaltungen, und es gibt gleichzeitig einen von Stadt zu Stadt unterschiedlich großen Rest politischer Demonstration für echte Gleichberechtigung und Toleranz. Das muss man nicht mögen, als Schwuler so wenig wie als Hetero, aber man muss es hinnehmen, jedenfalls in dem gleichen Maße wie man jede andere Großveranstaltung mit Absperrung der Innenstadt hinnehmen muss. Und was ist schlimm daran, wenn relativ weltoffene Städte wie Berlin, Zürich und Amsterdam erkannt haben, dass es sich auch wirtschaftlich für sie lohnt, sich dieser Zielgruppe positiv zu verkaufen?
Die Opferrolle, mit der [Homosexuelle] nach wir [sic!] vor kokettieren, passt nicht mehr. Ihre Demonstrationen sind zu hohlen Ritualen gutmenschlicher Bekenntnisse geworden, die nichts kosten. Wer hingeht, kann sich besser fühlen — eine Gratistoleranz.
Er war offensichtlich nie da. Die Gay-Pride-Veranstaltungen sind keine Gutmenschen-, sondern Hedonisten-Veranstaltungen. Man hat Spaß und feiert sich und die Vielfalt menschlicher Lebensformen. Und die Heteros, die mitfeiern oder zugucken, tun dies sicher nicht aus dem Gefühl, damit ein Opfer gebracht zu haben und bessere Menschen zu sein. Sondern weil das „gutmenschliche Bekenntnis“ für sie eine Selbstverständlichkeit ist, und weil sie Spaß daran haben. Weil sie das, was Philipp Gut als eine Bedrohung und eine Belästigung empfindet, als eine Bereicherung erleben: dass Menschen verschieden sind.
Und dann, natürlich, die armen Kinder. Gut schreibt, dass „selbst vor Kindern und Schulen die schwulen Pressure-Groups nicht halt machen“. Er reibt sich daran, dass es Forderungen gibt, das Thema der sexuellen Orientierung „sowohl mit der allgemeinen Sexualerziehung als auch fächerübergreifend im jeweiligen Kontext in allen Altersstufen“ zu behandeln. Vielleicht weiß er nicht, was es bedeuten kann, in der Provinz oder in einem traditionellen muslimischen Milieu in einer deutschen Großstadt als Schwuler aufzuwachsen. Vielleicht glaubt er, man dürfe Kindern in der Schule deshalb nicht über Homosexualität und die Normalität von Homosexualität aufklären, weil sie dann alle schwul werden.
Er schreibt:
Ein bekannter Schriftsteller, der in Berlin lebt, erzählt, dass der Lehrer seines Sohnes der Klasse schon am ersten Schultag die Information aufdrängte, dass er schwul sei.
Nun weiß ich nicht, ob Philipp Gut oder der unbekannte bekannte Schriftsteller darüber weniger empört wären, wenn der Lehrer seinen Schülern das am dritten Tag oder erst bei der Abi-Feier erzählt hätte. Ich kann mir nur vorstellen, was es heißt, als schwuler Lehrer Schüler zu unterrichten, für die „schwul“ eines der schlimmsten Schimpfwörter ist; in der Angst zu leben, dass das rauskommt und irgendwann Gerüchte und böse Sprüche die Runde machen. Ich kann mir vorstellen, warum sich ein schwuler Lehrer, der einen wesentlichen Teil seines Lebens nicht verleugnen will, in dieser Situation dafür entscheidet, es gar nicht erst darauf ankommen zu lassen, sondern vom ersten Tag an reinen Tisch zu machen und zu sagen: So ist das. Nehmt’s hin. Ein solcher Lehrer kann das machen, um ein Vorbild zu sein für die, statistisch gesehen, vermutlich zwei, drei, vier Kinder in seiner Klasse, die auch homosexuell sind. Oder er kann es machen, damit es, im Gegenteil, gar kein Thema mehr ist.
Philipp Gut ist ein besonders heuchlerischer Schwulengegner: Er hat nichts gegen schwule Lehrer, solange sie ihr Schwulsein verstecken. Im Klartext heißt das: Er hat nichts gegen schwule Lehrer, solange sie nicht schwul sind. Ich bin mir sicher, er findet sich aufgeklärt, tolerant und modern.
Sein Artikel endet mit einem Missverständnis, das für seinen Text zentral und leider weit verbreitet ist:
Nach der erfolgreichen Emanzipation der Schwulen dürfte man eigentlich erwarten, dass die Homosexuellenbewegung etwas lockerer wird. Welche Bedeutung hat die penetrante, ja das öffentliche Leben bedrängende „Sichtbarkeit“ noch?
Schwulsein wäre dann einfach eine sexuelle Veranlagung, eine Privatsache, die nach den Regeln des guten Geschmacks in der Öffentlichkeit endlich wieder diskret behandelt würde. Man läuft ja auch sonst nicht dauernd mit offenem Hosenladen herum.
Man darf nicht auf die treuherzige Harmlosigkeit hereinfallen, in der er das formuliert. Philipp Gut will, dass Schwule und Lesben aus der Öffentlichkeit verschwinden und ihr Schwul- und Lesbischsein wieder verstecken. Aber es geht nicht um eine „sexuelle Veranlagung“, um die eigene Intimsphäre, um Diskretion und „guten Geschmack“. Jemand, der sagt, dass er schwul ist, gibt damit nicht mehr von sich Preis als jemand, der sagt, dass er verheiratet ist. Als Klaus Wowereit öffentlich verkündete, dass er schwul sei, hat er damit nicht mehr von sich verraten als jeder Politiker, der sich mit seiner Frau zeigt, genau genommen weniger.
Komisch, dass Herr Gut sich von sichtbaren Schwulen belästigt fühlt, aber nicht von sichtbaren Heterosexuellen. Wo bleibt sein Aufschrei, dass die deutsche Bundeskanzlerin, zum Beispiel, kein Geheimnis daraus macht, dass sie mit einem Mann zusammenlebt? Ist das nur Ausdruck ihrer „sexuellen Veranlagung“? Warum, könnte man mit Gut fragen, müssen Heterosexuelle (Ehe-)Männer und (Ehe-)Frauen ihr Intimleben auf diese Art öffentlich machen und damit, man merke sich die Formulierung: „das öffentliche Leben bedrängen“?
Philipp Gut, Ressortleiter bei der sich auf irgendeine verquere Art für liberal und freiheitlich haltenden „Weltwoche“, meint, dass nur Heterosexuelle das Recht haben, ihre Partner der Öffentlichkeit vorzustellen. Natürlich fühlt er sich von denen nicht bedrängt, denn die sind ja wie er: normal. (Es sei denn, ich täte ihm Unrecht, und er sagt bei jeder Veranstaltung, wo ihm ein Mann seine Lebensgefährtin vorstellt: „Iiiieh, verschonen Sie mich mit diesen sexuellen Details, ich renne hier ja auch nicht mit offener Hose rum.“) Er spricht damit sicher vielen anständigen Bürgern (und dem Udo Walz natürlich) aus der Seele, die es auch eklig finden, wenn zwei Männer sich auf offener Straße küssen.
Es geht nicht um eine „sexuelle Veranlagung“ und nicht um das Intimleben, weshalb es nicht nur diskriminierend, sondern vor allem dumm ist, wenn Gut fragt: „Wie sehr interessiert es uns eigentlich, wer welchen sexuellen Praktiken nachgeht und warum? Kommt als Nächstes die Latexfraktion? Oder beglücken uns die Tierliebhaber mit ihren Vergnügungen?“
Es gibt bei der Emanzipation von Homosexuellen einen entscheidenden Unterschied zu anderen Gruppen wie Frauen, Schwarzen oder Behinderten, die gegen ihre Diskriminierung kämpfen: Homosexualität ist unsichtbar. Die Schwulenbewegung hat nicht nur um Rechte gekämpft wie das, überhaupt einen anderen Mann lieben zu dürfen, sondern auch darum, sich nicht länger verstecken zu müssen. Jemand müsste dem sich so bedrängt fühlenden Philipp Gut vielleicht erklären, was der Begriff des „Coming Out“ bedeutet und warum er so zentral ist für Schwule und Lesben. Dass das Sichtbarmachen von Homosexualität nicht nur ein Mittel war im Kampf um Bürgerrechte, sondern wesentliches Ziel dieses Kampfes: das Recht, sein Schwul- oder Lesbischsein nicht verstecken zu müssen.
Philipp Gut plädiert dafür, dass die Homosexuellen schön wieder in den Schrank zurück gehen. In diesem Schrank, soweit reicht seine Scheintoleranz, dürfen sie dann machen, was sie wollen, da gelten dann auch die Bürgerrechte und so.
Gut schreibt:
Die Schwulen bestimmen heute, wie über Schwule zu denken und zu sprechen ist — und vor allem, worüber man nicht sprechen darf.
Er merkt nicht, wie ironisch der Satz ist, wenn man den ganzen Rotz nun schon zum zweiten Mal in eine große Zeitung schreiben durfte.
Aber das darf man den modernen Schwulengegnern wie ihm am wenigsten durchgehen lassen: dass sie sich auch noch als Opfer stilisieren.