
Die Wochenzeitung „Die Zeit“ hat sich verpflichtet, rufschädigende Formulierungen aus ihrem zweifelhaften Dossier über Filmpiraterie (Abb.) nicht mehr zu veröffentlichen. Sie behauptet allerdings das Gegenteil.
Die Direktorin des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft, Jeanette Hofmann, hatte vor einigen Wochen eine einstweilige Verfügung gegen das Blatt erwirkt. Es hatte ihr unterstellt, sie habe sich von Google kaufen lassen und bestellte wissenschaftliche Ergebnisse geliefert. Der Suchmaschinenanbieter verdiene nicht nur Geld mit „Raubkopien“, schrieb Kerstin Kohlenberg, die stellvertretende Leiterin des „Investigativ-Ressorts“ der „Zeit“, sondern stecke einen Teil davon auch noch in Studien, „die zu dem Ergebnis kommen, dass Raubkopien keine schlechte Sache sind“. Der Artikel ist inzwischen wieder online, allerdings in einer um die angegriffenen Formulierungen bereinigten Version.
Hofmann hatte sich erfolgreich unter anderem gegen die Behauptungen der „Zeit“ gewehrt, sie halte das Urheberrecht für „überflüssig“ und stelle sich „eindeutig auf die Seite derer, die mit illegalen Filmkopien Geld verdienen“.
Die „Zeit“ hatte dagegen Widerspruch eingelegt. Am 12. April kam es deshalb zur mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Hamburg.
Dabei einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich:
- Die „Zeit“ und „Zeit Online“ verpflichten sich, die umstrittenen Formulierungen über Jeanette Hofmann nicht erneut zu veröffentlichen.
- Hofmann verzichtet auf eine Gegendarstellung.
- Hofmann trägt drei Viertel der Kosten des Verfahrens.
Die „Zeit“ veröffentlichte allerdings eine knappe Woche später eine Pressemitteilung, in der sie den Ausgang des Verfahrens anders schildert:
- Die „Zeit“ behauptet, Hofmann hätte auf eine Unterlassungserklärung des Blattes verzichtet. In Wahrheit ist die Unterlassungserklärung Teil des Vergleichs.
- Die „Zeit“ behauptet, das Dossier dürfe „in seiner ursprünglichen Form verbreitet werden“. In Wahrheit hat der Verlag unterschrieben, die bemängelten Äußerungen über Hofmann „nicht erneut zu veröffentlichen“.
- Und die „Zeit“ behauptet, sie habe sich „freiwillig“ bereit erklärt, „in zukünftigen Artikeln die Arbeit von Frau Hofmann differenzierter zu betrachten“. In Wahrheit hat sie sich verpflichtet, die ursprünglichen Behauptungen über Hofmann und ihre Arbeit nicht zu wiederholen.
Das ist eine erstaunliche Verdrehung der Tatsachen und ein unfreundlicher Akt, nachdem man sich gerade erst mit der Gegenseite auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits geeinigt hatte. Jeanette Hofmann geht nun wiederum gegen diese Pressemitteilung juristisch vor.
Dem Vergleich mit der „Zeit“ hatte sie zugestimmt, weil ihr das Risiko steigender Prozesskosten zu hoch wurde und sie diese Form der Auseinandersetzung persönlich zu belastend fand. Im Kern bestand er für sie darin, dass die „Zeit“ die geforderte Unterlassungserklärung abgibt und Hofmann dafür den Großteil der Kosten des Verfahrens trägt.
Die Verhandlung war wohl eine abschreckende Erfahrung. Hofmann sah sich unter anderem damit konfrontiert, beweisen zu sollen, dass sie das Urheberrecht nicht für überflüssig hält. Als vermeintlichen Gegenbeweis hielt ihr der Anwalt unter anderem ihre Formulierung vor, dass die Herstellung von Informationsgütern „nicht automatisch Eigentumsrechte nach sich ziehen“ müsse. Urheberrechte seien „nicht alternativlos“, hatte Hofmann formuliert. — Macht sie das überflüssig?
Hofmann hatte außerdem bestritten, sich überhaupt dezidiert mit dem Thema illegaler Kopien zu beschäftigen. Der Anwalt der „Zeit“ verwies dagegen auf das von Hofmann herausgegebene Buch „Wissen und Eigentum“, in dem ein anderer Autor (!) davon schreibt, dass „illegale Downloads fast zur Selbstverständlichkeit geworden“ seien.
Angesichts des Verlaufs der Verhandlung war sie sich nicht sicher, ob ihre Sicht auf die Dinge ausreichend Aussicht hätte, anerkannt zu werden. Darum stimmte sie dem Vergleich zu.
Wir fassen zusammen: Die „Zeit“ veröffentlicht ein Pamphlet über Filmpiraterie, das eine Wissenschaftlerin diffamiert, gibt vor Gericht eine Unterlassungserklärung ab und behauptet dann in einer Pressemitteilung das Gegenteil. Wenn man nicht wüsste, dass es sich um eine der besonders seriösen Adressen des deutschen Journalismus handelt, man käme nicht drauf.
PS: Die „Zeit“ hatte mir die Pressemitteilung mit den Worten geschickt: „Da Sie in Ihrem Blog über den Sachverhalt berichtet haben, wünschen wir, dass Sie diese Meldung zur Kenntnis nehmen und den Artikel aktualisieren.“ Das finde ich eine erstaunliche Formulierung, aber den Wunsch habe ich hiermit ja erfüllt.
Nachtrag, 26. April. Heute haben die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“, ein Schwesterblatt der „Zeit“, das Dossier nachgedruckt — in der ursprünglichen Form, mit allen Formulierungen über Jeanette Hofman, für die die „Zeit“ eine Unterlassungserklärung abgegeben hat.
Nachtrag, 8. Mai. Die „Zeit“ hat ihre Pressemitteilung entfernt.

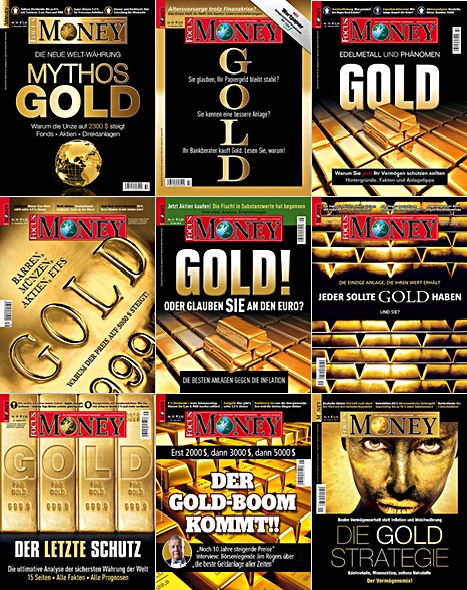



 Und manchmal von ausgesuchter Ekligkeit, wenn die „Freizeit Monat“ auf ihrem Titel alles tut, um den Eindruck zu erwecken, dass Friso, der Sohn von Beatrix, der seit einem Unfall im Koma liegt, gestorben sei, wenn sie in Wahrheit nur die angekündigte Abdankung der niederländischen Königin meint.
Und manchmal von ausgesuchter Ekligkeit, wenn die „Freizeit Monat“ auf ihrem Titel alles tut, um den Eindruck zu erwecken, dass Friso, der Sohn von Beatrix, der seit einem Unfall im Koma liegt, gestorben sei, wenn sie in Wahrheit nur die angekündigte Abdankung der niederländischen Königin meint.
