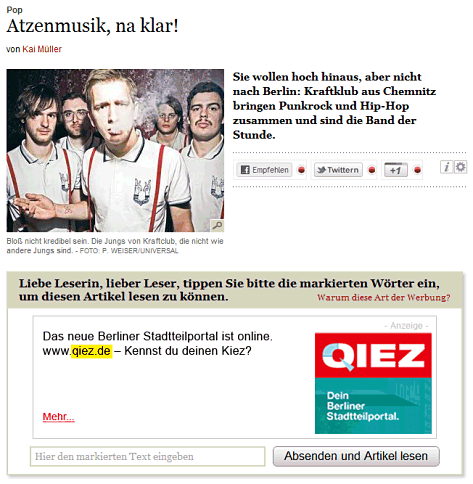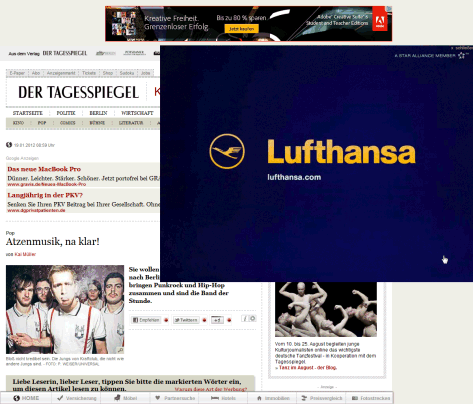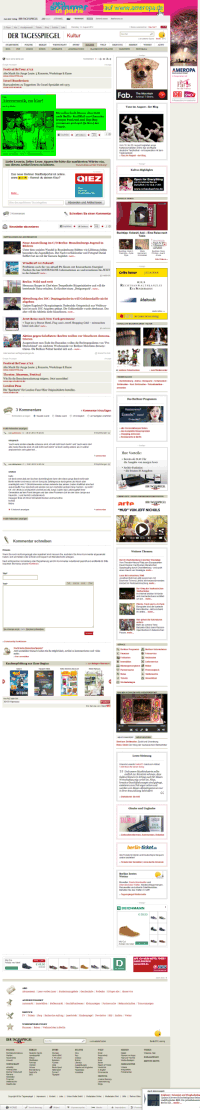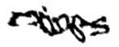Am 18. Februar 2004 kauft sich der aserbaidschanische Soldat Ramil Safarov eine Axt. Er ist mit Militärangehörigen aus anderen Ländern in Budapest, um an einem Nato-Fortbildungsprogramm teilzunehmen. In der übernächsten Nacht nimmt er die Axt, geht ins Zimmer eines schlafenden Teilnehmers aus dem verfeindeten Nachbarland Armenien und erschlägt ihn im Schlaf. Die Obduktion wird ergeben, dass er ihn sechzehn Mal im Gesicht trifft und den Kopf fast vom Rumpf trennt.
Danach macht sich Safarov auf den Weg, einen weiteren armenischen Soldaten im Gebäude zu töten. Bevor er in dessen Zimmer eindringen kann, wird er von der Polizei verhaftet.
Ein ungarisches Gericht verurteilte Safarov 2006 zu lebenslänglicher Haft. Frühestens 2036 sollte er begnadigt werden können. Der Richter begründete das Urteil mit der Brutalität der Tat und dem Fehlen jeder Reue.
Am vergangenen Freitag wurde Safarov von Ungarn nach Aserbaidschan ausgeliefert. Nach Angaben der ungarischen Regierung hatte ihr das aserbaidschanische Regime zugesichert, dass Safarov den Rest seiner Strafe würde verbüßen müssen.
Unmittelbar nach seiner Ankunft in Baku begnadigte Präsident Ilham Aliyev den Mörder. Er wurde von jubelnden Menschen empfangen und als Volksheld gefeiert. Das Regime in Baku hatte Safarovs Taten nie verurteilt und Medien und Organisationen im eigenen Land ermuntert, ihn als prominente Persönlichkeit zu behandeln.
Safarov besuchte nach seiner Rückkehr ins Land die Märtyrer-Allee und legte Blumen am Grab von Heydar Aliyev nieder. Der aserbaidschanische Verteidigungsminister stellte ihm kostenlos eine Wohnung zur Verfügung, zahlte ihm den in den vergangenen acht Jahren entgangenen Lohn nach und beförderte ihn in den Rang eines Majors.
· · ·
Es kommt mir im Nachhinein so naiv vor, dass wir im Mai beim Eurovision Song Contest annahmen, dass in einer Disco, die Teil des offiziellen Programms war, Musik aus Armenien gespielt werden könnte. Mir erscheint aber auch der Gedanke absurd, dass eine armenische Delegation in diesem politischen Klima in diesem Land an dem Grand-Prix hätte teilnehmen können.
Es stimmt: Das aserbaidschanische Regime hatte dem Veranstalter, der European Broadcasting Union (EBU) versprochen, dass sie für die Sicherheit der Delegationen bürge. Aber vermutlich wusste es damals schon, dass man dieser Organisation folgenlos alles versprechen konnte.
Ende Mai ist ein norwegischer Reporter, der sich am Rande des ESC über die politische Situation im Lande lustig gemacht hatte, bei der Ausreise am Flughafen eine Stunde lang festgehalten, bedroht und misshandelt worden. Auch das widersprach den Garantien, die Aserbaidschan der EBU gegeben hatte. Die angeblich laufende „Untersuchung“ des Vorfalls durch die EBU ist bis heute, über ein Vierteljahr danach, zu keinem Ergebnis gekommen.