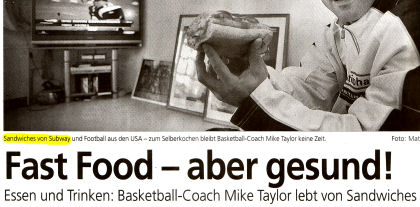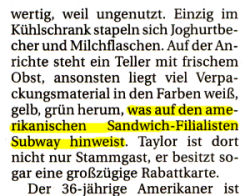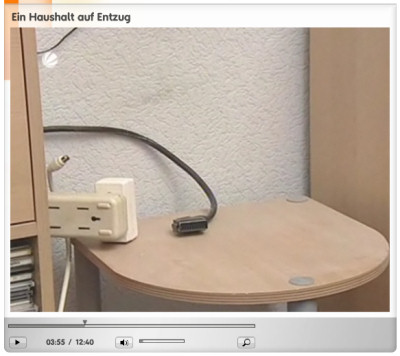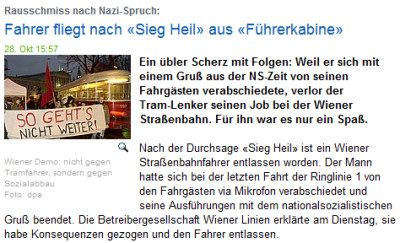Es gibt zwei Möglichkeiten, den Aufstieg Barack Obamas zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu beschreiben. Einerseits als eine Art Wunder oder wenigstens unglaubliches Kunststück, sich als Schwarzer, als angeblich liberalster Senator, ohne irgendeine Art von Regierungserfahrung gegen die Clintons und die Republikaner durchgesetzt zu haben. Und andererseits als das bloß etwas verfrühte Eintreffen dessen, was alle vorhergesagt haben.
Vielleicht ist es nur ein Zeichen dafür, wie sehr die Performance zum entscheidenden Kriterium amerikanischer Wahlen geworden ist, wie sehr sich alles auf das Gelingen von Auftritten konzentriert, den kleinen ebenso wie dem großen Ganzen, dass ein einziger Auftritt Barack Obamas vor vier Jahren beim demokratischen Parteitag genügte, um ihm unisono vorauszusagen, dass er gute Chancen hätte, einmal Präsident zu werden.
Der Blick ins Archiv bringt Dutzendfach Artikel zutage, die heute fast prophetisch wirken:
„Berliner Zeitung“, 27. Juli 2004:
In zehn Jahren wird Barack Obama der erste schwarze Präsident der USA. Davon sind viele Demokraten und vielleicht sogar einige Republikaner schon heute überzeugt.
„Süddeutsche Zeitung“, 28. Juli 2004:
Barack Obama: Demokratischer US-Politiker auf dem Weg nach ganz oben
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 29. Juli 2004:
Ja, er ist es. Jetzt kann man es mit Gewißheit sagen. Vor seiner Rede in der Nacht zum Mittwoch durfte man noch nicht ganz sicher sein, aber jetzt gibt es keinen Zweifel mehr: Barack Obama ist eine der größten Hoffnungen, daß der Demokratischen Partei eine Führungspersönlichkeit vom Schlage eines Bill Clinton, vielleicht sogar eines John F. Kennedy zuwachsen wird. (…)
Wenn nicht alles täuscht, hat in Boston die große Laufbahn eines schwarzen Politikers begonnen, die sehr weit, vielleicht sogar bis ganz nach oben führen dürfte.
„Süddeutsche Zeitung“, 29. Juli 2004:
Vor wenigen Tagen kannte den 42-Jährigen selbst unter den Demokraten noch kaum jemand, diesen Jungen aus Illinois, der gerade dabei ist der erste demokratische Senator mit schwarzer Hautfarbe zu werden. Inzwischen wird er als einer der Geheimkandidaten für das Präsidentenamt im nächsten Jahrzehnt gehandelt.
„Spiegel Kultur“, 19. Oktober 2004:
Barack Obama, 43, steht für die glorreiche Zukunft der USA. Vielleicht wird er ihr erster schwarzer Präsident.
„Die Welt“, 2. November 2004:
Obama hat sich bei seinen Auftritten als Redner hervorgetan und auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten im Juli die Hauptansprache neben Kerry gehalten. Er gilt als künftiger Anwärter auf das Weiße Haus.
„Tagesspiegel“, 4. November 2004:
„Ich habe harte Ellbogen“, verspricht Obama. Schafft er es, die meisten der in ihn gesetzten Hoffnungen zu erfüllen, könnte er durchaus im Weißen Haus landen. Vielleicht auch schon in vier Jahren – als Vize einer demokratischen Präsidentin Clinton.
Okay, „prophetisch“ ist vielleicht das falsche Wort.
(Lesetipp für die heutige Nacht: Mein Kollege Nils Minkmar in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ über Barack Obamas Politikstil — „Endlich ein Erwachsener“.)