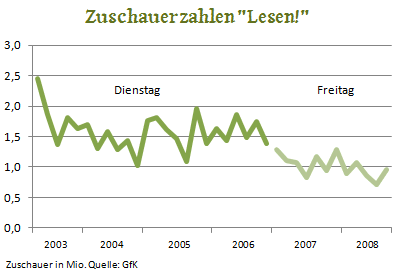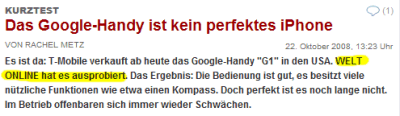(Manuskript eines schlecht vorgelesenen Vortrags auf der DJV-Konferenz „Besser Online“, Hamburg, 18. Oktober 2008)
Ich wollte mir extra viel Mühe geben, diesen Vortrag zu strukturieren. Wenn ich in meinem Blog über Dinge schreiben, die mir im Online-Journalismus aufgefallen sind, ist das ja fast immer eine Sammlung von Einzelfällen, meist sogar unbeeinflusst von Kriterien wie Relevanz oder Ausgewogenheit. Umso mehr, dachte ich, muss das hier wie eine richtige „Keynote“ klingen. „Zehn Thesen über den Zustand des Online-Journalismus in Deutschland“ oder so.
Mir ist dann aber nur eine eingefallen.
Es ist aber eine These, oder genauer: eine Befürchtung, die zentral und fundamental ist. Die über die gegenwärtige Befindlichkeit des Online-Journalismus hinausblickt in die Zukunft. Es ist ein Satz, der vielleicht auch erklärt, warum ich mich immer wieder so verbeißen kann in die Negativbeispiele, die ich auf den Internetseiten deutscher Medien finde — was ich sicher für manche mit etwas beunruhigender masochistischer Leidenschaft tue. Die These lautet:
Die Verlage und Sender probieren im Internet gerade aus, ob es nicht auch mit weniger Journalismus geht.
Journalismus war zu den meisten Zeiten nicht das naheliegende Geschäft für diejenigen, die viel Geld verdienen wollten. David Montgomery, der Käufer des Berliner Verlages, glaubt vielleicht noch, das sei ein Geschäftsfeld, mit dem sich besonders hohe Renditen erwirtschaften lassen, wenn man nur genug presst — aber so richtig erfolgreich ist er damit auch nicht. Für echte Verleger ist Journalismus das Ziel und Geld das Mittel. Nicht umgekehrt.
Aber der klassische Verleger ist so gut wie ausgestorben. Die Zeiten haben sich geändert, die Kaufmänner, gerne abfällig „Flanellmännchen“ genannt, haben nun das Sagen. Und das Geld ist knapp geworden. Die Zeiten des stetigen Wachstums — und, in einigen Fällen: des Überflusses — sind spätestens seit der Medienkrise 2001/2002 vorbei. Und das Publikum wandert zwar ins Internet, aber die Einnahmen der Verlage wandern nicht mit. Rupert Murdochs zwei Jahre alte Regel gilt immer noch:
„Können Zeitungen online Geld verdienen? Klar. Können sie soviel Geld verdienen, wie sie in Print verlieren? Im Moment, bei einem so neuen, wettbewerbsintensiven Internet, lautet die Antwort: nein.“
Für Medien wie das Fernsehen wird die Rechnung, vielleicht etwas zeitverzögert, kaum anders aussehen.
· · ·
Was macht man also als klassischer Medienbetrieb mit einem neuen Medium, das vermutlich irgendwie die Zukunft ist (und, wenn wir ehrlich sind: schon lange die Gegenwart), aber in dem sich hier und heute kaum Geld verdienen lässt?
Die einfachste Antwort ist natürlich: Man ignoriert es. Das ist eine Strategie (oder auch: der Verzicht auf eine Strategie), die viele Regionalzeitungen gewählt haben. Sie haben irgendwelche Präsenzen im Internet, die man bei flüchtigem Hinsehen mit Online-Angeboten verwechseln könnte. In Wahrheit sind es aber nur mit dem Logo der Zeitung angemalte Sperrholzwände, auf denen automatisch einlaufende Agenturmeldungen einen Anschein von Leben vortäuschen.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür fand ich auf der Homepage der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, meiner Heimatzeitung, bei der ich meine ersten Artikel über Kaninchenzüchter und Karnevalsvereine schrieb. Als dort vor einigen Monaten der diesjährige Katholikentag eröffnet wurde — für eine Stadt wie Osnabrück ein epochales Ereignis, das neben der Bundeskanzlerin und dem Bundespräsidenten zigtausende, oft junge Menschen in den Ort bracht — fand sich dort zwar ein sogenanntes „Online-Spezial“. Der Aufmacher aber war ein vier Wochen altes Text-Narkotikum, das mit der Überschrift „Gespräche über Jugend, Umwelt und Frieden“ die Aufmerksamkeit der Leser zu verlieren versuchte. Dahinter war ungefähr nichts.
Christian Jakubetz hat in seinem Blog ähnliche Beispiele aus der „Passauer Neuen Presse“ zusammengetragen, die in der Woche, in der die CSU (und damit natürlich ganz Bayern) von einem Wahlbeben erschüttert wurde, ihre Homepage benutzte, um aktuell darauf hinzuweisen, wie gut es ist, dass am nächsten Tag die Zeitung kommt. Am Tag, an dem Erwin Huber zurücktrat, vermeldete das Blatt, in dessen Verbreitungsgebiet Hubers Wahlkreis liegt, seinen Rücktritt im Internet mit einer Vier-Satz-Meldung von dpa und dem automatisch generierten Zusatz, dass man mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Zeitung lesen werde. Der Blogger und Medienvisionär Jeff Jarvis spricht bei dem, was regionale Zeitungsverlegern im Internet machen bzw. nicht machen, von einem „fast schon kriminellen Mangel an Innovation“.
· · ·
Trotzdem halte ich das nicht für die gefährlichste Entwicklung im Online-Journalismus. Denn diese Verleger, die das Medium Internet immer noch für das Medium der Zukunft und nicht der Gegenwart halten (wenn überhaupt), diese Verleger gefährden ja vor allem sich selbst. Es gibt aber eine Reaktion auf die geringen Einnahmemöglichkeiten im Internet, die den Journalismus an sich gefährdet.
Wenn wir im Internet weniger verdienen, geht die Logik ungefähr, können wir halt auch nur weniger
ausgeben. Wir sparen uns zum Beispiel einfach so überflüssige Dinge wie ein Korrektorat oder überhaupt das Gegenlesen von Artikeln. Und an der Stelle von Fachjournalisten beschäftigen wir günstige Allesproduzierer, die die einlaufenden Agenturmeldungen und Pressemitteilungen so einpflegen, dass es halbwegs okay ist.
Aus irgendeinem Grund, den ich nicht genau festmachen kann, liegt dieser Strategie die Annahme zugrunde, dass es das Publikum im Internet nicht so genau nimmt. Dass Zeitungsleser zwar empfindlich reagieren, wenn sie zuviele falsch geschriebene Wörter in den Artikeln finden, aber Internetnutzern solche Nebensächlichkeiten egal sind. Dass Fernsehzuschauer ungern das Gefühl haben, die Texte, die ihnen der Nachrichtensprecher vorliest, seien von ihrer achtjährigen Tochter geschrieben worden, aber Internetnutzer den Unterschied eh nicht merken. Es ist schon richtig, dass zum Wesen des Internets als Nachrichtenmedium gehört, besonders schnell zu sein. Und womöglich akzeptieren die Internetnutzer tatsächlich, dass diese Geschwindigkeit bei Breaking News gelegentlich auf Kosten der Genauigkeit geht, dass Nachrichten mehr als in anderen Medien auch etwas Provisorisches haben können. Das erklärt aber nicht die umfassende Senkung von Qualitätsmaßstäben, auf die man bei vielen deutschen Online-Medien trifft.
· · ·
Es ist ein Irrglaube, dass man die Ausgaben bei einem journalistischen Produkt beliebig den Einnahmen anpassen kann und am Ende immer noch etwas hat, das man Journalismus nennen kann. Vielleicht muss man die schlichte Tatsache in all ihrem Pathos einfach gelegentlich aussprechen, wie es Nick Davies in seinem Buch „Flat Earth News“ gemacht hat: Journalismus bedeutet, die Wahrheit aufschreiben. Wenn ein Autohersteller bei der Produktion so viel Kosten einspart, dass das Ding nicht mehr fährt, verliert es für den Käufer die Funktion eines Autos. Ein Online-Medium kann nicht sagen: „Okay, diese Information ist zwar nicht ganz richtig, sondern nur eine abgeschriebene PR-Mitteilung oder ein ungeprüft weiterverbreitetes Gerücht. Aber wir haben halt nicht den Etat zum Überprüfen oder Selbstrecherchieren.“
Journalismus, der nicht mehr die Wahrheit berichtet, ist kein Journalismus. Und das Schlimme ist, dass der Kunde es, im Gegensatz zum nicht fahrenden Auto, nicht einmal zwangsläufig merkt, was ihm da angedreht wurde. (Mal abgesehen davon, dass Demokratie zur Not noch ohne Autos funktioniert, aber nicht ohne Journalismus.)
· · ·
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die deutschen Online-Medien journalistisch schlechter als ihre klassischen Eltern. Vermutlich können wir uns lange darüber streiten, welches die Ausnahmen sind, aber an der grundsätzlichen Gültigkeit dieser Regel kann es meiner Meinung nach keinen ernsthaften Zweifel geben.
Bei BILDblog ist es für uns irgendwann zu einer Standardfrage geworden, wenn wir überlegt haben, ob wir einen der vielen Fehler aufgreifen sollen oder nicht: Steht das in der gedruckten „Bild“? Oder nur auf Bild.de? Die Menge der Flüchtigkeitsfehler, die Bild.de produziert, ist viel zu groß, um das alles zu notieren. Gestern hat Bild.de die Frankfurter Buchmesse vorübergehend nach Leipzig verlegt, die Verleihung der Video Music Awards von Hollywood nach New York, in einem Teaser heißt es: “ Die Mineralölkonzerne registrieren einen Ansturm auf Heizöl! Grund: die große Nachfrage!“, und Barack Obama ist an einer Stelle immer noch Osama.
All das schreiben wir nicht mehr auf, denn es ist ja nur Bild.de, und dass für die Online-Kollegen nicht einmal die Standards der gedruckten Zeitung gelten (welche auch immer das sein mögen), ist offenkundig. Aber, wie gesagt, das ist kein Bild.de-Phänomen. Man darf im Internet nicht so hohe Ansprüche an den Journalismus stellen.
· · ·
Ich möchte Ihnen nun einige Punkte nennen, inwiefern der deutsche Online-Journalismus anders ist als der klassische Journalismus, schlechter, wie ich sagen würde, weniger journalistisch. Und weil ich das Gefühl habe, dass an dieser Stelle ein bisschen Aufmunterung, etwas Humorvolles im Publikum gut ankommen könnte, zitiere ich einfach ein bisschen aus meinem Lieblings-Online-Medium, dem Internetableger der „Rheinischen Post“.
Gestern erschien dort zum Beispiel eine Besprechung der „Popstars“-Sendung vom Vortag. Der Artikel hat folgenden Vorspann:
Die Popstars-Folge verbreitet ein wenig Angst. Angst, dass am Ende keiner mehr da ist. Die ProSieben-Casting-Show ist langweilig. Spannend bleibt die Frage „Wer geht denn nun als nächster?“.
Der Beginn des eigentlichen Artikels lautet dann überraschenderweise:
Der erste Ausstieg war dramatisch.
Ebenfalls gestern informierte RP-Online die Öffentlichkeit über eine Werbeaktion der Firma Ferrero. Der Artikel unter der Überschrift „Eieiei, was schlumpft denn da?“ begann so:
Berlin (RPO). Ist Schlumpfhausen jetzt in Berlin? Es scheint so, denn gestern war die Haupstadt [sic] voller Schlümpfe. Um Werbung für Schokoladeneiner [sic] zu machen, waren Promis in ein Schlumpf-Kostüm geschlüpft. Die Highlights: Koch-Schlumpf Reiner Calmund und sexy Schlumpfine Sonya Kraus.
Doch ein Schlumpf kommt selten allein. Mit von der Partie waren auch Wiegald [sic] Boning, Bernhard Hoecker und Hugo Egon Balder. Gemeinsam warben sie für Überraschungseier in denen jetzt Schlümpfe drin [sic] sind.
Schon zwei Monate alt ist der Text (samt Bildergalerie), in dem sich „RP Online“ ausführlich mit den Haaren von Katie Holmes auseinandersetzte. Sein Vorspann geht so:
Eine neue Frisur ist bei Frauen immer auch ein Zeichen für Veränderung. Meistens in Sachen Liebe. Das scheint bei Katie Holmes auch zuzutreffen. Je länger sie mit Tom Cruise verheiratet ist, umso kürzer werden ihre Haare.
Vielleicht habe ich zu positive Vorstellungen von der Qualität der Texte, die in großen, renommierten Regionalzeitungen in Deutschland erscheinen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass dort regelmäßig Artikel erscheinen, die in diesem Maße Quatsch sind. Deren Autoren schon daran scheitern, eine Sache zu denken, geschweige denn die Gedanken in deutscher Sprache zu formen.
Ich will damit nicht in Abrede stellen, dass es viele gute Online-Journalisten gibt, die hervorragende Arbeit leisten. Aber mein Eindruck ist, dass in einigen deutschen Online-Medien, und nicht nur den kleinsten, auch Leute journalistische Texte verfassen dürfen, die aus gutem Grund kein Printmedium einstellen würde. Weil ihnen offensichtlich nicht nur die journalistische Ausbildung fehlt, sondern jedes Talent fürs Schreiben oder den Umgang mit Sprache.
Das ist die erste Regel, die ich ausgemacht habe:
Online-Journalisten müssen nicht schreiben können.
Die zweite Regel geht mit dieser eine schreckliche Verbindung ein. Sie lautet:
Redigieren und Korrigieren ist optional.
Wenn ich noch einen Moment bei der „Rheinischen Post“ bleiben darf: Klicken Sie sich dort mal durch Texte, die für die Online-Ausgabe geschrieben sind und versuchen Sie einen zu finden, der keine Rechtschreibfehler enthält. Manche Artikel wirken, ganz im Ernst, als hätte eine achtjährige Legasthenikerin sie direkt ins System gestellt. Überall sind Buchstaben verdreht, fehlen Wörter, halten sich hartnäckig falsche Schreibweisen. Es ist offenkundig, dass diese Artikel von keinem zweiten Menschen mehr gelesen werden, bevor sie veröffentlicht werden — ja, es kann realistischerweise nicht einmal eine automatische Rechtschreibprüfung vorhanden sein, wie sie jede Textverabeitung bietet. (RTLaktuell.de ist übrigens eine andere Seite, die offenbar ganz ähnlich entschieden hat, dass es herausgeschmissenes Geld wäre, Mechanismen und Hierarchien einzubauen, die dafür sorgen, dass die Texte in korrektem Deutsch geschrieben sind.)
Mir ist bewusst, wie spießig und krümelkackerisch es wirkt, hier auf so etwas Banales wie gutes und korrektes Deutsch hinzuweisen. Aber ist es nicht bemerkenswert, wie Standards, die in der Print-Welt gelten, online aufgegeben werden?
Wenn die Macher von „RP Online“ und anderer Seiten merken, dass die Leser gar nicht protestieren, wenn die Artikel vor Flüchtigkeitsfehlern strotzen, warum sollten sie dafür im Print-Bereich noch Geld ausgeben? Oder führt „RP Online“ das Gegenlesen von Artikeln dann ein, wenn so viele Leser und Einnahmen ins Netz gewandert sind, dass der Online-„Ableger“ das Hauptprodukt und die Zeitung das Nebenprodukt ist? Nicht im Ernst.
Die dritte Regel lautet:
Jedes Medium wird im Internet zum Boulevard-Medium.
Ich kenne kaum ein Online-Medium in Deutschland, das es sich leistet, auf Nachrichten über Paris Hilton zu verzichten. Auf der Panoramaseite von „Spiegel Online“ standen gestern u.a. die Meldungen: „George Hamilton: Ich habe mit meiner Stiefmutter geschlafen“, „Paris Hilton blitzt bei Prinzen ab“, „Tokio Hotel singen bei Latino-Awards“ und „Trotz Sexsucht-Therapie: ‚Akte X‘-Darsteller Duchovny trennt sich von Frau“.
Ich kann es einerseits nachvollziehen, dass im hektischen Rennen um den meisten Traffic kein Medium auf Schlüsselbegriffe rund um Sex und Paris Hilton verzichten will. Aber das ist nicht selbstverständlich, sondern ein radikaler Bruch. In der alten Medienwelt war die Auflage von „Bild“ auch schon um ein Vielfaches höher als die von „Süddeutscher Zeitung“ und „Frankfurter Allgemeiner“, und trotzdem haben sich die beiden Zeitungen dafür entschieden, keine übergeigten Riesenschlagzeilen über Nebensächliches und nackte Frauen auf den Titel zu setzen, weil das nicht die Art Zeitung war, die sie sein wollten und die ihre Leser lesen wollten. Der Wettstreit im Internet aber wird nach der Logik geführt, dass es keine Abonnementmedien mehr gibt, sondern nur noch Kaufmedien, die jeden Tag den Leser mit größtmöglichen Reizen neu für sich gewinnen müssen. Nur dass von „Kaufen“ im Internet keine Rede sein kann.
Regel 4 ist im Grunde nur eine Erweiterung von Regel 3:
Relevanz ist kein Kriterium.
Der Gedanke, dass das Auswählen zur Aufgabe von Journalisten gehört — ein Gedanke, der gerade in der Flut der Informationen und Scheininformationen im Internet wichtiger sein müsste denn je — er ist im Versuch, alles an Traffic mitzunehmen, was geht, hinfällig geworden. Alles taugt als Nachricht — vorausgesetzt, es lässt sich ohne Aufwand produzieren und trifft das mutmaßliche Interesse der nach Unterhaltung googelnden Massen. Aus der „Wetten dass“-Sendung vor zwei Wochen haben die Leute bei „RP Online“ nicht weniger als acht Artikel plus fünf Bildergalerien geschnitzt (aber nageln Sie mich nicht drauf fest, ob das noch der aktuelle Stand in dieser Minute ist). Wieder und wieder und wieder staunte die Redaktion in einer Sprache, die entfernt an deutsch erinnerte, über das Dirndl, das Salma Hayek trug, und das Dekolleté, das es formte.
Im Internet ist immer noch Platz, und so kann Reinhard Mohr auf „Spiegel Online“ Woche für Woche von neuem aufschreiben, dass man sich auch das Ansehen der jüngsten „Anne Will“-Sendung wieder schenken konnte. Dagegen ist im Grunde auch nichts zu sagen: Seine Unendlichkeit ist ja tatsächlich ein einzigartiger Vorteil des Mediums Internet. Und, unter uns gesagt: Das ist einer der Reize des Bloggens für mich: dass „Relevanz“ für mich keine Relevanz haben muss. Dass ich, bis mir die Lust vergeht, immer wieder über „RP Online“ schreiben kann, obwohl es so viel Wichtigeres gibt auf der Welt.
Aber sollten nicht Nachrichtenmedien anders funktionieren? Gewinnen sie nicht ihre Bedeutung, das, was sie aus all dem Durcheinander im Netz herausragen lässt, dadurch, dass sie ihren Lesern die Welt erklären, dass sie sortieren und gewichten? Müssten sie nicht die größtmögliche Unterscheidung anstreben von all den Seiten, auf denen jeder Pups kommentiert wird, dadurch, dass sie ihren Lesern sagen: Was wir berichten, ist wirklich relevant oder wenigstens überdurchschnittlich interessant oder unterhaltsam?
Verdrängt worden ist das Kriterium der Relevanz durch ein anderes, meine Regel 5:
Berichtet wird, was mühelos zu recherchieren ist.
Eine Verbindung dieser Regel mit den meisten bisher genannten hat zu einer merkwürdigen Inflation von Fernsehkritiken im Online-Bereich geführt, oder genauer: von Nacherzählungen dessen, was gestern im Fernsehen gelaufen ist. Diese Stücke werden anscheinend gut geklickt, vor allem aber sind sie fast ohne Aufwand zu produzieren. Man setzt irgendjemanden für die Dauer einer Sendung vor das Gerät und lässt ihn danach schreiben, was ihm durch den Kopf geht. Fachwissen ist optional, Fernsehexperten sind wir irgendwie schließlich alle, und so produziert zum Beispiel „Welt Online“ Tag für Tag endlose Artikel, in denen im Tonfall eines ambitionierten, aber gescheiterten Schulaufsatzes der Inhalt einer Sendung referiert und mit markigen Worten benotet wird.
Und dann ist da das Internet, das für die Verleger ein doppelter Segen ist. Einerseits kann man es täglich verteufeln und beschwören, wie unzuverlässig all die ungeprüften Informationen sind, die dort täglich an irgendeiner Stelle aus einer unbekannten Quelle ans Land gespült werden. Und andererseits kann man aus genau diesem Tand und Schrott ganz einfach ohne weitere Recherche eigene Artikel machen. Manchmal scheint es mir, dass alles, was von einem Blogger, einem Forum oder einem dubiosen Boulevardmedium irgendwo auf der Welt behauptet wird und das die richtigen Schlüsselbegriffe enthält wie „Angelina Jolie“ oder „Eva Mendes“, irgendwann seinen Weg in die deutschen Online-Medien findet — es sei denn, natürlich, es handelt sich um ein Dementi. Dass Eva Mendes ausrichten ließ, sie habe keineswegs gesagt, Sex in allen 50 Bundesstaaten der USA gehabt zu haben, kann auch der gründliche Online-Medien-Leser inmitten all der Eva-Mendes-hat-Sex-in-50-Bundesstaaten-gehabt-Berichte kaum erahnen. (Und natürlich hat Bild.de aus der Falschmeldung auch eine 50-teilige Klickstrecke gemacht mit allen Bundesstaaten, in denen Eva Mendes Sex hatte.)
In dieser Woche meldete die Netzeitung, dass Madonna, wenn man ganz genau hinguckt, einen Damenbart hat, was irgendwelche Menschen mit zu viel Tagesfreizeit in der „Huffington Post“ veröffentlicht hatten. (Die vorausgegangenen Meldungen der Netzeitung zum Thema Madonna lauteten übrigens: „Madonna sang und stürzte“, „Madonna packt die Muckis aus“ und „Madonna kommt mit Hofstaat nach Berlin“.)
Der endlose Hunger nach Content führt auch dazu, dass konfektionierte PR-Meldungen begeistert aufgenommen und verbreitet werden. Das ist kein neues Phänomen, aber eines, das durch die Online-Medien noch verschärft wird. Ein paar Prominente als Schlümpfe auftreten zu lassen, um für seine Überraschungseier im redaktionellen Content zu werben, ist dabei fast schon überambitioniert. Jeder Filmtrailer verwandelt sich in einem Online-Angebot von Werbung zu Premium-Content.
Damit sind wir bei Regel 6:
Redaktion und Werbung müssen nicht so genau getrennt werden.
Bild.de hat sich vor zwei Jahren ein deutliches Urteil eingefangen: Der Leser, urteilte das Kammergericht Berlin, müsse vor dem Klicken auf einen Link wissen, ob sich dahinter eine Anzeige verberge. Auf den Seiten von Bild.de sind seitdem redaktionelle und werbliche Inhalte deutlich besser getrennt, aber erstaunlicherweise fühlen sich andere Anbieter nicht an solche Regeln gebunden, die für ein Qualitätsmedium auch ohne Urteil selbstverständlich sein müssten. Ausgerechnet sueddeutsche.de zum Beispiel verkauft nach wie vor munter Links in der Menuführung, die redaktionellen Verweisen zum Verwechseln ähnlich sind, aber auf Anzeigen führen.
Regel 7 lautet:
Warum ein gutes Foto zeigen, wenn es auch 100 schlechte tun?
Die Fotografie als journalistisches Mittel hat es schwer im deutschen Online-Journalismus. Man muss immer wieder auf die Seiten zum Beispiel der „New York Times“ im Internet gehen, um festzustellen, dass das kein zwingendes Problem des Mediums ist, sondern dass es möglich ist, auch im üblichen Raster der Online-Medien ausgewählte, herausragende journalistische Bilder so zu zeigen, dass sie mehr sind als nur eine Auflockerung.
Der Alltag in Deutschland dagegen ist immer noch, alle 50 Fotos, die eine Suche im Archiv von dpa oder anderen Anbietern, die man pauschal bezahlen kann und nicht pro einzelnem verwendeten Bild bezahlen muss, auf die Seite zu kippen. Auch hier verschwindet die Auswahl als journalistische Dienstleistung. Die Angebote unterscheiden sich kaum untereinander oder gar von der Google-Bildersuche.
Bestenfalls kann man beim nervösen Tippen auf die Maus mitraten, ab dem wievielten Bild der Online-Redakteur keine Muße mehr hatte, noch irgendeinen Bildtext dazuzuschreiben. Schlechtestenfalls wird aus der Bildergalerie ein Wettrennen um die größte „Text-Bild-Schere“ — obwohl ich inzwischen das Gefühl habe, dass dieser Begriff völlig seine Bedeutung verloren habe, und man sich verabschieden muss von dem Gedanken, dass der Text zu dem passen sollte, was das Bild zeigt.
Mit wenigen, aber ausgewählten, exklusiven, gut in Szene gesetzten Fotos könnte sich ein deutsches Online-Medium leicht von der Konkurrenz unterscheiden. Aber natürlich würde das Geld kosten. Und womöglich würde das auch noch bestraft: Denn der Leser, der beeindruckt ein Foto auf sich wirken lässt, bringt dem Verlag nur ein Zehntel so viele Klicks wie der Leser, der sich routiniert, halb gelangweilt, durch zehn Briefmarkenbilder klickt, in der Hoffnung, das Dekolleté von Salma Hayek noch einmal aus einer etwas anderen Perspektive zu sehen.
Das ist Regel 8, und dann hör ich auch auf:
Klicks gehen immer vor Qualität.
Wenn man mit Verantwortlichen von Online-Medien spricht, fluchen die meisten über die Sinnlosigkeit der Währung „Page-Impression“ und der Folgen, die sie hat. (Eine erhebliche Mitschuld daran tragen übrigens die Medienjournalisten, die nicht aufhören können, Monat für Monat aus den Zahlen Hitlisten zu machen und Sieger und Verlierer zu küren.) Aber so sehr ich erkenne, wie schwierig es wäre, sich dieser Währung zu entziehen – das Maß, in dem die deutschen Medien sich darauf einlassen und den langfristigen Erfolg zugunsten des kurzfristigen Erfolgs aufs Spiel zu setzen, erschüttert mich.
Wie sehr muss man seine Leser verachten, wenn man, wie „Welt Online“, eine Liste wie das Ranking über den Grad der Korruption in 180 Ländern der Erde als 180-teilige Klickstrecke aufbereitet? Ohne jede Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen, Vergleiche anzustellen, die Information aufzunehmen. „Welt Online“ macht das mit großer Konsequenz und entscheidet sich jedesmal dafür, dass der Service für den Leser zweitrangig ist. Erstrangig ist die Maximierung der Klicks.
Es würde mich nicht wundern, wenn es sogar ausgeklügelte Hochrechnungen dazu bei der „Welt“ gäbe: Wie viele Leser, die sich übrigens auch regelmäßig in den Kommentaren über diese Zumutung beschweren, man riskieren kann, auf diese Weise als Stammleser zu verlieren, wenn die verbleibenden nur dumm genug sind, oft genug zu klicken, und wie viele man per Adwords von Google wieder dazukaufen muss.
Interessant finde ich diesem Zusammenhang auch, wieviel Mühe die Online-Medien darauf verwenden, ihre Überschriften so zu optimieren, dass möglichst viele Leute über Google angeschwemmt werden, und wie wenig darüber diskutiert wird, was man ihm bietet, damit er nach dem Spielen von 17 Bilderquizgalerien bleibt oder gar wiederkommt. Suchmaschinenoptimierung machen alle, aber optimiert sein Angebot so, dass es zufällige Leser zu Stammlesern macht?
Bei sueddeutsche.de gibt es neben 100-teiligen Bildergalerien ein Genre, in dem Artikel parallel zu eine Reihe Fotos erzählt wird, uns zwar so, dass es am Ende der paar Zeilen immer einen Cliffhanger gibt, der zum Weiterlesen zwingen soll – auch mitten im Satz und auch, wenn dadurch der Sinn zwischen zwei Klicks verloren geht. Spiegel Online hat sich jetzt ausgedacht, bei allen Artikeln über Jörg Haider so zu tun, als seien sie länger, als sie tatsächlich sind, und lockt die Leute so in die immer gleiche Klickstrecke mit den besten Sprüchen Haiders.
Keine Sorge, ich erspare Ihnen Millionen weiterer Beispiele.
· · ·
Die acht Regeln, die ich ausgemacht habe, beschreiben sicher nicht die ganze Situation des Online-Journalismus in Deutschland. Ich habe nur versucht, jene Punkte herauszugreifen, die zeigen, wie teils schleichend, teils dramatisch online niedrigere journalistische Standards entstehen als in den klassischen Medien, den Print-Medien besonders.
An dieser Stelle noch einmal die Frage: Warum nehmen wir das wie ein Naturgesetz hin? Was ist die Logik dahinter, so zu tun, als gälten im Internet andere, weniger strenge Regeln? Ich glaube nicht, dass das in der Natur des Mediums liegt. Ist das eine bewusste Entscheidung der Verlage, um das Gefälle zum Printmedium, das auf absehbare Zeit noch das Löwenanteil des Geldes verdienen muss, möglichst groß zu halten? Ist es der Versuch, auf diese Weise die oft behauptete qualitative Überlegenheit gerade der Zeitungen zu bestätigen? Ist es nur eine fahrlässige Folge davon, dass man das Medium immer noch nicht ernst nimmt?
Meine Befürchtung ist, wie ich am Anfang gesagt habe, dass das Internet für viele Medienunternehmen — geplant oder ungeplant — eine Art Labor ist, um einmal, halb geschützt von der eigentlichen Marke, auszuprobieren, was geht. Wie weit sich die Kosten und Ansprüche senken lassen. Ob die Leser nicht auch mit unredigierten Texten und bloßen Agenturmeldungen zufrieden geben. Ob sie kenntnisreiche Texte von Fachredakteuren wirklich unterscheiden können von ahnungslos aus verschiedenen Quellen zusammengestrickte Stücke von schlecht bezahlten Online-Praktikanten. Ob sich nicht bei der Aussicht, in Zukunft weniger Geld zu verdienen, ein Geschäftsmodell entwickeln lässt, das darauf beruht, nicht unnötiges Geld in Qualität zu investieren, die der Leser in der Masse gar nicht goutiert.
Man muss, glaube ich, immer wieder daran erinnern, dass die „Süddeutsche Zeitung“ vor zwei Jahren tatsächlich ernsthaft Pläne entwickelt hat, das Newsdesk ihres Online-Ablegers nach Prag zu verlegen, weil es sich dort billiger produzieren ließe. Der Versuch wurde abgeblasen, aber manchmal frage ich mich, ob der Gedanke, der hinter den Outsourcing-Ideen stand, nicht immer noch existiert in der deutschen Medienwelt: dass Online nicht so teuer sein darf und nicht so gut sein muss wie das klassische Medium.
· · ·
Ich will nicht verschweigen, dass es auch ermutigende Zeichen gibt. Dass noch keineswegs ausgemacht ist, ob der Trend ins Internet gleichbedeutend sein muss mit einer qualitativen Abwärtsspirale im Journalismus.
Vielleicht wird es Sie überraschen, das von mir zu hören, aber Bild.de ist für mich so ein Zeichen. Nein, ich würde niemandem empfehlen, Bild.de als Nachrichtenquelle zu vertrauen. Aber vor ein paar Jahren schien die Seite zu versuchen, sich als das deutsche Schleichwerbeportal zu etablieren. Auf BILDblog finden Sie Dutzende Beispiele dafür, wie egal Bild.de die angeblich im Hause Springer geltenden journalistischen Richtlinien waren mit der Forderung, Redaktion und Werbung zu trennen; wie wenig Mühe sich Bild.de gegeben hat, auch nur den Anschein zu erwecken, sie würden gelten.
Das hat sich gebessert. Und auch die schlimmsten Ausreißer nach unten, was die Texte angeht, die Flüchtigkeitsfehler, das Produzieren des allergrößten Unsinns, scheinen mir weniger geworden zu sein. Da ist immer noch ein deutliches Qualitätsgefälle zur „Bild“-Zeitung (und das will etwas heißen!), aber das Online-Angebot macht auf mich nicht mehr den Eindruck, als wäre es den Machern völlig egal, ob sie einen Anschein von Qualität erwecken oder nicht.
Vor kurzem hat Bild.de sogar entdeckt, dass es im Internet die Möglichkeit gibt, auf andere Texte zu verlinken. Und die Kollegen nutzen das gelegentlich sogar, nicht nur unter die Buchstaben CDU routiniert einen Verweis auf cdu.de zu legen, sondern zum Beispiel auf die konkreten Artikel in britischen Boulevardzeitungen zu verweisen, die ihnen — natürlich variiert durch Missverständnisse und Übersetzungsfehler — als Vorlage für ihre Artikel dienen. Das ist mehr als man von den meisten anderen Medien sagen kann, bei denen immer noch der Glaube zu herrschen scheint, dass jeder Link auf eine Quelle die Gefahr bedeutet, einen Leser zu verlieren, obwohl es längst keine Frage mehr ist, dass das Gegenteil der Fall ist.
Auch bei „Focus Online“ und „Spiegel Online“ habe ich das Gefühl, dass sich, manchmal zaghaft und mühsam, echte Qualitätsstandards durchsetzen. Gelegentlich, nicht immer, macht „Spiegel Online“ zum Beispiel auf vorbildliche Weise Berichtigungen seiner Artikel kenntlich. Mag sein, dass ich den Effekt überschätze, aber ich habe das Gefühl, dass man bei „Spiegel Online“ erkannt hat, dass es einen Wert hat, als einigermaßen vorbildlich zu gelten, was solche Standards in der Online-Welt angeht, obwohl sich das sicherlich nicht kurzfristig in Klicks messen lässt, sondern nur langfristig in einem positiven Image. „Spiegel Online“ hat auch vor einiger Zeit damit begonnen, sich von den ganzen Briefmarken-Galerien zu verabschieden, die ich oben beschrieben habe, und die Fotos groß eindrucksvoll in Szene zu setzen. Ich hoffe sehr, dass sich das auszahlt.
· · ·
Man wird, wenn so viel über den Zustand des Online-Journalismus nörgelt wie ich, leicht missverstanden. Ich bin kein Internet-Kritiker, ich glaube nicht, dass die Menschen im Internet zwangsläufig schlechter informiert werden als von Zeitungen. Dass das Medium einen eingebauten Qualitätsnachteil hat. Ich finde es bizarr, wenn die Bundesregierung eine „Nationale Initiative Printpresse“ unterstützt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Zeitungen und Zeitschriften zu retten. Was es bräuchte, wäre eine „Nationale Initiative Journalismus“, die sicherstellt, dass auch in Zukunft guter Journalismus finanziert wird, egal in welchem Medium. Das einzige, das dem Internet fehlt, ist im Augenblick ein funktionierendes Geschäftsmodell für journalistische Inhalte — jedenfalls eines, das so gut funktioniert, wie es jahrzehntelang die Verbindung aus Vertriebs- und Anzeigenerlösen bei den Printmedien getan hat. Aber auch dieses Modell bröckelt, und welchen Sinn soll es haben, für den Erhalt des Datenträgers Papier zu kämpfen, und nicht für seinen Inhalt: den Journalismus?
Die Gefahr, wenn die Medien im Internet als Reaktion auf die noch geringen Einnahmemöglichkeiten die journalistischen Standards senken, ist, dass das Publikum sich daran gewöhnen könnte. Das wäre ein Traum für „RP Online“ (oder auch für „Welt Online“, wenn es gelänge, dass junge Leute gar nicht mehr wissen, dass es einmal so etwas wie Tabellen gab, in denen man viele Informationen übersichtlich über- und nebeneinander gestapelt hatte). Aber es wäre ein Alptraum für die Gesellschaft — und den Journalismus.
Die Verleger riskieren, dass schlimmstenfalls eine ganze Generation von Medien-Nutzern, die vor allem mit den real existierenden Online-Ablegern der Medien groß werden (oder noch journalismusferneren Quellen) gar nicht mehr erwarten, dass Journalismus etwas mit Recherche und Genauigkeit zu tun hat, mit dem Streben nach Wahrheit und Sprache, mit Auswählen und Redigieren. Darin sehe ich die größte Gefahr.
· · ·
In einer Zeit, in der die meisten Informationen der Nachrichtenagenturen, der ganze Klatsch und Trasch, selbst aktuelle Nachrichtenfotos und -videos an jeder Stelle für jeden frei zugänglich sind; in einer Zeit, in der jeder mit relativ einfachen Mitteln daraus eine Seite basteln kann, die man leicht für ein Nachrichtenportal halten könnte; in so einer Zeit kann die Reaktion der journalistischen Medien nicht sein, genau so zu werden. Atemlos jeder Paris-Hilton-Meldung hinterherzuhecheln und schnell und billig dafür zu sorgen, dass das, was schon überall steht, auch auf den eigenen Seiten steht.
Ich will nicht ausschließen, dass das einzelne Angebote damit Erfolg haben können. Dass „RP Online“ zum Beispiel in ein paar Jahren das erfolgreichste kleine Trashportal im Netz ist, weil man hier zuverlässig doppelt so viele Bildergalerien zu Salma Hayek findet und von jedem lokalen Ereignis zuverlässig doppelt so viele Amateurfilmchen gibt wie irgendwo sonst. (Schauen Sie sich bei Gelegenheit all das an, was „RP Online“ zum Tod des Düsseldorfer Bürgermeisters produziert hat, auch die vielen, mit wackeliger Kamera gefilmten Aufnahmen vom Friedhof vor der Beerdigung, kurz der Beerdigung, ganz kurz vor der Beerdigung, beim Glockenläuten, kurz nach der Beerdigung etc. Es ist für mich eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie ein Medium konsequent auf das Internet setzt, aber sich ebenso konsequent vom Journalismus abwendet und annähert an all das Halbfertige, Amateurhafte, das man im Netz schon vorfindet.)
Für Journalisten und journalistische Medien kann das nicht die Lösung sein. Für sie muss die Antwort auf die Herausforderungen des Internet sein, anders zu sein, einzigartig. Eigene Geschichten zu bringen, Autoren zu haben, die wissen, wie man komplexe Zusammenhänge erklärt, die schreiben können und unverwechselbar sind. Fotos zu zeigen, die sonst keiner hat, Glaubwürdigkeit aufzubauen, zu recherchieren.
· · ·
Christoph Keese, der frühere „Welt“-Chefredakteur und heutige Außenminister von Springer, hat im aktuellen Jahrbuch des Presserates ein Essay über guten Journalismus im Internet geschrieben, dem ich an vielen Stellen widersprechen möchte, weil er das Gegenteil von gutem Journalismus nicht schlechten Journalismus, sondern Bloggen nennt. Und weil er das hehre Ideal des Journalisten mit dem real existierenden Journalisten verwechselt. Aber im Kern hat er Recht: dass nämlich die klassischen journalistischen Tugenden in Zukunft wichtiger sind denn je. Keese sagt:
„Bloggern steht es frei, aufgeschnappte Gerüchte weiter zu verbreiten und damit Hysteriekaskaden in Gang zu setzen. Journalisten aber sollten keine Nachricht verbreiten, die sie nicht selbst geprüft haben. Journalismus ist die Schwelle, über die eine Hysteriewelle nicht springen kann.“
Das ist als Zustandsbeschreibung grotesk falsch. Journalismus ist zur Zeit, nicht nur im Internet, aber besonders dort, das Sprungbrett, das jeder Hysteriewelle erst richtigen Schwung gibt, auf der die Journalisten dann begeistert reiten. Aber was Keese beschreibt, muss tatsächlich wieder das Ziel von Journalismus werden.
„Journalisten bilden eine Instanz, die Wahres von Unwahrem unterscheiden will“, sagt Keese. Tun sie nicht. Sollten sie aber.
„Handeln wird nur“, sagt Keese an die Journalisten gerichtet, „wer genau weiß, was ihn von den Laien unterscheidet.“ Da bin ich ganz bei ihm. Gerade im Internetzeitalter muss sich der Journalismus professionalisieren. Ich fürchte nur, dass gerade das Gegenteil passiert.