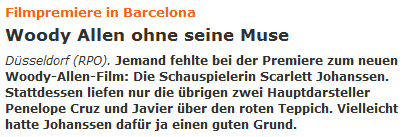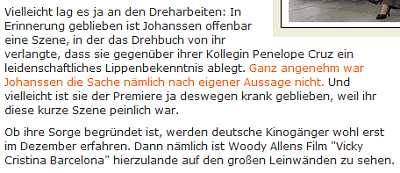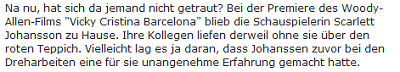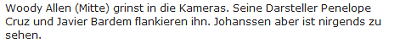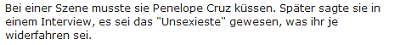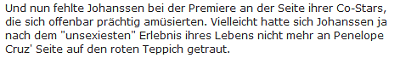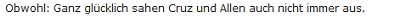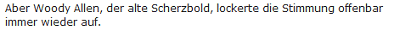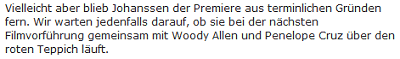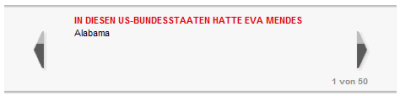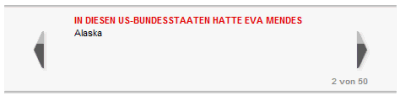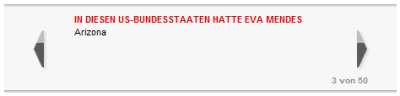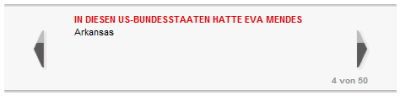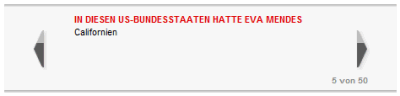Das Schlechte an der Demokratie ist, dass die Leute, wenn sie wählen können, was sie wollen, einfach wählen, was sie wollen. Dieses Jahr beim Eurovision Song Contest zum Beispiel haben ganz viele Leute aus dem Osten Europas einfach für den russischen Teilnehmer gestimmt, womöglich weil der in ihrer Heimat ein Star ist und ihnen sein Stil gefällt, obwohl sie doch wussten, dass die Länder im Westen das nicht gut finden. Und die Länder im Westen zahlen schließlich für die Veranstaltung, waren zuerst da und wissen ja wohl besser, wie man Demokratie macht.
Die Eurovision schafft die Demokratie deshalb jetzt wieder ab.
Sie hat tatsächlich die Wiedereinführung der Jurys beim Grand-Prix beschlossen. Die Zuschauer dürfen weiterhin abstimmen; ihr Votum wird soll aber voraussichtlich nur noch 50 bis 70 Prozent zählen.
Auf diesem Weg soll das angebliche Punkte-Zuschustern unter Nachbarländern eingeschränkt werden. Und Länder wie die Türkei sollen nicht mehr so stark davon profitieren können, dass in Ländern wie Deutschland viele Türken leben, die „ihren“ Beitrag unterstützen können.
Es ist eine Bankrotterklärung. Schon theoretisch: Kleine, anonyme Gruppen von Menschen sollen gegen die Unterstellung von Mauscheleien helfen? Aber auch praktisch: Ein lebendes Mahnmal gegen die Macht von Jurys ist Charlotte Perrelli, die 87-jährige Sängerin, die nach einer verunglückten Schönheitsoperation in diesem Jahr noch einmal für Schweden antreten durfte. Schon den schwedischen Vorentscheid gewann sie aufgrund des Votums der dortigen Jury — gegen die Mehrheitswahl des Publikums. Und auch ins Finale in Belgrad kam sie nur, weil die Jurys (die als Backup im Fall technischer Probleme mit der Telefonabstimmung bereitstehen) bereits in diesem Jahr wieder einen Fuß in der Tür hatten und einen Kandidaten bestimmen durften, der ihnen im Gegensatz zum europäischen Publikum gefallen hatte. Im Finale, ohne die Möglichkeit einer Unterstützung durch Juroren, fiel sie dann verdient durch.
Zur Erinnerung: Dies war Beitrag von Charlotte Perelli.
Schon im ersten Jahr des Grand-Prix sorgten die Jurys für einen Skandal, als sich herausstellte, dass Luxemburg aus Kostengründen auf eine eigene Jury verzichtet und zwei Schweizer hatte wählen lassen. (Die Schweiz gewann.)
Bestenfalls ändern die Jurys gar nichts am Ergebnis. Jan Feddersen berichtete im Grand-Prix-Blog des NDR, dass nach Angaben der Veranstalter 2007 die Wertungen der Jury weder am ersten noch am letzten Platz etwas geändert hätten. Roger Cicero allerdings wäre Sechster geworden, nicht Neunzehnter. Feddersen schrieb:
Unbedingt plädiere ich dafür, dass das Televotingsystem beibehalten wird. Dass die Experten auch nur eine Stimme unter Millionen anderen haben. Musik ist subjektiv, und Experten sollen nicht mehr zu sagen haben als das Publikum, das ja immerhin einen Song zu Popularität trägt oder ins Vergessen stürzt. Ciceros sechster Platz wäre ein kleiner Erfolg ohne Wert gewesen. Lieber ein 19. Rang – aber den mit bestem Gewissen errungen als ein 6. Platz, dem immer der Geschmack der Hintergrundmauschelei anhaften würde.
Der aktuelle deutsche Grand-Prix-Verantwortliche Ralf Quibeldey, Unterhaltungschef beim NDR-Fernsehen, nennt die Kapitulation einen „geeigneten Schritt, um das Abstimmungssystem gerechter zu machen. Denn die Jury wird nicht nach landsmannschaftlichen Aspekten urteilen, sondern das Augenmerk nur auf die Qualität der Musik richten — und kann sich die Titel im Unterschied zum Publikum auch mehrfach anhören.“ Aha: Die Jury wird also nicht nach landsmannschaftlichen Aspekten urteilen. Woher weiß er das? Und, vor allem: Wollen wir das? Ist nicht Teil des Reizes dieser Veranstaltung, dass ihr Verlauf Ausdruck des jeweiligen Geschmacks der verschiedenen teilnehmenden Völker ist — und sei er noch so erratisch?
Stefan Raab hat bei seinem Grand-Prix-Auftritt 2000 vor allem Punkte aus den Nachbarländern bekommen. Vermutlich, weil er dort bekannt war und die Menschen in diesen Ländern seinen Humor verstanden. Das sind „landsmannschaftliche Aspekte“. Und die Kombination vieler verschiedener „landsmannschaftlicher Aspekte“, die am Ende immer wieder zu überraschenden, selten vorhersagbaren Ergebnissen führt wie dem, dass plötzlich der halbe Kontinent für zwei Opas aus Dänemark, amerikanischen Funk aus Estland, Maskenrock aus Finnland, Plastik-Pop aus Griechenland oder Ethnotanzgetöse aus der Ukraine stimmt, ist es, die den Reiz des Eurovision Song Contest in den vergangenen Jahren ausgemacht hat.


 Aber was ich eigentlich sagen wollte: Ich habe zusammen mit Michael Reufsteck (mit dem ich schon
Aber was ich eigentlich sagen wollte: Ich habe zusammen mit Michael Reufsteck (mit dem ich schon