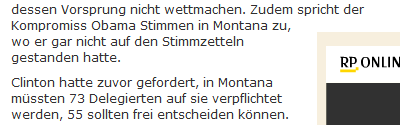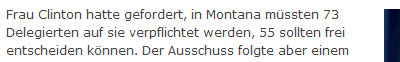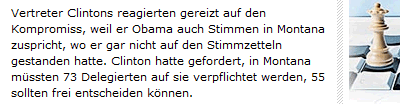Das Unternehmen MTV sieht keine Notwendigkeit, die Kritiker seiner Sendungen davor zu schützen, von seinen Geschäftspartnern eventuell mundtot gemacht zu werden. Auf eine Anfrage, ob MTV das radikale Vorgehen der Firma Callactive gegen ein kritisches Forum billige, erklärte eine Sprecherin, sie könne „Handlungen unserer Dienstleister, die über die zwischen uns vereinbarte Produktion eines Format hinausgehen, nicht kommentieren“.
Die Firma Callactive hat (wie berichtet) vorletzte Woche die Domain call-in-tv.de unter merkwürdigen Umständen übernommen und nutzt sie nun, um anstelle des kritischen Forums für ihre im Auftrag von MTV produzierte Anrufsendung „Money Express“ zu werben, die nachts auf Viva, Comedy Central und dem Kindersender Nick läuft. 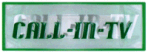
 Frank Metzing, der Anwalt des Forumbetreibers Marc Doehler, hält es für sehr wahrscheinlich, dass Callactive als nächstes versuchen wird, Doehler auch die Ersatzadresse call-in-tv.net und überhaupt den Namens „Call-in-TV“ streitig zu machen. Bereits am 19. Februar 2008 hat die Firma Callactive den Namen „Call-in-TV“, den das Forum seit über zwei Jahren nutzt, als eigene Marke registrieren lassen. Das Logo (rechts oben), das sich die Firma hat schützen lassen, wirkt nicht so, als hätte jemand viel Zeit, Geld oder Mühe investiert. Es verwendet auch ähnliche Farben wie das „Call-in-TV“-Logo der Kritiker (rechts unten).
Frank Metzing, der Anwalt des Forumbetreibers Marc Doehler, hält es für sehr wahrscheinlich, dass Callactive als nächstes versuchen wird, Doehler auch die Ersatzadresse call-in-tv.net und überhaupt den Namens „Call-in-TV“ streitig zu machen. Bereits am 19. Februar 2008 hat die Firma Callactive den Namen „Call-in-TV“, den das Forum seit über zwei Jahren nutzt, als eigene Marke registrieren lassen. Das Logo (rechts oben), das sich die Firma hat schützen lassen, wirkt nicht so, als hätte jemand viel Zeit, Geld oder Mühe investiert. Es verwendet auch ähnliche Farben wie das „Call-in-TV“-Logo der Kritiker (rechts unten).
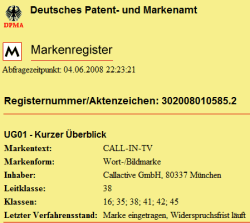 Metzing schätzt die Chancen von Callactive, aufgrund der neu eingetragenen Marke erfolgreich gegen das Forum vorzugehen, allerdings als gering ein. Der Begriff „Call-in-TV“ bezeichne eine ganze Gattung von Fernsehprogrammen — und sei als Wortmarke daher zu allgemein. Deshalb habe die Firma markenrechtlichen Schutz beim Patent- und Markenamt überhaupt nur über den „Umweg“ erreicht, eine Wort-/Bildmarke registrieren zu lassen. Die Nutzung des Begriffes „Call-in-TV“ im Internet könne man nach der bisherigen Rechtsprechung jedenfalls auf diese Weise nicht verbieten lassen. Metzing geht aber davon aus, dass Callactive es dennoch versuchen werde.
Metzing schätzt die Chancen von Callactive, aufgrund der neu eingetragenen Marke erfolgreich gegen das Forum vorzugehen, allerdings als gering ein. Der Begriff „Call-in-TV“ bezeichne eine ganze Gattung von Fernsehprogrammen — und sei als Wortmarke daher zu allgemein. Deshalb habe die Firma markenrechtlichen Schutz beim Patent- und Markenamt überhaupt nur über den „Umweg“ erreicht, eine Wort-/Bildmarke registrieren zu lassen. Die Nutzung des Begriffes „Call-in-TV“ im Internet könne man nach der bisherigen Rechtsprechung jedenfalls auf diese Weise nicht verbieten lassen. Metzing geht aber davon aus, dass Callactive es dennoch versuchen werde.
Im Februar hatte die Produktionsfirma in einer Pressemitteilung erklärt, die Unterstellung, „Callactive wolle das Forum durch übertriebene Zahlungsforderungen zerstören“, sei unrichtig. Das Vorgehen der vergangenen Wochen lässt allerdings wenig andere Interpretationen zu, als die, dass Callactive das Forum zerstören will — wenn nicht durch übertriebene Zahlungsforderungen, dann womöglich anders.
Mayerbacher sagte gegenüber der Internetseite „TV Matrix“, sein Unternehmen habe die Domain call-in-tv.de „nicht gepfändet, sondern im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Domaininhaber […] eine Übertragung auf uns erreichen können“. Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn Callactive hatte zuvor sehr wohl einen gerichtlichen Pfändungsbeschluss gegen Doehler erwirkt: Der Wert der Domain wurde in dem Pfändungsantrag auf 2000 Euro geschätzt. Doehler kam der drohenden Einziehung jedoch zuvor, indem er die Domain auf einen anderen Inhaber übertragen ließ. Richtig ist, dass Callactive die Adresse von diesem dann nicht pfändete; das Unternehmen soll es aber nach Darstellung Doehlers geschafft zu haben, den neuen Besitzer durch massiven Druck zur Übertragung der Adresse zu bewegen. Der zwischenzeitliche Domaininhaber selbst sagt, er dürfe sich zu den Vorgängen nicht äußern.
Das ist der Stand der Dinge. Und bei MTV Networks wollte man nicht einmal meine Frage „Gehört es zu den Geschäftspraktiken des Unternehmens MTV, Kritiker seiner Sendungen mundtot zu machen oder machen zu lassen?“ mit „Nein“ beantworten.
→ Eine ausführliche Darstellung der Vorgänge der vergangenen Wochen aus Doehlers Sicht auf gulli.com
[Disclosure: Callactive führt auch gegen mich mehrere Rechtsstreite.]