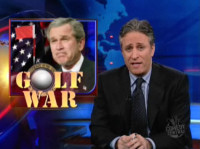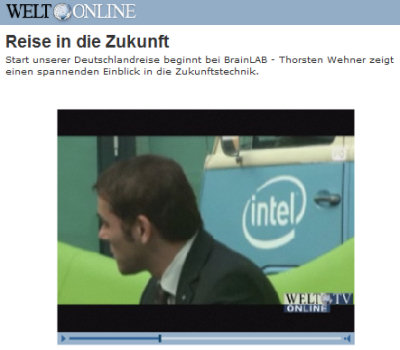Was für eine schöne Idee: Die „Financial Times Deutschland“ (FTD) schickt einen Journalisten und einen Kameramann durch die Bundesrepublik und lässt sie innovative Unternehmen besuchen. In einer liebevoll produzierten Videoreihe auf „FTD-Online“ porträtieren sie die „Innovationsführer aus Deutschland“, die zum Beispiel wegweisende Medizintechnik entwickeln.

Hm?
Ja, richtig: Die „FTD“ hatte dieselbe Idee, die die „Welt“ schon hatte, nämlich die von und für Intel produzierten PR-Filme des Projektes „Deutschlandreise“ als redaktionellen Content zu verwenden.
Allerdings war „FTD-Online“ (anders als „Welt Online“) nicht so dreist, ihren eigenen FTD-TV-Vorspann vor oder das eigene Logo auf das Intel-Video zu bappen. Und, wichtiger Unterschied: Der Auftraggeber wird im Artikel selbst genannt, wenn auch etwas versteckt im vierten Absatz und mit einer Formulierung, die die Beziehung zwischen Intel und den Videos auf „FTD-Online“ eher verschleiert als erklärt:
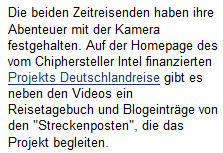
Der Versuch, sich diese Konstruktion von der „FTD“ erklären zu lassen, gestaltete sich erstaunlich schwierig. Die Pressestelle beantwortete meine am Dienstagmittag gestellten Fragen am Mittwochabend zunächst wie folgt:
Was bedeutet die Formulierung, FTD-Online „präsentiert“ diese Filme?
„Präsentiert“ heißt, dass wir die Unternehmen auf ftd.de zeigen.
Ist FTD-Online in irgendeiner Weise redaktionell an der Produktion dieser Filme beteiligt?
Die Online-Kollegen waren im Vorfeld an der Auswahl der Unternehmen beteiligt, die auf der Deutschlandreise besucht werden sollen. Sie entscheiden auch, welche Filme und welche Unternehmen auf FTD.de vorgestellt werden und welche nicht.
Ist es üblich, dass die FTD PR-Filme von Unternehmen in dieser Form in ihren Online-Auftritt einbaut?
Wir betrachten die Videos des „Projekt Deutschlandreise“ nicht als PR-Filme. Wir behalten uns grundsätzlich vor, ggf. Sequenzen von Unternehmensvideos zu verwenden, wie dies auch bei TV-Sendern üblich ist. Wenn wir dies tun, kennzeichnen wir sie entsprechend, so wie wir die Quellen generell kennzeichnen.
Hat Intel für die Platzierung ihrer Filme im Online-Angebot der FTD Geld gezahlt?
Nein. Es gibt auch keine Intel-Werbung in den Videos. Aktueller Werbepartner des FTD-Videoplayers ist der Softwareanbieter Sage.
Ich bezweifle sehr, dass das stimmt: dass Redakteure von „FTD-Online“ „im Vorfeld an der Auswahl der Unternehmen beteiligt“ waren. Wie plausibel ist es, dass die „FTD“ ein Projekt mit Intel plant, das dann aber monatelang nur auf der Intel-Seite und dann zunächst auf „Welt Online“ erscheint?
Ein bisschen konterkariert wurde die Antwort der „FTD“ an mich auch dadurch, dass ungefähr gleichzeitig die Seite mit dem Video aus dem Angebot von FTD-Online verschwand und mir aus der Chefredaktion der „FTD“ bedeutet wurde, man sei alles andere als glücklich über das Projekt und die Art der Kooperation.
Deshalb habe ich gestern abend noch einmal offiziell nachgefragt, warum man das Angebot gleichzeitig verteidigt und beseitigt. Heute mittag bekam ich folgende Antwort:
Die Online-Kollegen waren im Vorfeld an der Auswahl der Unternehmen beteiligt, die auf der Deutschlandreise besucht werden sollen. Wir haben aber letztlich nur ein Video auf FTD.de gezeigt, da wir mit der Umsetzung nicht glücklich waren. Mittlerweile haben wir das Video von der Site genommen. Geld ist dabei nicht geflossen. Die Kooperation war rein redaktionell.
Ich halte den Anfang dieses Statements für eine Lüge, den Mittelteil für eine Ausrede und das Ende für rätselhaft.
Auch bei Intel widerspricht man der Darstellung der „FTD“. Die Liste der zu besuchenden Unternehmen habe allein der Chip-Hersteller bestimmt; die „FTD“ habe allein bestimmt, wann und in welcher Reihenfolge sie selbst die (gegenüber dem Original anders geschnittenen) Filme zeigt.
Dass die Zusammenarbeit nun abrupt beendet ist, bedauert Intel-Sprecher Hans-Jürgen Werner. Mit dem „Projekt Deutschlandreise“, in dem viel Herzblut stecke, habe das Unternehmen Neuland betreten. Die Wirren um die Zusammenarbeit mit „Welt Online“ und „FTD-Online“ verbucht er als Lernerfahrungen im Umgang mit einem neuen Medium. Es sei nicht darum gegangen, verdeckt Inhalte zu platzieren.
Falls die „Financial Times Deutschland“ noch weitere Versionen des Ablaufes auftreibt, werde ich sie natürlich hier nachtragen.

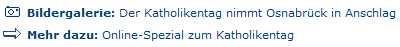

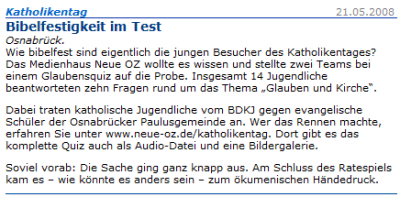
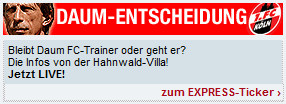












 In Belgrad wird schon seit Tagen geprobt, in Deutschland ist die Jagdsaison für Käseigel eröffnet und zwischen Baltikum und Kaukasus macht man sich bereit, sich die Punkte schneller zuzuschanzen, als man
In Belgrad wird schon seit Tagen geprobt, in Deutschland ist die Jagdsaison für Käseigel eröffnet und zwischen Baltikum und Kaukasus macht man sich bereit, sich die Punkte schneller zuzuschanzen, als man