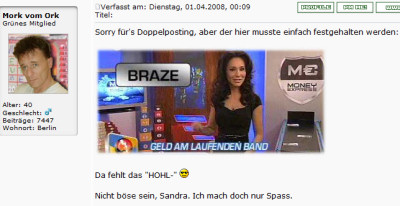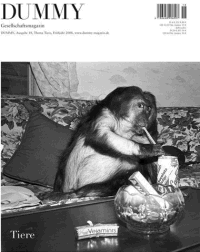Eva Herman hat einen klaren juristischen Sieg gegen die Nachrichtenagentur dpa erzielt. Es geht um eine Meldung über die berüchtigte Sendung von Johannes B. Kerner am 9. Oktober 2007. dpa hatte exklusiv noch vor der Ausstrahlung berichtet:
Zuvor hatte Kerner fast 50 Minuten lang die 48-Jährige immer wieder gefragt, ob sie ihre Äußerungen zu den familiären Werten im Nationalsozialismus heute so wiederholen würde. Doch Herman wich mehrfach aus und ergänzte: Wenn man nicht über Familienwerte der Nazis reden dürfe, könne man auch nicht über die Autobahnen sprechen, die damals gebaut wurden.
Das hat Eva Herman nicht gesagt, weder wörtlich noch sinngemäß. Es ging in ihrem Autobahn-Vergleich nicht um die Familienwerte der Nazis, sondern darum, ob man auf die heutige Bundesrepublik bezogen von einer „gleichgeschalteten Presse“ sprechen darf, wie sie es tat.
Nach dem Urteil des Landgerichtes Köln (Aktenzeichen 28 O 10/08) war die Art, wie dpa sie zitierte, unzulässig. Zwar bestehe „gegen vergröbernde Darstellungen, die im Kern wahr sind, in aller Regel kein Abwehranspruch“. „Vergröberungen, Einseitigkeiten und Übertreibungen“ müssten „in gewissem Umfang von dem Betroffenen hingenommen werden“, denn Sachverhalte ließen sich „auf dem beschränkten Raum, der für einen Pressebericht meist nur zur Verfügung steht, nicht derart vollständig darstellen lassen, dass unterschiedliche Eindrücke der Leserschaft ausgeschlossen werden“. Nachrichtenagenturen seien wegen der Kürze von Meldungen in besonderem Maße auf „griffige und eingängige Formulierungen angewiesen“.
All diese Zugeständnisse gälten aber nicht für Zitate, auch nicht in indirekter Rede:
Das ergibt sich daraus, dass Zitate des Betroffenen in ungleich größerer Weise geeignet sind, dessen Persönlichkeitsrecht zu verletzen, als dies bei der allgemeinen Berichterstattung der Fall ist. Denn der Betroffene wird als Zeuge gegen sich selbst ins Feld geführt. (…) demjenigen, der eine Äußerung wiedergibt, werden keine wesentlichen oder gar unzumutbaren Erschwerungen oder Risiken auferlegt, wenn er verpflichtet wird, konkret und zutreffend zu zitieren (…).
Dass der Zusammenhang, den dpa herstellte, nicht stimmte, hätte die Agentur trotz des Aktualitätsdrucks leicht erkennen können und müssen, so das Gericht.
Eva Herman und dpa hatten sich, wie berichtet, im Grundsatz bereits vor Wochen geeinigt: Die Nachrichtenagentur verpflichtete sich, nicht wieder zu verbreiten, dass Herman gesagt habe: „Wenn man nicht über Familienwerte der Nazis reden dürfe, könne man auch nicht über die Autobahnen sprechen, die damals gebaut wurden.“ Ursprünglich hatte Herman allerdings gefordert, die Meldung komplett zu untersagen. Deshalb sah der Vergleich vor, dass beide Seiten sich die Kosten für das Verfahren teilen.
Die Zustimmung zum Kostenvergleich widerrief Herman aber nachträglich, deshalb urteilte darüber das Gericht. Die Entscheidung ist eindeutig: 91 Prozent der Kosten soll dpa tragen, 9 Prozent Eva Herman.
Die Agentur will sich damit aber nicht abfinden. Ihr Anwalt argumentiert, dass der Kostenvergleich Teil eines Gesamtpakets war, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen — eigentlich sei dpa nicht der Auffassung, dass Eva Herman einen Anspruch auf Unterlassung hatte. Es sei unzulässig, einerseits das Verbot der Äußerung aufrecht zu erhalten, andererseits aber die Kostenfrage drastisch zu verändern.
Der dpa-Vertreter verweist auch darauf, dass Herman erst mit großer Verzögerung aufgefallen sei, dass ihr Persönlichkeitsrecht verletzt wurde: Sie will erst zwei Monate später von der Existenz dieser Meldung erfahren haben. Warum dann noch die Eilbedürftigkeit herrschte, die eine einstweilige Verfügung erforderlich machte, sei nicht einsichtig — insbesondere, da dpa vom Tag nach der Kerner-Sendung an differenzierter berichtete und Herman nicht mehr falsch zitiert hatte.
dpa hat deshalb Beschwerde gegen das Urteil eingelegt.