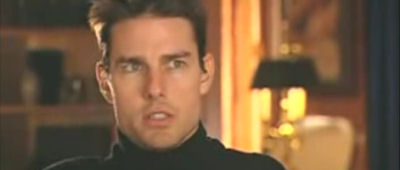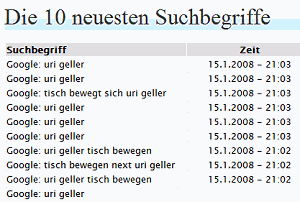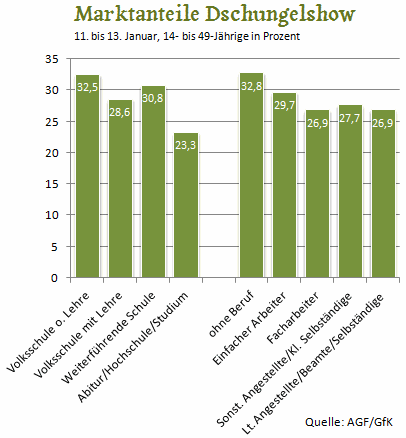Und das Wetter war früher auch besser. Von der Verlogenheit der Politik zur Verkommenheit der Jugend: Der „Bild“-Chefredakteur beklagt den Verfall der Werte — ausgerechnet.

· · ·
Die Türken sollen sich nicht grämen, sagt Kai Diekmann. Er und seine „Bild“-Zeitung hätten nichts gegen Ausländer, nur dagegen, dass so viele von ihnen kriminell werden, schrieb er in dieser Woche sinngemäß in der türkischen Zeitung „Hürriyet“. Und was den brutalen Überfall in München angeht, der die heftige Debatte um Jugend- und Ausländerkriminalität ausgelöst hat: „Dass der ältere Täter Türke ist, der jüngere Grieche, ist bloßer Zufall. Genauso hätten es Polen, Russen, Jugoslawen oder Kurden sein können — die Debatte wäre die gleiche gewesen.“ Die „Debatte“, wie „Bild“ sie gerade führt, ist sogar dann die gleiche, wenn die Gewalt von Jugendgangs ausgeht, deren Anführer Deutsche ohne Migrationshintergrund sind — trotzdem werden die Fälle von „Bild“ unter dem Begriff „Ausländerkriminalität“ zusammengefasst.
Man könnte sagen, „Bild“ führt mit Halb- und Unwahrheiten eine besinnungslose Kampagne gegen Ausländer. Diekmann würde sagen, „Bild“ spricht „unangenehme Wahrheiten“ aus und tut den Ausländern einen Gefallen.
In Diekmanns Welt gelten andere Gesetze. Was zum Beispiel unseren Kindern fehlt, sind mehr Dieter Bohlens. Weniger Kuschler, Schwurbler und Verständnispädagogen. Mehr Leute, die bereit sind, einer pickligen 16-Jährigen, die glaubt, singen zu können, vor einem Millionenpublikum ins Gesicht zu sagen, dass sie scheiße aussieht, scheiße klingt und scheißedoof ist, wenn sie glaubt, sie hätte bei „Deutschland sucht den Superstar“ eine Chance. Wer solche „unangenehmen Wahrheiten“ nicht ausspricht, meint „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann, betrügt sich selbst. Wer sie offen und ehrlich sagt, wie Bohlen, wird dafür von der Jugend verehrt. Und was würde mit einem Nichtschwimmer passieren, fragt Diekmann, wenn wir ihn mit dem Worten ins Wasser schickten, er hätte das Zeug zum Olympiasieger? Na also.
Es ist schwer zu sagen, ob Diekmann in seinem Freund Bohlen allen Ernstes einen Menschen sieht, der andere vor dem Ertrinken rettet, wenn auch nur im übertragenen Sinne. Aber es gibt in seinem Buch „Der große Selbst-Betrug“ keinen Hinweis darauf, dass es sich nur um eine ironische Übertreibung handelt und er nicht tatsächlich in Bohlen einen guten Zeugen sieht für seine Forderung nach Leistungsbereitschaft und Elitenförderung, nach einer Rückbesinnung auf traditionelle Werte in der Erziehung. Bohlen sei „der Lieblingsfeind des Gutmenschen und des gutmütigen Bürgertums“, stellt Diekmann fest, und so jemand hat im Koordinatensystem des „Bild“-Chefs sehr viel richtig gemacht.
Wie zum Beweis verweist er darauf, dass sich sogar die Medienwächter mit der Sendung beschäftigen mussten. Während Diekmann zu Bohlens Sprüchen die Begriffe „Ehrlichkeit“ und „Wahrheit“ einfallen, sprachen die von „antisozialem Verhalten“ und von einer Vorführung, „wie Menschen herabgesetzt, verspottet und lächerlich gemacht werden.“ Was Diekmann vielleicht entgangen ist: Das Konzept der Show besteht darin, Nichtschwimmern zu erzählen, sie könnten Olympia gewinnen, und ein wesentlicher Reiz für den Zuschauer, ihnen begleitet von hämischen Sprüchen Dieter Bohlens beim Ertrinken zuzusehen.
Nun ist der Musikproduzent nicht das einzige Beispiel Diekmanns, um seine pädagogische Vision zu entwickeln. Von Bohlen kommt er innerhalb weniger Seiten über Sex in Opern, Kant, die Nicht-Mitgliedschaft von Joachim Fests Vater in der NSDAP, die Entscheidung des Antarktis-Forschers Robert Scott, lieber mit seinem ganzen Team zu sterben, als einen Mann zurückzulassen, und Fotos von deutschen Soldaten mit Totenschädeln in Afghanistan zu Kindern, die nicht mehr „Danke“ sagen, und Comics, die Jesus als kiffenden Exhibitionisten zeigen. Argumentativer Höhepunkt: Schon das Sprichwort sage ja, man müsse die Menschen zu ihrem Glück zwingen.
Kai Diekmann hat es geschafft, ein Buch zu schreiben, in das man auf jeder Seite den Satz „Und das Wetter war früher auch besser“ einfügen könnte, ohne dass es so etwas wie einen Gedankenfluss unterbräche. Er entschuldigt sich im Vorwort dafür, dass er es aus dem Bauch heraus geschrieben habe, ohne jedes Wort auf die Goldwaage gelegt zu haben, aber es ist keine Suada geworden, kein rant, der mit seiner Wut Lust macht und kreativen Überschuss produziert, sondern nur eine Litanei. Man kann sie auswendig mitsprechen, seine Klagen über die Verlogenheit der Politiker und die Verkommenheit der Jugend, seine Forderungen nach weniger Bürokratie und besserer Erziehung, und die Fälle, die er aufzählt, sind die, die jeder kennt, was daran liegen könnte, dass sie allesamt von den Titelseiten der „Bild“-Zeitung stammen.
Man muss natürlich ein paar Umdefinitionen vornehmen, wenn man als Chefredakteur eines moralisch so verkommenen Blattes wie der „Bild“-Zeitung, anderen ihre Verantwortung für einen angeblichen allgemeinen Werteverfall vorwerfen will. Aber das gelingt Diekmann beunruhigend mühelos, nicht nur wenn er die Pöbeleien eines Dieter Bohlen im Dienste der Quote zu Akten lobenswerter Wahrhaftigkeit erklärt. Der Chefredakteur freut sich, dass die Privataudienz der „Bild“-Chefredaktion beim Papst bei Zeitungen wie „SZ“, „Zeit“ oder „Frankfurter Rundschau“ auf soviel Empörung stieß, obwohl sie es doch seien, die „an allen Tagen den Relativismus der Werte verkünden, die Schwulenehe zum Sakrament erklären und Euthanasie wie Abtreibung zum Menschenrecht“. (Andererseits ist nach wie vor offen, ob die „Bild“-Leute dem Papst eine Zeitung mitgebracht haben, um ihm deren „Werte“ in der täglichen Praxis zu demonstrieren: die schönen Bibeln, die dicken Brüste, die geilen Omas in den Sexanzeigen, die fetten Lügen in den Schlagzeilen, kurz: der ganze tägliche Kampf für und gegen den Anstand.)
Nachdem Diekmann seitenweise die Linken dafür schilt, Dinge zu tun, die gut gemeint, aber nur gut fürs eigene Wohlbefinden sind, lobt er seine Zeitung für den Erfolg mit „Florida-Rolf“, als „Bild“ den Bundestag dazu brachte, in Windeseile ein Gesetz zu verabschieden, das zwar dazu führt, dass mehrere Hundert Sozialhilfeempfänger nicht mehr im Ausland leben dürfen, aber höhere Kosten für den Steuerzahler produziert als zuvor.
Besonders erhellend ist auch ein Abschnitt über Philipp Mißfelder, der im Sommerloch 2003 fragte, ob die Solidargemeinschaft jedem 85-Jährigen eine neue Hüfte bezahlen müsse. Diekmann bedauert, dass die notwendige Diskussion darüber sofort mit Empörung im Keim erstickt wurde – „leider auch von ‚Bild'“. „Leider auch“? Seine Zeitung hat tagelang einen „Krieg der Generationen“ beschworen, „Schämt Euch!“ getitelt und den damaligen Junge-Union-Chef, den sie konsequent als „Milchbubi“ und „Milchgesicht“ verunglimpfte, gleich zweimal zum „Verlierer des Tages“ erklärt.
Diekmann behauptet, wer ein Thema wie den immanenten „Selbst-Betrug“ des deutschen Gesundheitswesens berühre, wie es Mißfelder getan habe, sei „in Deutschland politisch erledigt“. Offenbar hat er nicht gemerkt, dass Mißfelder anschließend munter weiter Karriere gemacht hat – obwohl vor allem „Bild“ alles dagegen tat. Diekmanns doppelter Selbstbetrug ist atemberaubend: Er muss nicht nur seine eigene Verantwortung verleugnen, sondern auch die Realität.
Oft setzt sich Diekmann aber gar nicht moralisch auf hohe Rösser, unter denen sich seine Zeitung täglich maulwurfartig durchgräbt, sondern fordert die anderen auf, zu ihm hinunter in den Schlamm zu kommen. Sein Buch durchzieht als roter Faden das Leiden des weißen, heterosexuellen Mannes, dass er heutzutage ununterbrochen auf irgendwelche Leute Rücksicht nehmen soll, die weniger normal sind als er. Es ist der Schrei einer gequälten Kreatur, eine Forderung nach weniger Verständnis, Anteilnahme und Toleranz, weniger Reflexion und mehr Vertrauen auf das, was Diekmann „Gesunden Menschenverstand“ nennt und vermutlich das ist, was aus Menschen in größeren Zusammenballungen Mobs macht.
Dazu gehört ein Plädoyer, die eigenen Möglichkeiten nicht zu überschätzen. Es ist ein Gegenentwurf zu dem schlichten „Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wer, wenn nicht wir?“ des ehemaligen Anarchosängers Rio Reiser, der später zu etwas wurde, das Diekmann voller Verachtung „Gutmensch“ nennen würde. Diekmann hält dem ein „Wieso ich, wenn nicht die anderen?“ entgegen. Über den ehemaligen Guantanamo-Gefangenen Murat Kurnaz schreibt er, dass für den in Deutschland geborenen Türken „nicht Deutschland, sondern allein die Türkei“ zuständig gewesen sei, und fügt noch hinzu: „‚allein‘ heißt ‚allein'“. Die Frage ist für ihn nicht, ob man helfen kann, sondern ob man zuständig ist, und zuständig scheint man auch dann nicht zu sein, wenn das eigene Tun ohnehin kaum einen Unterschied macht: Warum sollen sich die Deutschen ein Bein beim Klimaschutz ausreißen, wenn die Chinesen bald eh ein Vielfaches an Kohlendioxid produzieren werden? Er versteigt sich sogar in die Behauptung, dass „angesichts der Zahl der Reaktoren in unmittelbarer Nachbarschaft das Risiko nicht um einen [sic!] Jota sinkt“, wenn Deutschland aus der Atomkraft ausstiege. Das ist zwar mathematisch so falsch wie grammatisch, scheint aber eine Grundüberzeugung zu sein: Wenn alle anderen mit 130 durch die Fußgängerzone fahren, muss ich mich auch nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten – am Ende wird trotzdem ein Kind überfahren und ich bin völlig umsonst zwanzig Minuten länger unterwegs.
Man kann das beruhigend oder beunruhigend finden, aber die Verantwortlichen von „Bild“ scheinen bei ihrer täglichen Arbeit wenig Kompromisse mit sich selbst eingehen zu müssen. Wenn sie – nicht einmal zwei Wochen nachdem sie groß den Klima-Weltuntergang beschworen haben – titeln: „Klima-Schutz: Sollen wir Deutsche die Welt alleine retten?“, ist das kein Zugeständnis an den nötigen Populismus, sondern tiefe innere Überzeugung. Das macht den Reiz des Buches aus, an dem außer Diekmann fast die gesamte „Bild“-Führungsriege mitgewirkt hat: Es gibt einen konzisen Überblick über das Weltbild dieser Zeitung. Denn das ist beim flüchtigen Blick auf die Schlagzeilen heute nicht mehr so offenkundig wie vor zwanzig, dreißig Jahren: Auch „Bild“ ist oberflächlich weniger ideologisch geworden. Wenn in Köln Schwule und Lesben den „Christopher Street Day“ feiern, feiert auch die Kölner „Bild“ mit. Doch die darunter liegenden Überzeugungen, Ideologien und Urängste haben sich kaum geändert, das zeigt Diekmanns Buch.
Besinnungslos kämpft er gegen alles, was sich durch die Achtundsechziger oder „nach Achtundsechzig“ (konkreter wird er nicht) geändert hat, was dazu führt, dass er nebenbei sogar Anstoß daran nimmt, dass sich Berliner Schüler mit der Verfolgung der Homosexuellen im Nationalsozialismus beschäftigen sollen. Diekmann geht warm eingekuschelt in teils albernste Vorurteile und ausgelutschteste Phrasen durch die Welt, wirft den Achtundsechzigern noch Jahrzehnte später ihre ungepflegten Haare vor und macht sich die Welt wie sie ihm gefällt. Es sei ein „Aberglaube“, dass materielle Gleichheit glücklich mache, schreibt er, und während man darüber noch streiten könnte, weil es durchaus gegenteilige Forschungsergebnisse gibt, fügt er hinzu, dass Länder, die dem „Irrglauben“ an die Verteilungsgerechtigkeit des Staates gefolgt seien, „nicht in dem Ruf überschäumender Lebensfreude“ stünden, und nennt den „grauen Volksheimsozialismus der Schweden“ als Beispiel. Dabei sind gerade die Schweden ein Volk, das in fast allen Untersuchungen als eines der glücklichsten der Welt abschneidet, weit vor Deutschland.
Besonders rätselhaft an dem „Großen Selbst-Betrug“ ist, dass er in weiten Teilen Schlachten kämpft, die längst gewonnen sind. Diekmann bemängelt, dass Hans Eichel den Tag der deutschen Einheit abschaffen und Heiner Geißler das Wiedervereinigungsgebot aus dem Grundgesetz streichen wollte – durchgesetzt haben sich beide nicht, und doch genügt Diekmann schon ein gescheiterter Versuch als Beleg für die Verkommenheit unseres Landes, verschuldet durch die Achtundsechziger, ihre falschen Ideale, ihre Verblendung und ihren Selbsthass. Wortreich schildert Diekmann das angeblich so problematische Verhältnis der Deutschen zu sich selbst und ihrer Nation – um dann festzustellen, dass zur Fußball-WM so eine wunderbar friedliche und offenbar gesunde Welle des Patriotismus durch das Land schwappte. Entweder scheint das deutsche Nationalgefühl also nicht so pathologisch gewesen zu sein, wie Diekmann es beschreibt, oder diese vermeintliche Krankheit ist überwunden. Wo ist der Sieg der Achtundsechziger oder genauer: ihrer von Diekmann gezeichneten Karikatur, gegen den man noch ein Buch schreiben müsste (außer in Diekmanns Kopf)?
Diekmann wirft den Linken, den Gutmenschen, den Achtundsechzigern vor, Deutschland schlecht gemacht zu haben, im doppelten Sinne: Er macht sie erstens für all das verantwortlich, was in diesem Land seiner Meinung nach schiefläuft, vom Sozialbetrug über Jugend- und Ausländerkriminalität bis zur Abwendung von der Kirche, und zweitens dafür, dass dieses Land irgendwie nicht genug geliebt wird. Dabei wird es ihm schwer fallen, viele „Linke“ zu finden, die die Deutschen so sehr hassen, wie er es tut, wenn er in jedem Problem ein singulär nationales Phänomen sieht. Seine ganze Verzweiflung gerinnt im Vorwort zu der Frage: „Warum fehlt den Deutschen der Sinn für die Wirklichkeit, für Interessen, für die Selbstverständlichkeiten des Lebens?“ Kein Wunder, dass er darauf keine Antwort gefunden hat.
[Langfassung eines Artikels für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung]