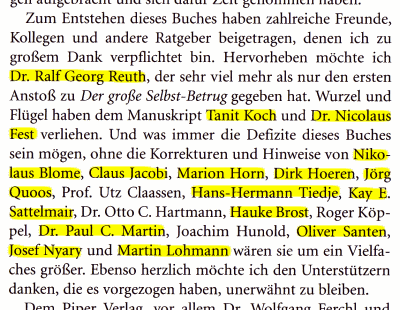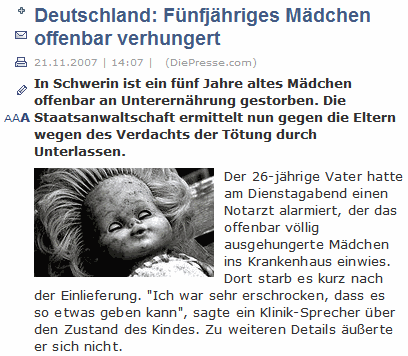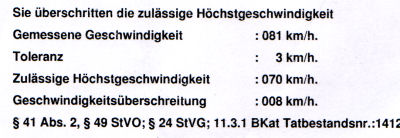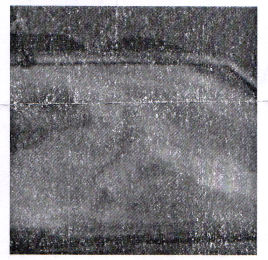Bei der „taz“ gibt es ein Pro und Contra zur Zusammenarbeit einiger großer Umweltverbände mit „Bild“, und Marlehn Thieme, Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung, argumentiert dafür:
Darf man sich als kritische Organisation mit einem Massenblatt einlassen, das bislang nicht gerade als Umweltschützer aufgetreten war? Manche Kritiker erinnerten an die Anti-Ökosteuer-Stimmungsmache der Zeitung: „Ökosteuer? – Ich hup euch was“. Kann der Feind wirklich zum Freund werden?
Ich meine ja. Es ist gut, wenn Saulus zum Paulus wird, gerade wenn es bequemer wäre, im eigenen Saft zu schmoren. Auch dem „Meinungsgegner“ muss man einen Gesinnungswandel zugestehen. Der Grundsatz „in dubio pro reo“, im Zweifel für den Angeklagten muss auch für die gelten, an deren Motivation manche zweifeln — und verborgene Hintergedanken wittern. Das gilt auch für Medien wie die Bild-Zeitung. (…)
Aber wenn die Bild-Zeitung ihre Leser dazu auffordert, das Klima zu schützen, dazu beizutragen, dass Energie gespart wird, dass nachhaltiger mit Ressourcen umgegangen wird, dass darüber nachgedacht wird, ob der nächste Urlaub wirklich mit dem Flieger gemacht werden muss – was ist dagegen einzuwenden?
Man könnte über diese Fragen ja kontrovers diskutieren, wenn denn die Voraussetzung stimmen würde: Die Annahme, dass „Bild“ sich verändert hat. Ich wüsste nur gerne, wie Frau Thieme oder die Umweltverbände darauf kommen, dass „Bild“ vom Saulus zum Paulus geworden sei. Das ist ein lustiger logischer Kurzschluss: Wenn „Bild“ mit Greenpeace zusammenarbeiten will, muss sich „Bild“ so verändert haben, dass Greenpeace mit „Bild“ zusammenarbeiten will. Außer der Kooperation selbst und ihrem unbestreitbaren PR-Effekt für „Bild“ sehe ich kein Indiz für eine veränderte grundsätzliche Haltung von „Bild“ in dieser Frage.
Um die Paulushaftigkeit der Zeitung richtig einzuschätzen, lohnt es sich, das Buch ihres Chefredakteurs zu lesen — das Kapitel „Unser täglicher Weltuntergang“, in dem Kai Diekmann vor allem mit den Grünen abrechnet, aber auch mit dem angeblichen „Selbst-Betrug“ der Deutschen insgesamt:
Ein Katastrophenszenario jagt das nächste – die Religion des Ökologismus braucht neue Heilige. Waldsterben, Killerstürme, Feinstaub, CO2 – fast ist es ein Wunder, dass es uns noch gibt. In Wirklichkeit geht es meist um anderes. Man will dem Auto ans Leder, oder genauer: dem Autofahrer ans Portemonnaie. (…)
Vor allem bleibt in der Hysterie um den „Klimawandel“ der Einfluss Deutschlands auf die weltweite CO2-Produktion so gut wie außer Betracht. (…) Schon heute ist China gemeinsam mit den USA für mehr als ein Drittel der 30 Milliarden Tonnen Kohlendioxid verantwortlich, die jährlich in die Luft geblasen werden. (…)
Die Klima-Schlacht wird also nicht in Deutschland geschlagen oder in Europa. Sondern vor allem in Asien und Lateinamerika, also in der Zweiten und Dritten Welt. Und auch in den USA. Selbst bei optimistischen Berechnungen machen daher alle deutschen Anstrengungen zur Senkung der CO2-Emmissionen [sic!] allenfalls einen Rundungsfehler im Steigungswinkel aus. Auch hier sollten wir daher von der trügerischen Autosuggestion Abschied nehmen, dass an unserem Gewese die Welt genese: Selbst wenn ganz Deutschland nachts im Dunkeln auf die Toilette ginge, hätte das nicht den Hauch eines Einflusses auf den Klimawandel. (…)
Klimaschutz funktioniert nur als globale Lösung, wenn alle an einem Strang ziehen. Doch wir Deutschen stehen auf einsamem Posten, wenn es um die Reduzierung der CO2-Emissionen geht (…). Nicht zufällig ist Deutschland das einzige Land auf Erden, das seinen Ausstoß von Treibhausgas in den zurückliegenden Jahren reduzieren konnte (…).
Selbst wenn Deutschland sämtliche Produktion stilllegen, den Individualverkehr abschaffen und auf jegliches Heizen von Häusern und Wohnungen verzichten würde, hätte dies kaum einen positiven Einfluss. Dennoch tritt Bundesumweltminister Gabriel auf, als könnten seine Vorschläge die Welt retten.
Das soll keineswegs heißen, dass man nicht tun sollte, was möglich ist – aber möglich allein reicht nicht. Es muss auch sinnvoll sein, vor allem verhältnismäßig. (…)
Wie vieles andere in der deutschen Politik hat auch der Ausstieg aus der Atomenergie eine eindeutig irrationale Seite. Man steigt aus, weil der Begriff „Atom“ den Deutschen Angst macht – er erinnert an Atombombe, Atomschlag, Atomkrieg. Dabei wissen alle: Angesichts der Zahl der Reaktoren in unmittelbarer Nachbarschaft sinkt das Risiko nicht um einen [sic!] Jota. (…)
Ich wüsste gerne, wie Diekmann darauf kommt, dass Deutschland „das einzige Land auf Erden“ sei, das den Ausstoß von Treibhausgas reduziert hat. Diese Daten der UNO widersprechen seiner Behauptung jedenfalls (bei aller Ernüchterung) sehr deutlich. Und ich wüsste auch gerne, was Mathematiker zu Diekmanns Wahrscheinlichkeitsrechnung sagen, dass sich das Gesamtrisiko nicht vermindert, wenn man ein (egal wie kleines) Teilrisiko eliminiert. Das wär auch ein schönes Experiment: Man setzt den „Bild“-Chefredakteur in die Mitte von zwanzig kleinen Sprengkörpern, die alle mit einer gewissen, kleinen, aber unbekannten Wahrscheinlichkeit explodieren und ihn verletzen können. Er hat die Möglichkeit, zwei dieser Sprengkörper ganz auszuschalten. Verzichtet er darauf, weil er sagt, das macht doch eh „keinen Jota“ Unterschied?
Vor allem aber wüsste ich gerne, wie die organisierten Umweltschützer darauf kommen, dass die „Bild“-Zeitung bereit sei, von ihren Lesern Opfer und einen Beitrag zum schonenden Umgang mit Ressourcen zu verlangen, wenn ihr Chef davon überzeugt ist, dass ihr Tun und Lassen global gesehen eh egal ist.
 Oh wie toll: Die herrlich albernen „Am Rande der Gesellschaft“-Comics von
Oh wie toll: Die herrlich albernen „Am Rande der Gesellschaft“-Comics von  (Dafür hat mich das halbe, schwarzweiße Gesicht von
(Dafür hat mich das halbe, schwarzweiße Gesicht von