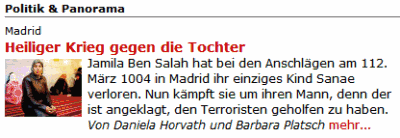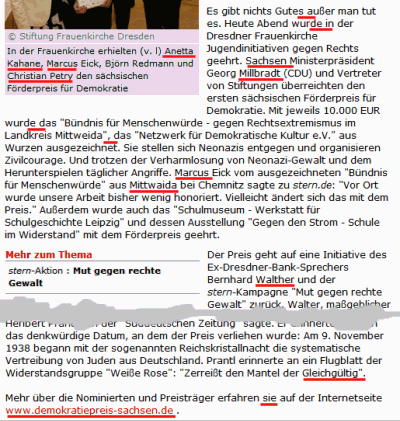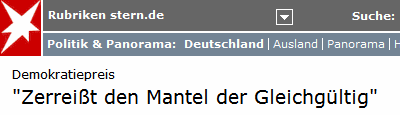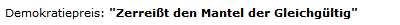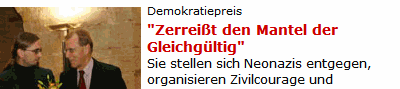In einem alten Busdepot im Osten Londons ist heute Mittag ein Feuer ausgebrochen. Hubschrauber liefern nonstop Aufnahmen, die eine große Rauchwolke in einem Industriegebiet zeigen. Und obwohl zunächst nichts dafür spricht, dass es sich um einen Terroranschlag handelt, und bald darauf alles dagegen, lassen sich die Sender nur widerwillig aus ihrer Möglicher!-Terroranschlag!-in!-London!-Routine bringen…
…die ja immer auch eine Gelegenheit für die Nachrichtenmoderatoren ist, zu zeigen, was sie können. Schalten wir also um zu n-tv:
· · ·
Andreas Franik: Mittlerweile wird der Rauch auch eher weiß. Also, diese schwarze Rauchfahne sehen wir nicht. Auch der Hinweis, es handelt sich nicht um eine Papstwahl, obwohl wir hier schwarzen und weißen Rauch abwechselnd sehen. Es ist so, Ulli Klose, dass es sehr weit außerhalb ist, dass diese Rauchentwicklung sehr stark ist. Wird die Londoner Bevölkerung in irgendeiner Form von diesem Brand auch über Radio informiert, weil immerhin ist es ja so, dass möglicherweise sehr schnell auch Fenster und ähnliches geschlossen werden müssen, gerade eben, weil es auch für Kinder möglicherweise schnell gefährlich werden kann.
· · ·
Andreas Franik: (zu Korrespondent Ulli Klose) Wie ist insgesamt die Sicherheitssituation zur Zeit in London einzuschätzen? Wie und was sagen die Sicherheitsbehörden, ist der aktuelle Zustand? Weiß man irgendetwas, ob irgendwas ansteht, oder, wie schaut’s aktuell aus?
· · ·
Petra Schwarzenberg: Und auch die Bilder, die wir im Augenblick sehen, sprechen doch dafür, dass es sich um einen ganz normalen, in Anführungsstrichen, aber großen Brand handelt, und die Feuerwehrleute löschen, aber so wie es aussieht, einigermaßen entspannt diesen Brand.
· · ·
Andreas Franik: „Nichts weist darauf hin, dass es sich um etwas anderes als ein Feuer handelte“, so auch nochmal das Zitat eines Polizeisprechers, der allerdings nichts Näheres zur Ursache des Brandes sagte, wahrscheinlich deshalb, weil man auch noch nichts Näheres weiß zu diesem Brand im Stadtteil Stratford. Die Angaben über die Löschzüge, die ausrückten, schwanken. Einige Agenturen sprechen von 6 Einsatzfahrzeugen, zudem waren zwei Rettungswagen im Einsatz. Andere sagen, es sind acht Löschzüge mit mehr als 40 Einsatzkräften gewesen. Manch andere Angaben wieder 80 Einsatzkräfte. Sei es drum. Fakt ist: Feuer in London, nicht in der Innenstadt, sondern in einem Außenbezirk. Es brennt, ja, möglicherweise eine Baustelle, möglicherweise eine Fabrikhalle, das lässt sich aus der Luft auch sehr, sehr schwer erkennen. Und möglicherweise waren es kohlenstoffartige Dinge, die dort gebrannt haben. In jedem Falle kann man davon ausgehen, dass nichts Großartiges, nichts Schlimmes passiert ist.
· · ·
Andreas Franik: Wir können Hartmut Zieps, Vizepräsident des deutschen Feuerwehrverbandes, auch ansprechen. Es ist ein Feuer in sehr, sehr großer Ausdehnung — oder recht großer Ausdehnung, wir wollen es auch nicht übertreiben, keine Frage. Aber es scheint offenbar doch sehr, sehr schwierig zu sein, mit dem Löschstrahl quasi jede Ecke und jedes Ende dieses Feuers zu erreichen. Erzählen Sie uns mehr über besondere Herausforderungen bei solchen Großbränden.
· · ·
Petra Schwarzenberg: Herr Zieps, kann man denn jetzt schon erkennen, ich weiß nicht, Sie haben die Bilder sicherlich gesehen, ob und dass der Brand unter Kontrolle ist, und wie lang es möglicherweise dauert, bis keine Rauchwolken mehr aufsteigen?
· · ·
Andreas Franik: Bei diesen Großfeuern, wo man auch noch nicht 100-Prozent-genau weiß, was da brennt, kommt da sofort immer und in erster Linie Wasser zum Einsatz oder arbeitet man hie und da auch mit Löschschaum? Ich muss so, ja, fast naiv auch nachfragen, weil ich kein Feuerwehrexperte bin, aber dafür haben wir Sie ja auch am Telefon.
· · ·
Petra Schwarzenberg: Herr Zieps, in Deutschland hatten wir Gottseidank noch nicht den Fall, aber gesetzt den Fall, es brennt irgendwo, bekommt die Feuerwehr Informationen darüber, um welche Art von Feuer es sich handelt? Dass es sich möglicherweise um einen Anschlag handeln könnte? Und agiert die Feuerwehr unter diesen Umständen, würde sie anders agieren als bei einem normalen Brand? Wie sind da die Instruktionen?
· · ·
Andreas Franik: Wir fassen das Geschehen noch einmal zusammen, liebe Zuschauer. Wir haben es gleich 14.15 Uhr. Wir wissen, dass viele, viele Zuschauer immer zur vollen oder zur halben Stunde oder eben auch zur Viertelstunde einschalten, viele, die sich jetzt erst zugeschaltet haben.
· · ·
Petra Schwarzenberg: Wenn man diese Bilder mit gesundem Menschenverstand sich anschaut, dann kann man eigentlich das auch aus den Bildern herauslesen [dass es kein Anschlag war]. Also, es ist wenig Dramatik. Es sind zwar viele Löschfahrzeuge vor Ort, die Feuerwehr löscht und es gelingt auch, diesen Brand zu löschen. Der Rauch wird schwächer und er ändert auch seine Farbe. Und es ist vor allen Dingen kein wirkliches Anschlagsziel vorhanden. Es sind Lagerhallen dort, aber terroristische Anschläge zielen auf Menschen, und Menschen sind dort, äh, kaum vorhanden.
· · ·
Andreas Franik: Immer wieder müssen wir sagen, das sind Livebilder, aus einem Helikopter aufgenommen, der sich sehr, sehr nah an das Feuer heranwagt. Der Qualm versperrt uns natürlich auch die Sicht, und wir können an der Stelle auch nicht genau sage, was im einzelnen da brannte, da müssen im Verlaufe des heutigen Nachmittags auch nähere Informationen von Scotland Yard abgewartet werden. Aber das wichtigste, und das wollen wir nicht müde werden zu betonen, wir wollen hier keine Panik verbreiten, wir wollen Ihnen erklären, was in London passiert ist: Es ist einzig und allein ein Feuer, und das bestätigt uns auch Scotland Yard. (Plötzlich sind Bilder von einer Pressekonferenz mit Angela Merkel zu sehen.) Und jetzt sehen wir Angela Merkel, die versucht auch hier und da vielleicht ein Feuer zu löschen, aber das deutsch-französische Verhältnis ist glaube ich zur Zeit nicht allzu belastet.
Petra Schwarzenberg: Nicht brandgefährdet.
Andreas Franik: So ist es. (Beide lachen.)
· · ·
Petra Schwarzenberg: Großbrand in der Nähe des Olympiageländes 2012. Daher natürlich auch erstmal Spekulationen, ob es sich um einen Anschlag handeln könnte, allerdings: Was hätte dieser Anschlag treffen sollen? Es steht noch nichts von den geplanten Anlagen.
· · ·
Petra Schwarzenberg: Ulli, London ist natürlich, auch wenn das in diesem Fall nicht der Fall war, ist terrorgefährdet. Es gibt immer wieder Terrorwarnungen. Wie ist die Situation im Moment? Wiegt sich die Bevölkerung in Sicherheit oder ist man ständig auf sozusagen auf dem Quivive in dieser Stadt?
· · ·
Andreas Franik: (nach einer Schaltung an die Börse, die sich von dem Feuer erwartungsgemäß unbeeindruckt zeigt) Ich meine, da wo nichts ist, kann auch nichts passieren, gar keine Frage. Und eben, wir haben es immer wieder betont, hier ist de facto – wir müssen natürlich immer in Anführungszeichen reden, natürlich ist hier etwas passiert, es ist ein Großfeuer. Aber es ist eben kein Anschlag, und nur dann gäbe es tatsächlich Reaktionen, ganz extreme Reaktionen und teilweise auch Verwerfungen an den Finanzmärkten, so ist es dort zumindest relativ ruhig. Petra.
Petra Schwarzenberg: So ist es, Andreas, und wir kommen zu den Nachrichten, zu den erwartbaren Nachrichten diese Tages zurück. Obwohl auch das nicht erwartbar war, denn am Rande eines Besuchs von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy in einem Berliner Gymnasium ist es zu einem Zwischenfall gekommen…