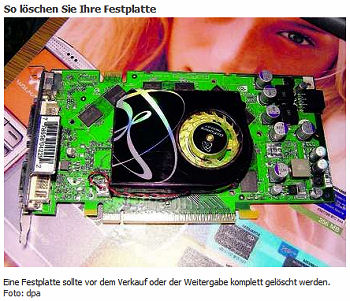Es wäre falsch, sich den Posten des Chefredakteurs von „Zeit Online“ als Traumjob vorzustellen, insbesondere wenn man damit den Anspruch verbände, dort mit Qualitätsjournalismus auf sich aufmerksam zu machen.
Das liegt zum einen an der „Zeit“. Anders als bei stärker zentralistisch und hierarchisch organisierten Unternehmen wie der Axel Springer AG lässt sich ein digitaler Aufbruch bei der „Zeit“ nicht so einfach von oben verordnen. Der Kulturwandel müsste von unten kommen. Aber die in vielen Zeitungen bei den Print-Redakteuren herrschende Skepsis gegenüber dem Internet im Allgemeinen und dem eigenen Online-Ableger im Besonderen scheint bei der „Zeit“ besonders ausgeprägt zu sein.
Doch es gibt ohnehin niemanden, der den digitalen Aufbruch von oben verordnen wollen würde: An der Spitze der „Zeit“ steht ein erklärter Internet-Skeptiker. Chefredakteur Giovanni di Lorenzo beschreibt in Interviews das neue Medium fast ausschließlich als Gefahr und nicht als Chance. Er warnt immer wieder davor, die Inhalte der gedruckten Zeitung online kostenlos zugänglich zu machen, und äußerte zuletzt im „Focus“ sogar Zweifel, „ob Online ein primär journalistisches Medium ist“.
Was der „Zeit“ und ihrem Chef an Internet-Euphorie fehlt, scheint ihr Eigentümer, die Verlagsgruppe Holtzbrinck, im Überfluss zu haben. Sie hat zig Millionen Euro ausgegeben, um das umstrittene Studentennetzwerk StudiVZ zu kaufen und beteiligt sich an einem Internet-Unternehmen nach dem nächsten. Doch das Interesse scheint sich vor allem auf das zu fokussieren, was mit dem Zauberwort „Web 2.0“ umschrieben wird: irgendwelche Formen von Communitys und User Generated Content. Aber teure publizistische Inhalte, nicht einmalige, sondern kontinuierlich hohe Investitionen, ohne Aussicht auf große Rendite und vor allem: ganz ohne Hype? Da ist man bei den Verlagsstrategen dann doch eher bei di Lorenzo: Wer weiß, ob sowas im Internet überhaupt funktioniert. Ob sich Qualität auszahlt.
Das sind vermutlich nicht die idealen Voraussetzungen, um ein erfolgreiches publizistisches Konzept für die „Zeit“ im Internet zu entwickeln und umzusetzen. Tatsache ist: Gero von Randow ist es nicht gelungen.
Dass er als „Zeit Online“-Chefredakteur geht, kann man als Rauswurf wegen Erfolglosigkeit interpretieren, als Niederlage im Kampf um Macht und die richtige Strategie, oder als entnervten Wurf der Flinte ins Korn durch Randow. Aber dass er mit seinem Konzept gescheitert ist, steht außer Frage.
Manche im Haus stellen den Konflikt auch als Richtungsstreit dar: Soll „Zeit Online“ möglichst breit als Nachrichtenportal aufgestellt werden und das klassische Themenspektrum der gedruckten „Zeit“ erweitern, wofür offenbar Randow stand? Oder muss es ganz spezifisch auf die Kernkompetenz der Wochenzeitung zugeschnitten sein, sich um Politik, Bildung, Kultur und Wissenschaft kümmern. Und wie könnte so eine Spezialisierung aussehen, womöglich gegen den Widerstand der Experten in der Print-Redaktion, die das ausgeruhte Analysieren im Wochenrhythmus gewöhnt sind?
Wirklich glücklich mit dem aktuellen Auftritt, der Kommentare und Analysen mit beliebigen Agenturmeldungen mischt, die vom „Tagesspiegel“ durchgereicht werden, scheint im Haus kaum jemand zu sein — die Frage ist nur, ob das einem falschen Konzept Randows geschuldet ist oder daran liegt, dass ihm die Unterstützung aus Redaktion und Verlag fehlten. Die Anziehungskraft auf Leser ist, trotz gestiegener Investitionen in das Angebot, begrenzt: Seit Monaten stagnieren die Zugriffszahlen, und das lässt sich nicht allein dadurch erklären, dass „Zeit Online“ weniger als andere durch Bildergalerien und ähnliche Gimmicks Klicks um jeden Preis (vor allem den des guten Rufs) zu generieren. Die Leserzahlen gehen sogar langsam zurück.
Dafür kommt neue, verlagsinterne Konkurrenz hinzu: Spätestens im nächsten Jahr will Holtzbrinck ein junges Nachrichtenportal mit dem Arbeitstitel „Humboldt“ starten, dessen Redaktion gerade mit der von tagesspiegel.de verschmolzen wurde.
Es wird nicht leicht werden für einen neuen Chefredakteur von „Zeit Online“, und es wird vermutlich schwer werden, überhaupt einen neuen Chefredakteur zu finden. Denn die Verfechter des gedruckten Wortes haben scheinbar gute Argumente auf ihrer Seite: Die Auflage der Zeitung steigt und steigt, und hinter diesen Zahlen stecken (zumindest überwiegend) Menschen, die sogar bereit sind, Geld für die Inhalte auszugeben. Wie sehr man bei der „Zeit“ noch in Kategorien Print gegen Online denkt, sieht man auch daran, wie sehr die Besonderheit betont wird, dass Randow in Zukunft sowohl für die gedruckte Zeitung als auch für zeit.de über Sicherheitspolitik schreiben wird. Was man für die natürlichste Sache der Welt halten könnte, wird offiziell als bemerkenswerter „neuer Weg“ verkauft.
In der Redaktion von „Zeit Online“ sieht man die Entmachtung des beliebten Gero von Randow mit Bedauern – aber auch als Chance, demnächst in neuen, professionalisierteren Strukturen arbeiten zu können.
Dass die Veränderungen nicht der Anfang vom Ende von „Zeit Online“ sind, dafür gibt es immerhin auch ein deutliches Signal: Von kommender Woche an wird Joschka Fischer jeden Montag für den Internet-Auftritt eine politische Kolumne schreiben. Eine Arbeit auch für das gedruckte Blatt schließt man bei der „Zeit“ nicht aus, aber der ehemalige Außenminister soll sich ausdrücklich gewünscht haben, im Internet zu publizieren.