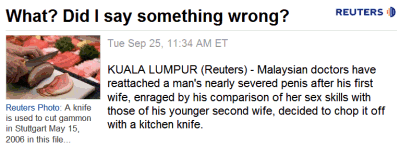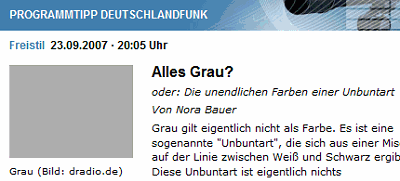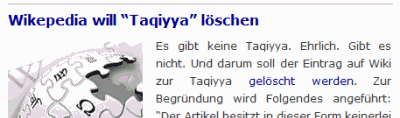Vor ein paar Tagen habe ich die Abschrift von einer Podiumsdiskussion bekommen, die ich auf den „Mainzer Tagen der Fernsehkritik“ des ZDF im März moderieren durfte. (Alle Diskussionen und Beiträge werden traditionell in gedruckter Form veröffentlicht.) Das Thema lautete, etwas sperrig: „Konsequenzen der Digitalisierung für Fiktion und Unterhaltung“, und es diskutierten Verena Kulenkampff, damals noch stellvertretende NDR-Programmdirektorin, aber schon designierte WDR-Fernsehdirektorin, und ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut.
Und beim nochmaligen Lesen stellte sich bei mir wieder das ungläubige Gefühl ein, das ich damals schon auf dem Podium verspürte:
Ich hatte mir eigentlich für den Schluss die Frage überlegt, ob die Antwort auf die Digitalisierung [für ARD und ZDF] ist, dass Sie viel mehr sehen müssen, dass Sie sich von da [aus dem Internet] Sachen mitnehmen und abgucken. Oder ob die Antwort genau das ist, eigentlich ganz anders zu sein; all das zu sein, was das Netz und alle Formen, die es da gibt, nicht ist. Im Grunde haben Sie, glaube ich, die Antwort schon sehr deutlich gegeben. Also, es ist das Zweite, oder?
Verena Kulenkampff: Nein, nein, nein! Als Wichtigstes der Digitalisierung kommt auf uns zu, dass wir ununterbrochen anderen Leuten auf die Finger klopfen müssen, die unsere Inhalte gegen ihr Recht nutzen. Die Digitalisierung bedeutet ja im ersten Schritt, dass es für jeden zugänglich ist, und darin sehe ich eigentlich ein Hauptproblem. […] Es gibt ganze Homepages, da werden die Inhalte, die zum Beispiel […] tagesschau.de verbreitet, auf irgendwelchen kommerziellen Seiten genutzt — und die Inhalte sind unsere Inhalte. Und ich finde, da müssen wir mit der Fliegenklatsche sitzen und wirklich sagen, ohne uns! Oder?
Thomas Bellut: Also, ich bin dann zufrieden, wenn mehr „heute“ als „Tagesschau“ dort zu sehen ist! (Lachen)
Kulenkampff: Ehrlich? Nein!
Bellut: Nein, das war jetzt nicht ernst gemeint! Aber ich meine, es wird eine komplizierte Sache, das einzudämmen.
Aber der Gedanke ist doch gar nicht so abwegig: Zu sagen, hoffentlich klauen die Leute mehr „heute“-Inhalte als „Tagesschau“-Inhalte, denn wie viele Leute werden tatsächlich auf irgendwelche NDR-, WDR-, ZDF-Sendungen aufmerksam, weil sie sie nicht im Fernsehen gesehen haben, sondern irgendwo unter Verletzung aller Copyrights bei YouTube?!
Kulenkampff: Unwahrscheinlich!
Bellut: Ja, das ist ein heißes Thema, Herr Niggemeier. Wir freuen uns auch schon, dass „Wetten, dass…?“ zum Beispiel bei YouTube enorm vertreten ist. Alle Wetten sind sofort im Netz. Wir fragen uns auch, wie das technisch geht. Aber sie sind halt da.
Aber Sie sehen es immerhin mit gemischten Gefühlen?
Bellut: Ja! Das sehe ich schon. Ich verstehe, was Sie sagen wollen, aber ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass man ein geordnetes Internet bekommen wird, wo alles genau kontrolliert wird. Mein Gott, das ist ein so gewaltiges Angebot. Das zu kontrollieren würde viel zu viele Planstellen kosten – also, da ist nichts zu machen.
Gesegnet seien die fehlenden Planstellen!
Nein, im Ernst: Ich konnte und kann nicht glauben, dass eine hochrangige ARD-Vertreterin auf die Frage, mit welcher Strategie sie auch in Zukunft das Publikum erreichen will, als wichtigsten Punkt den Gebrauch der Fliegenklatsche nennt.
Mir ist schon klar, dass ARD und ZDF es nicht offiziell gutheißen können, dass ihre Inhalte unter Verletzung von Urheberrechten überall weiterverbreitet werden, und spätestens dann, wenn jemand sie weiterveröffentlicht, um damit selbst Geld zu verdienen, wird es heikel.
Aber dieser Kampf gegen den Missbrauch kann doch nicht die wichtigste Reaktion von ARD und ZDF auf die Digitalisierung sein — und nicht nur deshalb, weil er so aussichtslos ist. Die zentrale Frage, vor die die Digitalisierung die etablierten Medien stellt, ist doch, auf welchen Wegen und mit welchen Inhalten sie in Zukunft die Menschen erreichen werden.
Muss sich das ZDF nicht über jeden Zuschauer, vor allem jeden der raren jungen Zuschauer freuen, der im Netz über ZDF-Sendungen stolpert, auf welcher Plattform auch immer?
Erstens glaube ich nicht, dass das schlecht ist für die Einschaltquote im Fernsehen: Vom Talentwettbewerb „Britain’s Got Talent“ zum Beispiel (der demnächst bei RTL unter dem Namen „Das Supertalent“ beginnt) finden sich massenhaft Ausschnitte bei YouTube, teilweise sogar offenbar vom Sender ITV selbst hochgeladen. Sie sind in jeder Hinsicht eine Werbung für die Show: Leute stoßen zufällig auf den Inhalt, gucken sich an, was sie verpasst haben, schicken Links weiter, diskutieren mit Freunden, wollen wissen, wie es ausgegangen ist. So paradox es für analog denkende Verantwortliche scheinen mag: Je mehr Menschen sich die Ausschnitte bei YouTube sehen, umso mehr Menschen werden sich die Live-Show im Fernsehen ansehen wollen.
Aber selbst, wenn das nicht so wäre. Angenommen, es stellt sich heraus, „Wetten dass“ wird von einer Million Leute auf irgendwelchen nicht-offiziellen Plattformen im Internet gesehen, und die weigern sich hartnäckig, samstags um 20.15 Uhr die Show im ZDF einzuschalten. So what? Für einen kommerziellen Sender, der allein vom Verkauf der Werbezeiten lebte, wäre das heikel. Aber ARD und ZDF müssen das nicht. Das ist theoretisch ein sensationeller Wettbewerbsvorteil. Den Öffentlich-Rechtlichen kann es völlig egal sein, wenn zehn Prozent der Zuschauer die Sendungen nicht im Fernsehen sehen, sondern irgendwo, irgendwie anders. Ihr einziges Ziel muss es sein, gute Programme herzustellen, und dafür zu sorgen, dass sie ein möglichst großes Publikum finden — um der Inhalte selbst willen.
Und im Interesse des eigenen Überlebens. Junge Leute gucken kein ARD und ZDF. Bei den 14- bis 29-Jährigen hat die ARD in diesem Jahr einen Marktanteil von 5,1 Prozent; das ZDF wäre, umgerechnet auf Wahlen, mit 3,9 Prozent eine Splitterpartei, die nicht einmal ins Parlament einzöge.
Zum Thema 9Live und Callactive finden sich, um ein Beispiel zu nennen, mehrere „Plusminus“-Sendungen auf YouTube, die von verhältnismäßig vielen Leuten verlinkt werden. Natürlich ist es unzulässig, diese Sendungen hochzuladen. Aber welches Interesse hat die ARD, dagegen vorzugehen? Keines.
Unterstellt, dass die ARD Sendungen produziert, die in irgendeiner Form gut sind, die uns — ich weiß, jetzt wird das Eis dünn — klüger machen, informierter, aufgeklärter, ist dann nicht ihr Interesse, dass diese Programme möglichst viele Menschen erreichen, auf welchem Weg auch immer? Und ist es so undenkbar, dass ein paar Leute, die in ihrem Leben noch keine Sendung mit dem merkwürdigen Namen „Plusminus“ eingeschaltet haben, auf diesem Wege überhaupt erst entdecken, dass es solche Verbrauchermagazine gibt, und dass jeder Kontakt die Chance erhöht, dass die Leute etwas Positives mit der ARD verbinden und vielleicht, ganz vielleicht selbst mal einschalten?
„Unwahrscheinlich“, sagt Frau Kulenkampff und holt die Fliegenklatsche.
 Heute abend wird zum 9. Mal der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Und ich blogge das ab kurz vor acht live vom Sofa — drüben beim
Heute abend wird zum 9. Mal der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Und ich blogge das ab kurz vor acht live vom Sofa — drüben beim