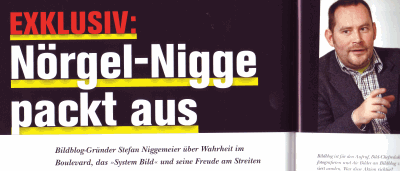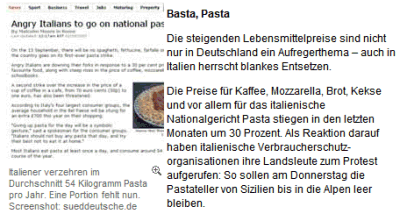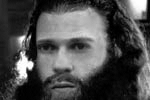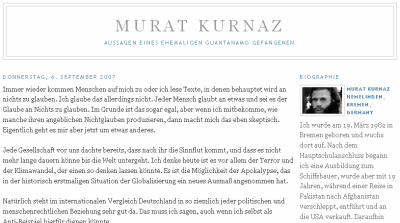Beate Klein, eine der Hauptautorinnen beim erfolgreichen Hass- und Hetzblog „Politically Incorrect“ (PI), schreibt:
Als relativ häufig aufgerufene Internetseite gegen den Mainstream ist PI immer wieder Zielscheibe linker Journalisten, die in Schmähartikeln ihre oft vor Un- und Halbwahrheiten strotzenden Diffamierungen verbreiten. Da die eigentlichen Beiträge für diese Medien zwar ärgerlich, in der Regel aber nicht angreifbar sind, zieht man einzelne Kommentare heran, um die Bösartigkeit und radikale Gesinnung PIs „beweisen“ zu können.
Ja, das ist echt blöd, dass die eigentlichen Beiträge von PI so selten angreifbar sind.
Gut, jetzt mal abgesehen von Beate Kleins Eintrag über das angebliche Blog von Murat Kurnaz, den sie den „zotteligsten Unschuldigen aller Zeiten“ nennt. Das Blog war nicht von Murat Kurnaz, was Frau Kleins Eintrag, sagen wir: angreifbar machte. Sie hat ihn sicherheitshalber nicht korrigiert, sondern ohne Erklärung gelöscht.
Ach so, und mal abgesehen von dem Eintrag von Jens von Wichtingen, der in Südafrika Sprachkurse veranstaltet und bei PI für Übersetzungen zuständig ist, über die angebliche Wandlung der BBC zur „Stimme Mekkas“.
Er berichtet:
Bei der BBC hat man sich entschlossen, den ganzen Schritt zu machen. In Zukunft wird man jedesmal bei Nennung des moslemischen Propheten Mohammed den bei Moslems gebräuchlichen Zusatz (Friede sei mit ihm) verwenden. Begründet wird das mit religiöser Toleranz – weil man dies ja auch bei anderen Religionen machen würde, wenn sie denn einen solchen Brauch hätten.
Die BBC-Seite, die seine Quelle für diesen Hammer ist, der bei den PI-Kommentatoren Fassungslosigkeit auslöst, ist allerdings vom 9.3.2006. Was laut PI „in Zukunft“ passiert, scheint also mindestens seit eineinhalb Jahren Praxis zu sein.
Und schon mit einfachsten Englischkenntnissen könnte man der Quelle entnehmen, dass die BBC dem Namen Mohammeds keineswegs „jedesmal“ die Worte „Friede sei mit ihm“ (peace be upon him / pbuh) hinzufügen wird. Die Regelung betrifft nur die Islamrubrik der Religionsseiten auf bbc.co.uk. Eine einfache Suche zeigt, dass die BBC den Zusatz auf den Nachrichtenseiten nicht verwendet.
(PI-Kommentator Phygos ist dennoch so erschüttert, dass er erklärt, dass England damit für ihn „endgültig als Urlaubsland flach fällt“, während PI-Leser Bokito vor Überreaktionen warnt: Schließlich könne man auch „jeden Samstag in Düsseldorf auf der Königsallee Heerscharen von Schleierschlampen beim Shoppen in den Nobel-Boutiqen anschauen. (…) Vor den Anhängern eines Kinderf**ers auf dem Boden zu kriechen ist die schlimmste Demütigung, die sich ein denkender Mensch vorstellen kann.“)
Ach so, und „angreifbar“ sind natürlich auch die PI-Einträge, in denen immer noch die Mär verbreitet wird, britische Banken hätten die Sparschweine abgeschafft, um die Gefühle muslimischer Kunden nicht zu verletzen — eine längst widerlegte Falschmeldung, die auch Henryk Broder und Udo Ulfkotte verbreiten, was dann wiederum PI aufgreift usw usf.
Ja, die PI-Autoren, für die „Gutmensch“ ein anderes Wort für „Nazi“ ist und die Andersdenkende als „dummdeutsche Multikultischwuchteln“ bezeichnen, sind gerne nicht nur politisch, sondern auch faktisch inkorrekt.
Als die „Berliner Morgenpost“ es wagt, einen Deutschen, der einen Rabbi angegriffen hat, einfach als „Deutschen“ zu bezeichnen, obwohl seine Eltern aus Afghanistan stammen, veröffentlicht ein PI-Gastautor bedeutungsschwanger die E-Mail-Adresse für Leserbriefe der Zeitung. Und die Kommentatoren überbieten sich in empörten Leserbriefen an die Zeitung, und keiner merkt, dass unter dem Artikel die Worte „AP“ stehen, weil es sich um eine Agenturmeldung handelt.
Der PI-Beitrag fordert, den mutmaßlichen Täter nicht als Deutschen, sondern als „afghanischen Moslem“ zu bezeichnen. Und die Kommentatoren erkennen die Gesinnung dahinter und sprechen offen aus, was die PI-Autoren nur andeuten. Ein „Junker“ schreibt:
Er ist kein TATSÄCHLICHER Deutscher, sondern ein “Passdeutscher”. Wenn ein Dackel ein Schild mit der Aufschrift “Schäferhund” um den Hals trägt, bleibt er ein Dackel, bis zu seinem seligen Ende!
Der Täter ist Afghane mit deutschem Pass, hat seiner Religion entsprechend einen Juden fast getötet und wartet nun darauf, das Selbe mit einem Christen machen zu können.
Wenig später spricht ein „Beowulf“ von einem „Kanakenmob“, und ein „Entfernungsmesser“ gerät ins Onanieren:
Meine Freundin kam von der Arbeit nach Hause. Ich hatte Besuch von zwei Freunden. Wir saßen im Hof, hinter uns mein alter Bundeswehrunimog. Meine Freundin erzählte uns, sie sei von drei Kanaken in einem roten BMW-Cabrio angemacht worden: Hy Alde, willst figgen?
Als Deutscher Hauptfeldwebel und PzZgFhr habe ich nach kurzer Lagebeurteilung meinen Entschluß gefasst und in die Worte “Aufsitzen, Männer” artikuliert. Wir also den Mog gestartet und auf den Innenstadtring gefahren. Das ist das bevorzugte Cruisin-Gebiet der Kamelf…er! Vor der übernächsten Ampel überholt uns ein rotes BMW-Cabrio. Bestzung: 3 Kanaken. Die halten vo der roten Ampel, wir nicht!
Schön mit gut Schmackes denen den Kofferraum verkleinert. Die guggten wie Säue am Samstag. Meine Männer und ich abgesessen, denen kalr gemacht, wer wir si´nd und was wir machen wenn sie die Fresse aufreisen. Die waren sehr kooperativ. Meine Versicherung hat den Schaden am BMW gelöhnt. Den Schaden am 1,5-Tonner habe ich mit was Farbe und nem Pinsel beseitigt!
„Beowulf“ antwortet ihm: „gefällt mir“, und ein „Bavarian“ kommentiert: „Gut gemacht!“
Ich weiß nicht, ob Beate Klein, Stefan Herre, Jens von Wichtingen und die anderen PI-Macher auch davon träumen, „Kanaken“ in den BMW zu fahren. Bestimmt finden sie schon den Gedanken „diffamierend“. Was können sie schon dafür, dass sich in ihrem Wohnzimmer ein rassistischer Mob trifft, dem sie mehrmals täglich frisches Popcorn und was zu lesen geben?