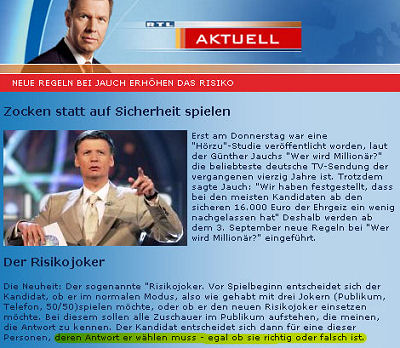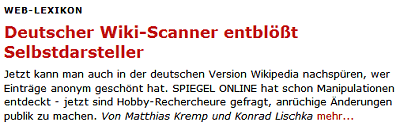Heute spielen wir Bildergalerienbingo mit der „Süddeutschen Zeitung“. Die hat ein Interview mit Sandra Maischberger geführt, und auf ihren Internetseiten präsentiert sie es in der schönsten journalistischen Form, die sie kennt: als zehnteilige Bildergalerie.
Das kann man an sich schon, nun ja: unfreundlich finden. Aber die Leute von sueddeutsche.de haben sich noch etwas besonderes ausgedacht: Es stehen nicht Frage und Antwort zusammen, sondern jede Seite endet mit einer Frage. Die Antwort folgt, wie bei einem Cliffhanger, erst nach dem Klick.
Bestückt ist die Bildergalerie, logisch: mit Bildern von Sandra Maischberger. Und als kleine Übung in Qualitätsonlinejournalismus versuchen Sie jetzt mal, die Fotos denjenigen Themenblöcken im Interview zuzuordnen, die sie bebildern:
| Abbildung: Maischberger mit… | Interview-Thema |
 (A) Anke Engelke, Michel Friedman, Peter Scholl-Latour, Dt. Fernsehpreis (A) Anke Engelke, Michel Friedman, Peter Scholl-Latour, Dt. Fernsehpreis |
(1) Nicht-Experten in Talkshows, Christiansen und Plasberg |
 (B) Georg Kofler (B) Georg Kofler |
(2) Helmut Schmidt |
 (C) Goldenem Panther, Bayerischer Fernsehpreis (C) Goldenem Panther, Bayerischer Fernsehpreis |
(3) Gästeakquise bei 4 ARD-Talkshows |
 (D) Stefan Aust (D) Stefan Aust |
(4) Maybrit Illner |
 (E) Dirk Bach, Moderation Dt. Fernsehpreis (E) Dirk Bach, Moderation Dt. Fernsehpreis |
(5) Talk als Genre, Formatierung durch Plasberg |
So, Konzentration: Welcher Buchstabe gehört zu welcher Zahl?
………
Na, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder.
………
Nicht spicken!
………
Hm? Sie sagen, da muss was schiefgelaufen sein? Da passt gar kein Foto zu keinem Thema? Aber von wegen!
Die Lösung lautet:
Und bestimmt ist das für die Verantwortlichen von sueddeutsche.de irgendwie zwingend.
Im Ernst: Was wir da sehen, sind nicht mehr die unsicher umherirrenden Versuche einer großen seriösen Tageszeitung, ihren Platz im Internet zu finden, das sie mehr als jede andere Zeitung, die ich kenne, fast ausschließlich als einen verkommenen, unwirtlichen und gefährlichen Ort beschreibt. Dieses Angebot scheint nur noch ein Ziel zu haben: Möglichst viele Leute anzulocken, die dumm genug sind, auf alles zu klicken, was sich anklicken lässt, und mit allem zufrieden zu sein, was sie dahinter finden, und sei es nichts.
Unter jedem einzelnen Interviewfragment mit Sandra Maischberger steht bei sueddeutsche.de dies:
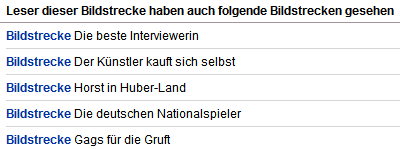
Und das Ressort Kultur macht aktuell, von oben nach unten, mit folgenden Geschichten auf:
- Angeblich eine Bildergalerie der schockierendsten Hitparaden-Spitzenreiter, die aber in Wahrheit auf eine 24-tlg. Bildergalerie über, äh, das Farbfernsehen und Farbe allgemein verlinkt
- Ein neueres Quiz über nutzloses Wissen
- Ein älteres Quiz über nutzloses Wissen
- Ein Quiz über Begriffe aus der DDR
- Ein Quiz zur deutschen Sprache
- Ein Quiz, bei dem man Selbstportraits von Popstars erkennen soll
- Eine Bildergalerie mit den schlimmsten Plattencovern aller Zeiten
- Ein „Summer of Love“-Spezial mit Styleguide als 23-teilige Bildergalerie
- Das Internetvideo der Woche
- Das Internetvideo von vergangener Woche
- Ein Internetvideo von irgendwann
- Das Internetvideo von vorletzter Woche
- Eine Übersicht über Internetvideos der letzten 45 Wochen
- Eine Bildergalerie der 100 beste Biere
- Eine Bildergalerie mit 14 Fotos von Steve McQueen
- Eine Bildergalerie mit 21 Fotos von Außerdischen
Darunter folgt dann tatsächlich, unfassbarerweise, ein aktueller Artikel über das Filmfestival von Venedig. Es muss sich um ein Versehen handeln.




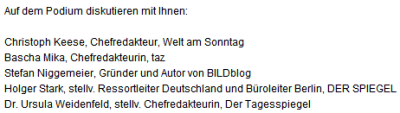
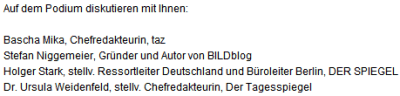
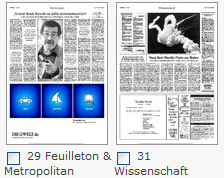 Ich habe leider keinen Zugriff auf das interne Springer-Archiv, aber im Online-Archiv der „Welt“ lässt sich der Artikel auch nicht finden. Und wer immer ihn gelöscht hat — er hat ganze Arbeit geleistet: Im
Ich habe leider keinen Zugriff auf das interne Springer-Archiv, aber im Online-Archiv der „Welt“ lässt sich der Artikel auch nicht finden. Und wer immer ihn gelöscht hat — er hat ganze Arbeit geleistet: Im