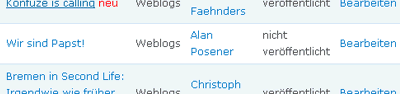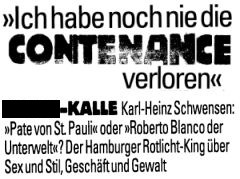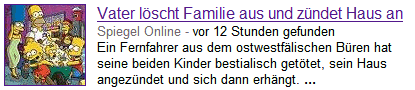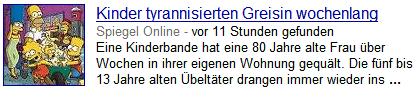Man muss sich das ungefähr so vorstellen: Da ist jemand, der sein Geld mit, sagen wir, einem Würfelspiel verdient. Abend für Abend kann man beobachten, wie er erst, bei niedrigen Einsätzen, die zu erwartende bunte Mischung aus niedrigen und hohen Zahlen würfelt, mal gewinnt und mal verliert; aber immer dann, wenn es darauf ankommt, würfelt er eine Sechs nach der anderen. Abend für Abend geht das so. Der Ablauf ist so berechenbar, dass Menschen, die ihm schon länger beim Würfeln zugucken, mit hoher Trefferquote vorhersagen können, welche Zahl er als nächstes würfeln wird. Dann muss man sich vorstellen, es gebe eine Würfelspielaufsicht. Die ist im Wesentlichen damit beschäftigt, die Organisation der Würfelspielaufsicht zu organisieren, Seminare über die bestmögliche Würfelspielaufsichtsorganisationsorganisation zu veranstalten und mit anderen Würfelspielaufsehern über die Kompetenzen zu streiten. Ihre Waffe gegen Spieler mit falschen Würfeln ist ein strenger Blick; in ganz extremen Fällen kann sie sogar mit dem Zeigefinger drohen, notfalls mehrmals. Und schließlich muss man sich vorstellen, dass es Leute gibt, die sich Abend für Abend neben den Würfelspieler stellen und immer, wenn er gerade die zehnte Sechs hintereinander gewürfelt hat, laut „Betrug!“ rufen. Das lässt ihnen der Würfelspieler aber gerichtlich untersagen, denn sie konnten leider nicht den Würfel vorlegen, um das beweisen zu können. Danach rufen sie nur noch „Das kann doch gar nicht sein!“ Aber der Würfelspieler lässt ihnen auch das verbieten. Und irgendwann ist Ruhe. Und der Würfelspieler trifft sich nur alle paar Jahre noch mit den Würfelspielaufsehern und beide vereinbaren, dass der Würfelspieler in Zukunft keine Siebenen mehr mit seinem einzelnen Würfel würfelt, also jedenfalls nicht mehr so oft.
Und damit zu einem ganz anderen Thema.
Die Firma Callactive, die im Auftrag von MTV Anrufsendungen produziert, in denen immer wieder erstaunliche Unregelmäßigkeiten zu beobachten sind, die gegen einen fairen Ablauf sprechen, hat heute vor dem Oberlandesgericht München einen vernichtenden Sieg gegen das Forum call-in-tv.de und, wie ich sagen würde: die Meinungsfreiheit und den Verbraucherschutz errungen. Es darf die vielen (vielen, vielen!) Menschen, die täglich bei Callactive in die Sendung durchgestellt werden und erhebliche Geldsummen gewinnen könnten, aber völlig abwegige Antworten geben oder gleich wieder auflegen, de facto nicht mehr als „verwirrte Anrufer“ bezeichnen, da dieser Begriff als Synonym für „Fake-Anrufer“ also die Unterstellung eines Betrugs durch Callactive ausgelegt werden könnte. (Mehr über die Hintergründe des Verfahrens hier.)
Marc Doehler, Betreiber des Forums, finanziell und kräftemäßig erschöpft, kapituliert nun – zumindest vorläufig. Kein Wunder: Die erste Instanz hatte ein Urteil, wie es jetzt ergangen ist, noch als De-Facto-Untersagung eines kritischen Forums überhaupt gewertet.
Zu Recht. Man muss sich das ausmalen: Wenn bei „Money Express“ jemand durchgestellt würde und die ausgelobten 100 Geldpakete plus Plasmafernseher nicht gewänne, weil er auf die Frage „Wieviel ist 2 mal 2“ mit „Rosenkohl“ antwortete, dürften die Protokollanten von call-in-tv.de diesen Anrufer bei Androhung eines Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu 250.000 Euro nicht als „verwirrt“ bezeichnen, weil man daraus den Vorwurf lesen könne, der Anrufer sei nicht zufällig verwirrt, sondern jemand, der im Auftrag von Callactive verwirrt tue, um den Eindruck zu erwecken, es würden regelmäßig tatsächlich Anrufer in die Sendung durchgestellt, ohne aber etwas zu gewinnen. Tatsache ist, dass es bei Callactive außerordentlich viele Anrufer gibt, die Antworten geben, die nicht nachvollziehbar sind. Die erste Instanz, das Landgericht München, wusste das sogar und fand ein schönes Synonym für „verwirrte Anrufer“: „Blindgänger“.
Ich habe Norbert Schneider, den Chef der unter anderem für Viva zuständigen Landesmedienanstalt, vor einigen Wochen folgende Frage gestellt: „Was wäre, rein hypothetisch, wenn Callactive in seinen Sendungen auf Viva Tag für Tag systematisch gegen die Gewinnspielregeln der Landesmedienanstalten verstoßen würde: Hätten Sie dann eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen und andere Maßnahmen zu ergreifen, als nur immer wieder eine folgenlose ‚Beanstandung‘ gegen Viva auszusprechen?“ Seine Antwort lautete: „Nein. Wir haben keine Rechtsgrundlage, auf der wir tätig werden und zum Beispiel mit einem Lizenzentzug drohen könnten.“
Die Firma Callactive, die mit einer ganzen Welle von Klagen, Abmahnungen und Drohungen gegen Kritiker ihrer Sendungen vorgeht, verwahrt sich gegen den Vorwurf, Anrufe zu fälschen und nennt ihn geschäftsschädigend. Callactive-Geschäftsfüher Stephan Mayerbacher sagte gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de vor sechs Wochen, sein Unternehmen könne jederzeit das Gegenteil anhand einer Offenlegung der Telefon-Verbindungsdaten der jeweiligen Sendungen belegen.
Ich bezweifle das. Ich habe Mayerbacher am 14. Juni eine Mail geschrieben und ihm mitgeteilt, dass ich gerne die Telefondaten der umstrittenen „Money Express“-Sendungen einsehen würde. Ich fragte ihn:
In welcher Form könnten Sie mir diese Daten zur Verfügung stellen?
Falls Sie die Daten nicht mir direkt zukommen lassen wollen, wem gegenüber würden Sie sie offenlegen? In welcher Form könnte „jederzeit“ der Beleg erbracht werden, dass Ihr Unternehmen nicht mit gefälschten Anrufen arbeitet?
In seiner Antwort verwies er allgemein auf die damals noch nicht abgeschlossenen Vorschläge für neue Gewinnspielregeln und schrieb, „künftig“ könnten die Landesmedienanstalten auf gezielte Beschwerden von Zuschauern hin die Echtheit der eingegangenen Anrufe überprüfen.
Ich fragte nach:
Wenn ich Ihre Mail richtig verstehe, lehnen Sie eine Offenlegung der Telefon-Verbindungsdaten zum jetzigen Zeitpunkt ab. Sie sprechen mir gegenüber ausschließlich von „künftigen“ Möglichkeiten. In Ihrer Klage gegen call-in-tv.de geht es aber nicht um künftige Fälle, sondern um vergangene Fälle.
Verstehe ich Sie richig? Sie sagen, Ihr Unternehmen könne jederzeit beweisen, dass es keine Anrufe fälsche, lehnt es aber im Moment ab, dies zu tun?
Anders gefragt: Gibt es irgendein Verfahren, in dem Sie sich vorstellen können, diesen Beweis, den Sie nach eigenen Aussagen „jederzeit“ führen können, in Bezug auf die Sendungen der vergangenen Wochen zu führen?
In seiner Antwort erklärte er, ich hätte seine vorige Mail falsch interpretiert. Sein Unternehmen speichere heute schon Telefonverbindungsdaten in ausreichender Länge, um zum Beispiel die Landesmedienanstalten in die Lage zu versetzen, auch „rückwirkende Investigationen“ in Bezug auf die Echtheit der Anrufer zu ermöglichen. Darüber hinaus bot er mir an, auch mir gegenüber einen Nachweis zu führen, dass die Anrufer in von mir ausgewählten Sendungen echt gewesen seien. Details, insbesondere in Hinblick auf den Datenschutz, müsse er noch mit seinem Juristen besprechen.
Am 27. Juni schrieb ich Mayerbacher, dass ich sein Angebot gerne annehmen würde, und erkundigte mich, ob er schon wisse, in welcher Form er den Nachweis führen könne. Mayerbacher antwortete nicht.
Am 30. Juni fragte ich Mayerbacher, ob er meine Anfrage erhalten habe. Mayerbacher antwortete nicht.
Am 3. Juli fragte ich noch einmal nach, ob er schon eine Idee habe, in welcher Form und wem gegenüber er, wie angegeben, die Telefon-Verbindungsdaten offenlegen könnte. Mayerbacher antwortete nicht.
Am 10. Juli erkundigte ich mich, ob sein Angebot vom 15. Juni, mir gegenüber den Nachweis über die Echtheit der „Money Express“-Anrufe zu führen, noch gelte. Mayerbacher antwortete nicht.
Natürlich beweist das nichts. Die Tatsache, dass Callactive die Echtheit der Anrufe nicht beweisen will, bedeutet nicht, dass dass sie es nicht könnte. Warum sollte sie es auch tun, wenn das Geschäft gut läuft, man diese unfassbare Glückssträhne hat, was die durchgestellten Anrufer mit falschen Antworten angeht, eine Medienaufsicht nicht existiert und man Kritiker und Mahner mithilfe von Gerichten zum Schweigen bringen kann?
Alle Einträge zum Thema Callactive.