Am 30. Juni endete nach 16 Jahren der Vertrag von Volker Finke als Trainer beim SC Freiburg, und die letzten Wochen waren einigermaßen turbulent.
 Aber das ist hier keine Sport-Geschichte, sondern eine Medien-Geschichte. Sie beginnt, wie so viele, in der „Bild“-Zeitung. Sie berichtet am Dienstag, Finke habe „trotz mehrfacher Aufforderung seine Schlüssel nicht abgegeben“. Der Verein habe deshalb die Schlösser ausgetauscht, schreibt „Bild“ und zitiert den neuen Sportdirektor Dirk Dufner mit dem Satz: „Ja – wir wollten einfach unsere Ruhe und keinen Ärger haben!“
Aber das ist hier keine Sport-Geschichte, sondern eine Medien-Geschichte. Sie beginnt, wie so viele, in der „Bild“-Zeitung. Sie berichtet am Dienstag, Finke habe „trotz mehrfacher Aufforderung seine Schlüssel nicht abgegeben“. Der Verein habe deshalb die Schlösser ausgetauscht, schreibt „Bild“ und zitiert den neuen Sportdirektor Dirk Dufner mit dem Satz: „Ja – wir wollten einfach unsere Ruhe und keinen Ärger haben!“
Schöne Geschichte. In einer Meldung des Sport-Informationsdienstes (sid) von 11.45 Uhr am Dienstag liest sie sich dann so:
Finke gibt Schlüssel nicht ab
SC Freiburg tauscht Schlösser aus
Freiburg (sid) (…) Nach SC-Angaben hat Finke (…) trotz mehrfacher Aufforderung seine Schlüssel für den Management-Raum nicht abgegeben.
Aus diesem Grund tauschten die Freiburger in der vergangenen Woche vor der Abreise der SC-Profis in das Trainingslager nach Schruns sicherheitshalber die Schlösser aus. „Wir wollten einfach unsere Ruhe und kein Ärger haben“, sagte Sportdirektor Dirk Dufner der Bild-Zeitung.
Die Formulierung „nach SC-Angaben“ ist interessant. Bedeutet sie, dass der sid beim Verein selbst nachgefragt hat? Oder nur, dass der sid die angeblichen „SC-Angaben“ der „Bild“-Zeitung entnommen hat? Der sid will das auf Nachfrage nicht beantworten. Es könne beides bedeuten, sagt der diensthabende Chef vom Dienst, das gehe niemanden etwas an. Auf die Idee, in jedem Fall auch eine Stellungnahme Volker Finkes zu den Vorwürfen einzuholen, ist der sid jedenfalls nicht gekommen.
Auch nicht die Nachrichtenagentur dpa, wo die Geschichte am Dienstag um kurz nach 12 Uhr auftaucht. Hier scheint wenigstens die Quellenlage eindeutig:
Fußball-Trainer Volker Finke hat nach seinem Abschied vom SC Freiburg seine Schlüssel nicht abgegeben. (…) Der neue SC-Sportdirektor Dirk Dufner ließ daher in der vergangenen Woche die Schlösser zu den Management-Büros austauschen. „Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen. Wir wollten ganz sicher gehen“, sagte Dufner am Dienstag und bestätigte einen Bericht der „Bild“-Zeitung.
Es scheint also keinen Grund zu geben, am Wahrheitsgehalt der Geschichte zu zweifeln — bis der Online-Auftritt der „Badischen Zeitung“ am Dienstagnachmittag mit einem Dementi überrascht:
(…) Ex-Trainer Volker Finke soll (…) — und seinen Schlüssel bei Vertragsende am 30. Juni nicht abgegeben haben, trotz mehrmaliger Aufforderung. Doch das ist falsch.
Gegenüber der Badischen Zeitung erklärte SC-Sportdirektor Dirk Dufner, dass Finke seinen Schlüssel sehr wohl abgegeben habe – und das fristgerecht. Warum er von der Nachrichtenagentur dpa im gegenteiligen Sinn zitiert wurde, ist Dufner ein Rätsel. (…)
Der Tausch der Schlösser sei nur eine „präventive Maßnahme“ gewesen. Am Tag darauf in der gedruckten Ausgabe der „Badischen Zeitung“ macht Dufner das „Rätsel“ noch konkreter: „Von denen“, sagt er auf dpa gemünzt, „hat keiner mit mir gesprochen.“
Das ist, wie so vieles in dieser Geschichte, nicht ganz falsch, aber noch lange nicht richtig. Und wir müssen kurz die Chronologie verlassen und zum Freitag vergangener Woche zurückgehen und zu einem Treffen, mit dem das ganze Drama begann. Am Rande des Trainingslagers des SC Freiburg stand Dufner offenbar mit ein paar Journalisten zusammen, ein Mann von dpa war dabei und der Kollege von der „Bild“-Zeitung, und man redete über Volker Finke. Und anscheinend erzählte Dufner bei dieser Gelegenheit auch von möglicherweise fehlenden Schlüsseln und der Schloss-Austauschaktion — vielleicht unter der Maßgabe, die Journalisten sollten darüber nicht berichten, vielleicht nur in der Annahme, sie täten es nicht.
Als „Bild“ dann die vermeintliche Schlüsselaffäre publik machte, erinnerte sich der dpa-Mann, dass er ja dabei war, als Dufner davon erzählt hatte. Er verzichtete deshalb darauf, bei Dufner noch einmal nachzufragen, und lieferte stattdessen ein Zitat Dufners, das er selbst am Freitag vor Ort notiert hatte. Die Agenturmeldung datierte dieses Zitat jedoch auf den Dienstag — und erweckte den falschen Eindruck, Dufner habe den „Bild“-Bericht nach dessen Erscheinen bestätigt. Was besonders verheerend war, denn ob Dufner sich tatsächlich so über Finke geäußert hat, ist die eine Frage; ob er diese Äußerung im Nachhinein „bestätigt“ hätte, eine ganz andere. Gegenüber der „Badischen Zeitung“ (die offenbar beim kleinen Journalistentreffen am Rande des Trainingslagers nicht dabei war), ruderte er jedenfalls heftig zurück.
Zu spät. Am Mittwochmorgen, als in der „Badischen Zeitung“ das Dementi steht, steht die Meldung von Finkes Schlüssel-Affäre in vielen Tageszeitungen, zum Beispiel in „SZ“, „Welt“, „taz“ und „Tagesspiegel“. Erst am Mittwochnachmittag schwenkt dpa, wo man sich intern inzwischen intensiv um eine Aufklärung der Vorgänge bemüht, auf eine offenbar sehr sorgfältig formulierte Version um, auf die sich alle Beteiligten inzwischen verständigt zu haben scheinen:
Freiburgs Ex-Coach Finke wehrt sich: «Habe Schlüssel abgeliefert»
Freiburg (dpa) – Die «Schlüsselaffäre» beim Fußball-Zweitligisten SC Freiburg um Ex-Trainer Volker Finke hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. «Ich habe meinen Schlüssel am 29. Juni abgeliefert», teilte der 59-Jährige, dessen Vertrag am 30. Juni ausgelaufen ist, der Deutschen Presseagentur dpa mit. Er reagierte damit auf einen Medienbericht, in dem es unter Berufung auf SC-Sportdirektor Dirk Dufner geheißen hatte, der Sportclub habe die Schlösser ausgetauscht, weil die Schlüssel nicht vollzählig seien.
Dufner hatte zuvor vor Medienvertretern erklärt, dass Schlösser an Gebäuden auf dem Freiburger Trainingsgelände ausgewechselt worden waren. «Vor der Abreise ins Trainingslager wurde vorsorglich das Schloss im Management-Büro ausgetauscht, weil bei einer Bestandsaufnahme festgestellt worden war, dass nicht alle Schlüssel da waren. Dort lagern schließlich wichtige Papiere. Volker Finke hat seinen Schlüssel aber inzwischen fristgerechtigt abgegeben», sagte Dufner am Mittwoch.
Auf Aufforderung, den Schlüssel abzugeben, sei zunächst aber keine Reaktion Finkes erfolgt, hatte unter anderem die dpa aus einem Gespräch mit Dufner berichtet.
Bei dpa hofft man, dass sich mit dieser Meldung auch eine juristische Auseinandersetzung erledigt hat: Der empörte Volker Finke fordert über seinen Anwalt nämlich von dpa Richtigstellung und Widerruf der ursprünglichen Behauptungen. Die „Bild“-Zeitung hat ihre Version bis heute nicht korrigiert; ihr Sprecher will auf Anfrage nicht sagen, ob Finke auch gegen „Bild“ vorgeht, was logisch wäre.
Und beim sid verbittet der Chef vom Dienst alle Fragen nach Quellen, Wahrheitsgehalt und juristischen Folgen seiner Meldungen. Dort ringt man sich erst am Donnerstagnachmittag, 24 Stunden nach dpa, zu einer Korrektur durch — die allerdings auf jede noch so leise Andeutung verzichtet, dass es sich um eine Korrektur einer eigenen Meldung handelt:
Freiburg (sid) Ex-Trainer Volker Finke hat vor Ablauf seines Vertrages am 30. Juni seinen Schlüssel für den Managementraum des Fußball-Zweitligisten SC Freiburg zurückgegeben. Dies bestätigte SC-Manager Dirk Dufner der Badischen Zeitung: „Wir haben — übrigens in sehr angenehmer Atmosphäre — natürlich über dieses Thema gesprochen. Er hat seinen Schlüssel am 29. Juni abgegeben, also vor dem offiziellen Ende seines Vertrages.“ (…)
Das ist die Geschichte von der Schlüsselaffäre des SC Freiburg. Ein Lehrstück über den Umgang mit Quellen und verschiedene Varianten des Stille-Post-Spiels im modernen „Nachrichten“-Journalismus.
Und das letzte Wort soll der „Tagesspiegel“ haben, dessen Mitarbeiter Claus Vetter von der kleinen, irreführenden dpa-Meldung zu einem großen Meisterwerk der Fantasie angeregt wurde:
Mal heimlich nachts in die alte Trainerkabine schleichen und kiebitzen, was der neue Trainer taktisch so vorhat? Oder nach Geschäftsschluss in der Geschäftsstelle einen Gratiskaffee trinken? So muss sich Volker Finke das vorgestellt haben, als er die Schlüssel von seinem alten Arbeitgeber, dem SC Freiburg, eingesteckt und trotz mehrfacher Aufforderung nicht herausgerückt hat. Finke hat wohl gedacht, der Klub lasse ihn schalten und walten wie die 16 Jahre zuvor. (…)
Volker Finke, eine traurige Freiburger Schlüsselfigur? Ja, das ist der 59 Jahre alte Fußballlehrer wohl. (…) Zu Hochzeiten wollte sogar mal der FC Bayern etwas von Finke. Doch der konnte nie loslassen in Freiburg – bis heute. Nun muss er draußen bleiben. Der traurige Trainer, der seinen Klub verloren hat und darüber nicht hinwegkommt.

 … Unterstützt wird die maschinelle Unerbittlichkeit des auf die Zukunft gerichteten Prozesses durch die Exponiertheit der technischen Bildschirmaufhängungen, die mit ihren kalten Industriefarben (grau und metall) auf das Fließband als Vorbild tayloristischer Produktionsweisen deuten. Die suggerierte Flexibilität durch schwenkbare Bildschirme wird konterkariert durch die Einheitlichkeit der Ausrichtung und einheitliche Höhe der Bildschirmjustage. Als weiteres, fast schon nostalgisches Attribut journalistischen Arbeitens ist jedem Bildschirm ein Telefon beigesellt. Form und Ausgestaltung der Telefone gemahnen jedoch eher an die Verwendung als „Abteilungstelefone“, als dass sie auf den Verwendungszweck des Telefons als Werkzeug echter Recherche verweisen. Überhaupt ist es nur schwer vorstellbar, dass in der dargestellten Situation von einem, geschweige denn von mehreren dieser Apparate Telefonat geführt werden. …
… Unterstützt wird die maschinelle Unerbittlichkeit des auf die Zukunft gerichteten Prozesses durch die Exponiertheit der technischen Bildschirmaufhängungen, die mit ihren kalten Industriefarben (grau und metall) auf das Fließband als Vorbild tayloristischer Produktionsweisen deuten. Die suggerierte Flexibilität durch schwenkbare Bildschirme wird konterkariert durch die Einheitlichkeit der Ausrichtung und einheitliche Höhe der Bildschirmjustage. Als weiteres, fast schon nostalgisches Attribut journalistischen Arbeitens ist jedem Bildschirm ein Telefon beigesellt. Form und Ausgestaltung der Telefone gemahnen jedoch eher an die Verwendung als „Abteilungstelefone“, als dass sie auf den Verwendungszweck des Telefons als Werkzeug echter Recherche verweisen. Überhaupt ist es nur schwer vorstellbar, dass in der dargestellten Situation von einem, geschweige denn von mehreren dieser Apparate Telefonat geführt werden. …

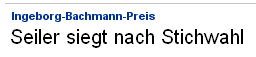
 Aber das ist hier keine Sport-Geschichte, sondern eine Medien-Geschichte. Sie beginnt, wie so viele, in der „Bild“-Zeitung. Sie berichtet am Dienstag, Finke habe „trotz mehrfacher Aufforderung seine Schlüssel nicht abgegeben“. Der Verein habe deshalb die Schlösser ausgetauscht, schreibt „Bild“ und zitiert den neuen Sportdirektor Dirk Dufner mit dem Satz: „Ja – wir wollten einfach unsere Ruhe und keinen Ärger haben!“
Aber das ist hier keine Sport-Geschichte, sondern eine Medien-Geschichte. Sie beginnt, wie so viele, in der „Bild“-Zeitung. Sie berichtet am Dienstag, Finke habe „trotz mehrfacher Aufforderung seine Schlüssel nicht abgegeben“. Der Verein habe deshalb die Schlösser ausgetauscht, schreibt „Bild“ und zitiert den neuen Sportdirektor Dirk Dufner mit dem Satz: „Ja – wir wollten einfach unsere Ruhe und keinen Ärger haben!“