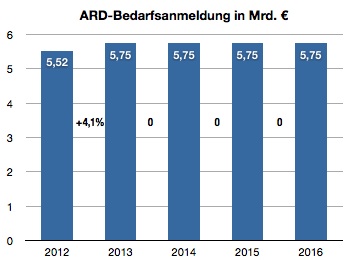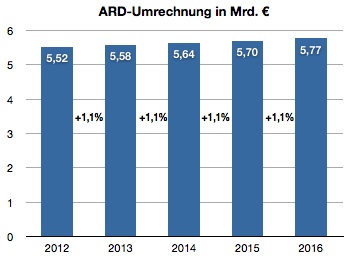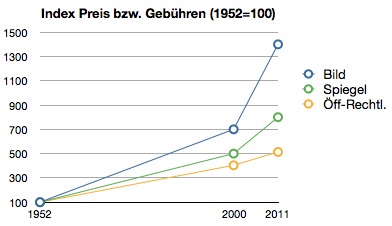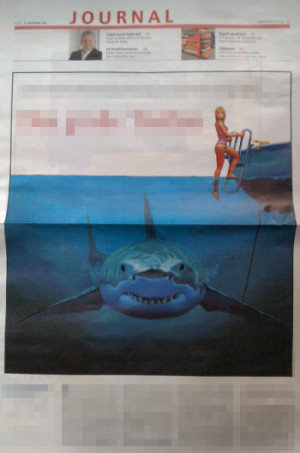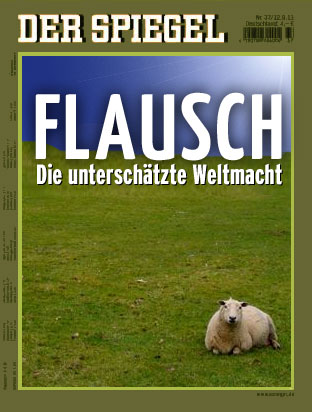Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Wie gut kennen wir eigentlich unsere besten Freunde aus dem Netz? Und ist eine online geschlossene Beziehung automatisch weniger wert, als eine echte zum Anfassen?
Am Dienstag vergangener Woche tauchte auf Facebook eine Suchmeldung auf. Wer den Publizisten und Internet-Unternehmer Robin Meyer-Lucht gesehen hatte, sollte sich dringend unter einer angegebenen Telefonnummer melden.
Es dauerte nicht lange, bis die ersten Zyniker den Eintrag kommentierten: Da wolle sich wohl jemand mit einem geschmacklosen Marketinggag ins Gespräch bringen, man weiß doch, wie das geht, im Netz.
Es war kein Marketinggag, und wenig später wurde Meyer-Lucht tot aufgefunden. Nach der öffentlichen Suche im Internet begann die öffentliche Trauer im Internet. Menschen würdigten Robin Meyer-Lucht in ihren Blogs, in Kommentaren, auf ihren Profilseiten. Das Netz zeigte sich von seiner sozialen Seite und wahrhaftig als Netz: eine Verbindung von Menschen, die die Trauer um einen Verstorbenen eint.
Beim Lesen dieser Texte konnte man aber auch die Ahnung einer Leerstelle bekommen; das Gefühl, dass viele dem Menschen, dessen Verlust sie beklagten, nicht nahe waren. Dass sie einige Artikel kannten und vielleicht Teile seiner Biographie, aber nicht den Menschen. Noch deutlicher war das vor einigen Monaten, als plötzlich Jörg-Olaf Schäfers starb, Kolumnist dieser Zeitung und auch ein Netzaktivist, ebenfalls nicht einmal 40 Jahre alt. Viele Einträge lasen sich wie Nachrufe auf einen unbekannten Freund.
Wer wollte, konnte im Umgang mit diesen Todesfällen einen Beleg nicht für das Soziale im Netz sehen, sondern für seine Oberflächlichkeit; dafür, dass die Nähe, die von den ganzen „Freundschafts“-Anfragen, dem Aufleuchten von Namen im Chatfenster, dem Folgen auf Twitter suggeriert wird, nur eine Illusion ist.
Was sind sie wert, die Freundschaften, die wir im Internet pflegen? Und ist „pflegen“ – damit fängt es schon an – überhaupt das richtige Wort für etwas, das sich mit so wenig persönlichem Einsatz bewerkstelligen lässt: ein „Gefällt mir“-Klick hier, ein lustiger Kommentar dort; ohne das peinliche Schweigen in einem direkten Gespräch aushalten zu müssen, das Ungemütliche bei einem persönlichen Treffen; ohne die Notwendigkeit räumlicher oder auch nur zeitlicher Nähe (die E-Mail lässt sich später beantworten, wenn es gerade passt).
Unser Diskurs über das Internet wird von einer fundamentalen Prämisse geprägt: Online-Beziehungen sind richtigen Beziehungen; Online-Gespräche sind keine richtigen Gespräche. Es ist, als würden im Internet tatsächlich Computer miteinander kommunizieren, und nicht Menschen, die sie bedienen. Es sind nicht nur minderwertige Kontakte, es sind gar keine echten Kontakte.
Als die Drogenbeauftragte der Bundesregierung in dieser Woche eine Studie über „Internetsucht“ vorstellte, beschrieb der Direktor des Hamburger Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung, Jens Reimer, die gefährliche Anziehungskraft des Internets so: Die einzigartige Möglichkeit, online „soziale Kontakte zu pflegen“, steigere bei bestimmten Personen die Bereitschaft, ihr „Sozialleben“ in größerem Maß aufzugeben.
Ein Sinn ergibt dieser Befund nur, wenn man Online-Freundschaften nicht als reale Freundschaften wertet und den Austausch mit Freunden im Internet nicht als „Sozialleben“ akzeptiert – wie es implizit auch die Drogenbeauftragte implizit tut. Die vermeintlich internetsüchtigen, angeblich vereinsamenden Jugendlichen sind in Sozialen Netzwerken ganz besonders aktiv. Dass dieser Widerspruch in der öffentlichen Debatte nicht einmal auffällt und nach Erklärungen verlangt, zeigt, wie vollständig die Wahrnehmung des Internet von der Prämisse bestimmt ist, dass das, was online passiert, nicht echt ist.
Der Hamburger Medienforscher Jan Schmidt vermutet, es könnte am ursprünglichen Begriff „Cyberspace“ liegen, der als Metapher so überzeugend war, dass wir nun mit dem Bild eines vom wahren Lebens abgetrennten Raum auf das Internet schauen. Es könnte auch Ausdruck davon sein, dass das Internet als Aufenthaltsraum noch so neu und unfertig ist und wir im Umgang mit ihm so ungeübt. Vielleicht ist es schnöder Kulturpessimismus. Ganz sicher bündelt sich in der Abtrennung und Verteufelung des Internet aber auch die teils vage, teils sehr konkrete Angst vieler etablierter Institutionen vor dem Verlust an Macht und Kontrolle.
Dass wir dem, was im Internet passiert, die Echtheit absprechen,ist umso bemerkenswerter, als wir Kindern und Jugendlichen doch sonst im Gegenteil vermitteln wollen, dass das Internet kein von der Welt abgekoppelter Raum ist; dass Dinge, die sie online tun, offline Konsequenzen haben. Dass sie sich überlegen müssen, welche Fotos sie hochladen, und dass ein verbaler Angriff in einem virtuellen Forum jemanden tatsächlich verletzt.
Die amerikanische Wissenschaftlerin Danah Boyd, die die Nutzung sozialer Netzwerke durch Jugendliche untersucht hat, beschreibt in ihrer Promotion „Taken Out of Context“ anschaulich, wie sie lernen, dass virtuelle Erfindungen wie etwa ein Freundesranking auf MySpace sehr handfeste Auswirkungen auf die tatsächlichen Beziehungen unter den Betroffenen hat.
Die meisten Jugendlichen vernetzen sich online vor allem mit ihrem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis aus der Schule. Sie haben realistische Vorstellungen darüber, dass nur ein kleiner Teil derjenigen, mit denen sie dort als „Freunde“ verbunden sind, tatsächlich eine enge Beziehung zu ihnen haben, und wissen die anderen dennoch zu schätzen. Und obwohl vieles an der Art, wie digital kommuniziert wird, fundamental anders ist, erfüllt sie dieselben Bedürfnisse: Junge Leute suchen und finden ihre eigene Rolle, vergewissern sich ihrer Identität, entwickeln Beziehungen.
Das findet an Orten statt, die sich der Kontrolle durch Erwachsene entziehen – aber Boyd erinnert daran, dass das immer schon so war. Früher verschwendeten die Jugendlichen ihre Zeit nicht in Chatrooms, sondern lungerten in Einkaufspassagen oder auf Parkplätzen herum. Aber analog zur Stigmatisierung all dessen, was im Internet stattfindet, wird die vermeintlich reale Welt verklärt. Jeder Kinobesuch ist demnach dem Ansehen von Online-Videos unterlegen – das erste gilt als soziale Aktivität, das zweite beinhaltet, egal wie intensiv der Austausch darüber in Foren oder Chats ist, die Gefahr der Vereinsamung.
Auch die Studie, wonach eine halbe Million Deutsche „internetsüchtig“ sind, beruht auf solchen Unterstellungen und befördert sie. Anstatt zu differenzieren, worin genau die Abhängigkeit besteht, ob es etwa konkret um Online-Spiele geht oder virtuellen Sex, wird der Ort an sich zur Gefahr erklärt. Eine der Schlüsselfragen, die zur Diagnose gestellt werden, lautet: „Wie häufig bevorzugen Sie das Internet statt Zeit mit anderen zu verbringen, z.B. mit Ihrem Partner, Kindern, Eltern, Freunden.“ Die Möglichkeit, im Internet „Zeit mit anderen zu verbringen“, ist nicht vorgesehen. Nähe und Gemeinsamkeit zählen nur in analoger, körperlicher Form. Das Internet wird konsequent als wirklichkeitsferner, einsamer Fluchtort definiert. Fragen wie: „Wie häufig setzen Sie Ihren Internetgebrauch fort, obwohl Sie eigentlich aufhören wollten?“ tun ihr übriges. (Man ersetze Internetgebrauch testweise durch Bücherlesen, Schlafen oder Essen.)
Natürlich gibt es im Internet Formen der Kommunikation, die in jeder Hinsicht virtuell sind. Menschen nehmen in Fantasiewelten Fantasierollen ein – und verlieren sich vielleicht darin. Das ist aber etwas grundsätzlich anderes als die alltäglichen sozialen Aktivitäten von Menschen im Netz. Die pauschale Entwertung von Internet-Kontakten verhindert eine Auseinandersetzung damit, welche Art von Kommunikation tatsächlich in eine soziale Isolation führen kann.
Die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel behauptete im vergangenen Jahr im „Tagesspiegel“ in einem Essay über „virtuelle Nähe“: „Die wahren Freundschaften bei Facebook entstehen nicht dort, sondern sie entstehen im wirklichen Leben und werden ins Digitale übertragen.“ Das ist nicht nur anmaßend. Es ist auch bezeichnend in der behaupteten Dichotomie zwischen dem „wirklichen Leben“ und dem unwirklichen Internet – und den Werten, die ihnen jeweils zugeschrieben werden.
Die „wirkliche Welt“, um das mal auszusprechen, ist die, in der ein Personalchef bestimmt hat, mit wem man den Abend nach der Arbeit in der Kneipe verbringt. Im Gegensatz zum unwirklichen Internet, wo man sich über so abwegige Dinge wie gemeinsame Interessen kennenlernt und von so oberflächlichen Dingen wie der Art, Texte zu formulieren, beeinflussen lässt. Nein, wie sollen dort, über den regelmäßigen Austausch von Briefen und Kurznachrichten, über das Teilen eigener Erlebnisse, interessanter Artikel oder unterhaltsamer Links, „wahre Freundschaften“ entstehen?
Ich habe schon an so unwirtlichen Orten wie der Kommentarspalte meines Blogs nette und interessante Menschen kennengelernt, und aus einigen sind meine engsten Freunde geworden. Es sind Online-Kontakte von großer Intensität, voller Leben, Kommunikation und Austausch über alles, was man im Internet findet, also: alles.
Wir haben uns später auch in der „wirklichen Welt“ getroffen, wie Frau Meckel sagen würde, und aus den Kontakten echte Kontakte gemacht, wie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung finden würde, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob die wichtigsten, intensivsten Momente in der analogen oder der digitalen Welt stattfanden. Die Unterscheidung ist sinnlos.
Richtig ist, dass es Facebook und ähnliche Online-Angebote erleichtern, Kontakte auf einem nicht-intensiven Niveau aufrecht zu erhalten; lose in Verbindung zu bleiben mit alten Schulfreunden oder Kollegen oder vage Beziehungen zu haben mit Menschen, mit denen uns nur ein spezielles Interesse verbindet.
Muss man sich sorgen, wenn jemand Kontakte in seinem räumlichen Umfeld zugunsten von Kontakten in einem Online-Netzwerk aufgibt? Oder nur, wenn jemand tiefgründige Beziehungen zugunsten oberflächlicher Kontakte kappt?
Angeblich ist unser Gehirn schon rein physikalisch nicht in der Lage, mit mehr als 150 anderen Menschen irgendeine Art von bedeutungsvoller Beziehung zu haben – das ist die sogenannte Dunbar-Zahl, benannt nach dem Anthropologen Robin Dunbar. Er hat sie durch einen Vergleich der Gehirngröße verschiedener Primatenarten mit der Größe ihrer sozialen Bezugsgruppen entwickelt. Sie wird trotzdem regelmäßig ernst genommen und als Beleg dafür genutzt, dass Menschen keine Hunderte oder Tausende Facebook-„Freunde“ haben können.
„Ja, ich kann mithilfe deines Tweets herausfinden, was du zum Frühstück hatte, aber kann ich dich wirklich besser kennen lernen?“, fragte Dunbar in einem Interview mit dem „Observer“. Zweifellos schaffen Facebook-Funktionen, bei denen Nutzer ihr Leben vom Babyfoto an dokumentieren, die Illusion einer Nähe, die ein gemeinsames Erleben nicht ersetzen kann. Aber es gibt keinen Grund, dieses gemeinsame Erleben auf Offline-Erfahrungen zu beschränken.
Wie bizarr ist es, dass im öffentlichen Diskurs ausgerechnet das Medium geringgeschätzt wird, das Kommunikation möglich macht, die nicht flüchtig ist? In der man teilweise auch eine Rennaissance der Kultur des Briefeschreibens sehen kann? Stattdessen gilt die Sichtbarkeit und Permanenz profaner Sekundenaufnahmen aus dem Alltag, die nur Offline-Alltag online sichtbar macht, als Beleg für die Lächerlichkeit digitaler Kommunikation.
„Wörter entgleiten uns“, behauptet Dunbar. „Jede Berührung ist tausend Wörter wert.“ Der Satz formuliert exemplarisch den Dünkel gegenüber allem, was nicht handfest begreifbar ist.
Für die Menschen, die Robin Meyer-Lucht und Jörg-Olaf Schäfers im Netz betrauert haben, waren die vielen Online-Kommentare sicher eine Form der tröstenden Umarmung. Das ersetzt keine tatsächliche Berühung, aber es ist eine Bereicherung, und sie ist echt und nicht virtuell. Und dass man oft erahnen konnte, dass sie die Verstorbenen nicht wirklich kannten, ist kein Zeichen für die Oberflächlichkeit der Online-Welt, sondern spiegelt nur wieder, dass wir von vielen Menschen, die in unserem Leben eine Rolle spielen, nur einen winzigen Ausschnitt kennen. Neu ist nicht diese Form der Beziehung. Neu ist nur die öffentliche Form privater Trauer.